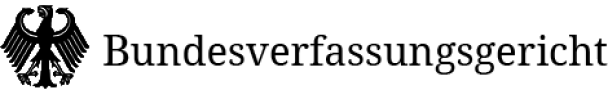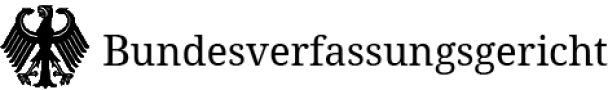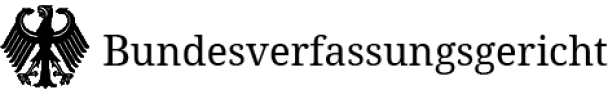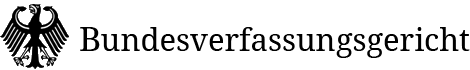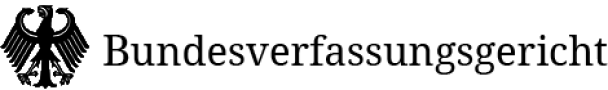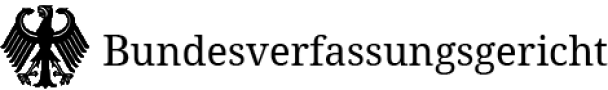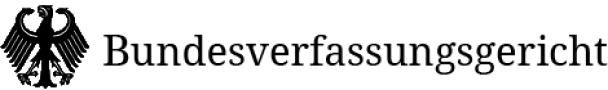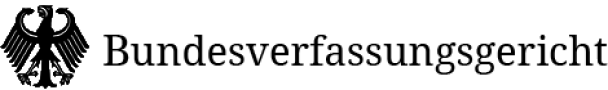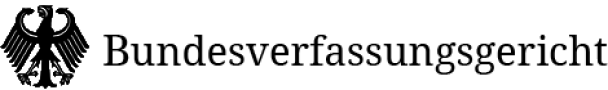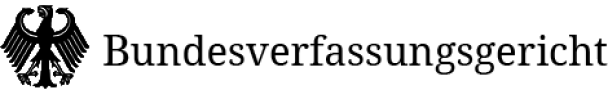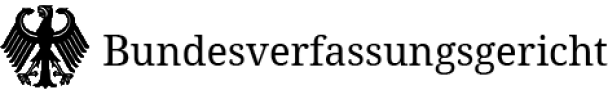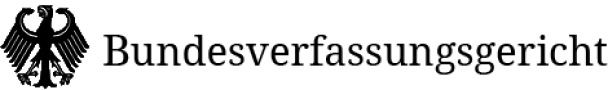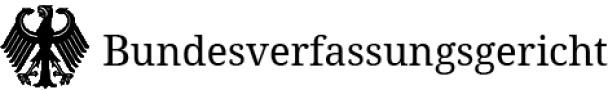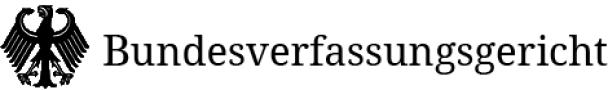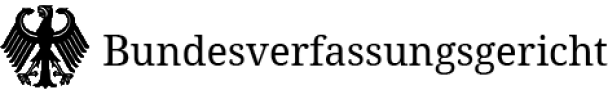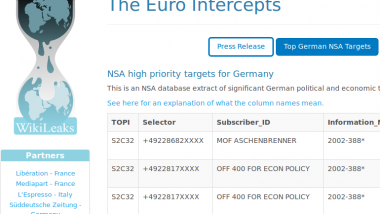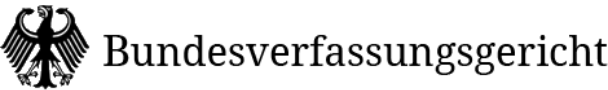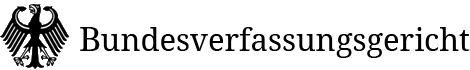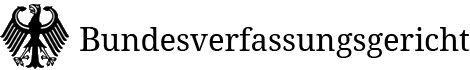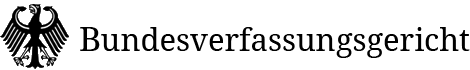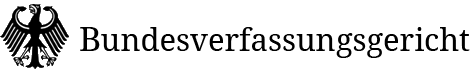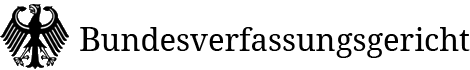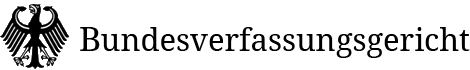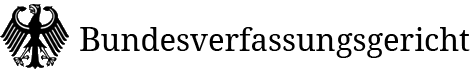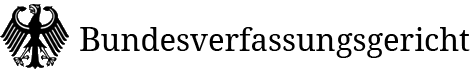Mein
schlägt Links
persönliche Anmerkung:
Nur gut, dass die Richter über ihr eigenes Gehalt bzw. das ihrer Kollegen selbst "Recht sprechen" dürfen und können.
Es sei doch die Fragen gestattet, ob es denn zum Leben ausreichend ist, mit solchen "Alimenten des Staates" wie Hartz IV abgespeist zu werden, nachdem die betroffenen Menschen zuvor auf unwürdiger Weise, erniedrig worden sind, damit sie überhaupt ihren Anspruch geltend machen können. Ist es gem. ihrer großen Verantwortung auf Leib und Leben verantwortlich und zulässig, dass Mitarbeiter des Gesundheitswesen, Rettungskräfte, Mitarbeiter im Bildungswesen, ja in allen Lebensbereichen unterdurchschnittlich entlohnt werden, in oftmals unwürdigen Arbeitsbedingungen ihre Leistung erbringen, nicht ausreichend Wohnraum und dazu bezahlbaren Wohnraum haben. Es Kinder und Erwachsene in diesem Land gibt, die Obdachlos sind, hungern müssen usw.? Wo bitte schön ist in diesen Fällen die Rechtssprechung der Obersten Richter?
Es war und ist bleibt letztendlich immer eine Systemfrage, die es zu beantworten gilt?
------------------------------------------------------
Richterbesoldung im Land Berlin in den Jahren 2009 bis 2015 in verfassungswidriger Weise zu niedrig bemessen
Pressemitteilung Nr. 63/2020 vom 28. Juli 2020
Beschluss vom 04. Mai 2020
2 BvL
4/18
Die Besoldungsvorschriften des Landes Berlin sind mit dem von Art. 33 Abs. 5 GG gewährleisteten Alimentationsprinzip unvereinbar, soweit sie die Besoldung der Richter und Staatsanwälte der Besoldungsgruppen R 1 und R 2 in den Jahren 2009 bis 2015 sowie der Besoldungsgruppe R 3 im Jahr 2015 betreffen. Dies hat der Zweite Senat mit heute veröffentlichtem Beschluss entschieden. Eine Gesamtschau der für die Bestimmung der Besoldungshöhe maßgeblichen Parameter ergibt, dass die gewährte Besoldung evident unzureichend war. Sie genügte nicht, um Richtern und Staatsanwälten einen nach der mit ihrem Amt verbundenen Verantwortung angemessenen Lebensunterhalt zu ermöglichen. Der Gesetzgeber des Landes Berlin hat verfassungskonforme Regelungen mit Wirkung spätestens vom 1. Juli 2021 an zu treffen. Eine rückwirkende Behebung ist hinsichtlich derjenigen Richter und Staatsanwälte erforderlich, sie sich gegen die Höhe ihrer Besoldung zeitnah mit den statthaften Rechtsbehelfen gewehrt haben. Dabei ist es unerheblich, ob insoweit ein Widerspruchs- oder ein Klageverfahren schwebt.
Sachverhalt:
Die Kläger der Ausgangsverfahren sind ein Vorsitzender Richter am Landgericht (Besoldungsgruppe R 2), ein Richter am Landgericht (Besoldungsgruppe R 1) und die Witwe eines Vorsitzenden Richters am Kammergericht (Besoldungsgruppe R 3), der im Jahr 2015 in dieses Amt befördert worden war und wenig später verstarb. Die erstmals im Jahr 2009 gegen die Besoldungshöhe erhobenen Widersprüche der Kläger blieben ebenso wie ihre nachfolgenden Klagen vor dem Verwaltungsgericht bis in die Berufungsinstanz erfolglos. Das Bundesverwaltungsgericht hat das Revisionsverfahren ausgesetzt, um dem Bundesverfassungsgericht die Frage vorzulegen, ob die Besoldung in den genannten Besoldungsgruppen mit Art. 33 Abs. 5 GG vereinbar sei.
Wesentliche Erwägungen des Senats:
I. Das zu den
hergebrachten Grundsätzen des Berufsbeamtentums zählende Alimentationsprinzip verpflichtet den Dienstherrn, Richtern und Beamten sowie ihren Familien lebenslang einen Lebensunterhalt zu gewähren, der
ihrem Dienstrang und der mit ihrem Amt verbundenen Verantwortung angemessen ist und der Entwicklung des allgemeinen Lebensstandards entspricht. Damit wird der Bezug der Besoldung sowohl zu der
Einkommens- und Ausgabensituation der Gesamtbevölkerung als auch zur Lage der Staatsfinanzen hergestellt. Diese Gewährleistung einer rechtlich und wirtschaftlich gesicherten Position bildet die
Voraussetzung und innere Rechtfertigung für die lebenslange Treuepflicht sowie das Streikverbot. Der Besoldungsgesetzgeber verfügt über einen weiten Entscheidungsspielraum. Dem entspricht eine
zurückhaltende verfassungsgerichtliche Kontrolle. Ob die Bezüge evident unzureichend sind, muss anhand einer Gesamtschau verschiedener Kriterien geprüft werden. Dies erfolgt in mehreren
Schritten:
Auf der ersten Prüfungsstufe wird mit Hilfe von fünf Parametern ein Orientierungsrahmen für eine grundsätzlich verfassungsgemäße Ausgestaltung der Alimentationsstruktur und des Alimentationsniveaus
ermittelt (Vergleich der Besoldungsentwicklung mit der Entwicklung der Tarifentlohnung im öffentlichen Dienst, des Nominallohnindex sowie des Verbraucherpreisindex, systeminterner Besoldungsvergleich
und Quervergleich mit der Besoldung des Bundes und anderer Länder). Beim systeminternen Besoldungsvergleich ist neben der Veränderung der Abstände zu anderen Besoldungsgruppen in den Blick zu nehmen,
ob in der untersten Besoldungsgruppe der gebotene Mindestabstand zum Grundsicherungsniveau eingehalten ist. Ein Verstoß hiergegen betrifft insofern das gesamte Besoldungsgefüge, als sich der vom
Gesetzgeber selbst gesetzte Ausgangspunkt für die Besoldungsstaffelung als fehlerhaft erweist.
Auf der zweiten Prüfungsstufe sind die Ergebnisse der ersten Stufe mit den weiteren alimentations-relevanten Kriterien im Rahmen einer Gesamtabwägung zusammenzuführen. Werden mindestens drei
Parameter der ersten Prüfungsstufe erfüllt, besteht die Vermutung einer verfassungswidrigen Unteralimentation. Werden umgekehrt bei allen Parametern die Schwellenwerte unterschritten, wird eine
angemessene Alimentation vermutet. Sind ein oder zwei Parameter erfüllt, müssen die Ergebnisse der ersten Stufe, insbesondere das Maß der Über- beziehungsweise Unterschreitung der Parameter, zusammen
mit den auf der zweiten Stufe ausgewerteten Kriterien im Rahmen der Gesamtabwägung eingehend gewürdigt werden. Ergibt die Gesamtschau, dass die zur Prüfung gestellte Besoldung grundsätzlich als
verfassungswidrige Unteralimentation einzustufen ist, bedarf es auf der dritten Stufe der Prüfung, ob dies ausnahmsweise gerechtfertigt sein kann.
II. An diesen
Maßstäben gemessen sind die Vorgaben des Art. 33 Abs. 5 GG nicht erfüllt.
Eine Gesamtschau der für die Bestimmung der Besoldungshöhe maßgeblichen Parameter ergibt, dass die im Land Berlin in den verfahrensgegenständlichen Jahren und Besoldungsgruppen gewährte Besoldung
evident unzureichend war. Sie genügte nicht, um Richtern und Staatsanwälten nach der mit ihrem Amt verbundenen Verantwortung und nach der Bedeutung dieser Ämter für die All-gemeinheit einen der
Entwicklung der allgemeinen wirtschaftlichen und finanziellen Verhältnisse und des allgemeinen Lebensstandards angemessenen Lebensunterhalt zu ermöglichen. Bei der Fest-legung der Grundgehaltssätze
wurde die Sicherung der Attraktivität des Amtes eines Richters oder Staatsanwalts für entsprechend qualifizierte Kräfte, das Ansehen dieses Amtes in den Augen der Gesellschaft, die von Richtern und
Staatsanwälten geforderte Ausbildung, ihre Verantwortung und ihre Beanspruchung nicht hinreichend berücksichtigt.
Für alle verfahrensgegenständlichen Jahre lässt sich feststellen, dass die Besoldungsentwicklung in den jeweils vorangegangenen 15 Jahren um mindestens 5 % hinter der Entwicklung der Tariflöhne im
öffentlichen Dienst und der Verbraucherpreise zurückgeblieben war. In den Jahren 2010 bis 2014 lag die Differenz zur Tariflohnsteigerung bei über 10 %. Auch wurde das Mindestabstandsgebot in den
unteren Besoldungsgruppen durchgehend deutlich verletzt. Hinsichtlich der Entwicklung des Nominallohnindex und im Quervergleich mit der Besoldung in Bund und Ländern wurden die maßgeblichen
Schwellenwerte nicht überschritten. Weil damit drei von fünf Parametern der ersten Stufe erfüllt sind, besteht die Vermutung einer verfassungswidrigen Unteralimentation.
Diese wird erhärtet, wenn man im Rahmen der Gesamtabwägung die weiteren alimentationsrelevanten Kriterien einbezieht. Mit dem Amt eines Richters oder Staatsanwaltes sind vielfältige und
anspruchsvolle Aufgaben verbunden, weshalb hohe Anforderungen an den akademischen Werdegang und die Qualifikation ihrer Inhaber gestellt werden. Gleichwohl hat das Land Berlin nicht nur die formalen
Einstellungsanforderungen abgesenkt, sondern auch in erheblichem Umfang Bewerber eingestellt, die nicht in beiden Examina ein Prädikat („vollbefriedigend“ und besser) erreicht hatten. Dies zeigt,
dass die Alimentation ihre qualitätssichernde Funktion, durchgehend überdurchschnittliche Kräfte zum Eintritt in den höheren Justizdienst in Berlin zu bewegen, nicht mehr erfüllt hat.
Gegenüberstellungen mit Vergleichsgruppen außerhalb des öffentlichen Dienstes führen im Rahmen der Gesamtabwägung zu keiner anderen Bewertung. Schließlich sind verschiedene Einschnitte im Bereich des
Beihilfe- und Versorgungsrechts zu berücksichtigen, die das zum laufenden Lebensunterhalt verfügbare Einkommen zusätzlich gemindert haben.
Kollidierendes Verfassungsrecht, zu der auch die Verpflichtung zur Haushaltskonsolidierung (Art. 109 Abs. 3 Satz 1 in Verbindung mit Art. 143d Abs. 1 GG) zählt, vermag diese Unterschreitung des durch Art. 33 Abs. 5 GG gebotenen Besoldungsniveaus nicht zu rechtfertigen. Insbesondere hat das Land Berlin nicht dargetan, dass die teilweise drastische Abkopplung der Besoldung der Richter und Staatsanwälte von der allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklung in Berlin Teil eines schlüssigen und umfassenden Konzepts der Haushaltskonsolidierung gewesen wäre, bei dem die Einsparungen – wie verfassungsrechtlich geboten – gleichheitsgerecht erwirtschaftet werden sollten.
------------------------------------------------------
Verfassungsmäßige Volksverhetzungsverurteilung wegen Bezeichnung als „frecher Juden-Funktionär“ und Boykottaufruf gegen jüdische Gemeinde
Pressemitteilung Nr. 59/2020 vom 10. Juli 2020
Beschluss vom 07. Juli 2020
1 BvR 479/20
Die 2. Kammer des Ersten Senats des Bundesverfassungsgerichts hat mit heute veröffentlichtem Beschluss eine Verfassungsbeschwerde nicht zur Entscheidung angenommen, die sich gegen eine strafgerichtliche Verurteilung wegen Volksverhetzung nach § 130 Abs. 1 StGB richtete.
Die Kammer bekräftigt mit dem Beschluss zum einen, dass die in der Wunsiedel-Entscheidung des Senats anerkannte Ausnahme vom Allgemeinheitserfordernis des Art. 5 Abs. 2 GG die inhaltlichen Anforderungen an Beschränkungen der Meinungsfreiheit nicht aufhebt oder verändert. Beschränkungen der Meinungsfreiheit dürfen - auch wenn sie in Bezug zu nationalsozialistischem Gedankengut stehen - nicht auf den rein geistigen Gehalt einer Äußerung zielen. Die Kammer hält zum andern aber fest, dass Einschränkungen nach allgemeinen Grundsätzen rechtlich zulässig sind, wenn Äußerungen die Schwelle zu einer Verletzung oder konkreten Gefährdung von Rechtsgütern überschreiten. Das kann etwa der Fall sein, wenn sie einen gegen bestimmte Personen oder Gruppen gerichteten hetzerischen, die Friedlichkeit der öffentlichen Diskussion verletzenden Charakter aufweisen. Um einen solchen Fall handelt es sich hier.
Sachverhalt:
Im Vorfeld der bestraften Äußerungen hatte der Westdeutsche Rundfunk darüber berichtet, dass eine nordrheinwestfälische Gemeinde ihr Amtsblatt von einem Verleger herausgeben ließ, dessen Inhaber über einen anderen Verlag auch Schriften mit rechtsradikalem Hintergrund verbreite. Der Vorsitzende einer jüdischen Gemeinde in der Region hatte deshalb gefordert, dass die Gemeinde ihr Amtsblatt in einem anderen Verlag herausgeben solle. Daraufhin veröffentlichte der Beschwerdeführer, der damalige Vorsitzende eines Ortsverbands der Partei DIE RECHTE, auf der von ihm verantworteten Internetseite der Partei einen Artikel, in dem er zunächst allgemein den Versuch, „Dissidenten … mundtot zu machen“ kritisiert. Das sei nun auch im Fall eines „politischen nonkonformen Verlegers“ zu beobachten, der auch ein Buch „über vorbildliche und bewährte Männer der Waffen-SS“ verlege. „Politisch korrekten Sittenwächtern“ in den Medien, stoße das „sauer auf“. „Noch dreister gebärde sich [Name des Betroffenen], Vorsitzender der Jüdischen Gemeinde H., wohnhaft [Wohnort des Betroffenen].“ „Selbstgefällig“ fordere „der freche Juden-Funktionär die Stadt dazu auf, umgehend Konsequenzen zu ziehen.“ Angesichts der „massiven Hetzkampagne von Medien, Linken und Jüdischer Gemeinde“ sei „jegliche Kooperation mit der Jüdischen Gemeinde H. unverzüglich einzustellen“. Die Partei DIE RECHTE würde „den Einfluss jüdischer Lobbyorganisationen auf die deutsche Politik in allerkürzester Zeit auf genau Null reduzieren [… und] sämtliche staatliche Unterstützung für jüdische Gemeinden streichen und das Geld für das Gemeinwohl einsetzen.“
Wegen dieser Äußerungen verurteilten die Strafgerichte den mehrfach einschlägig vorbestraften Beschwerdeführer wegen Volksverhetzung und Beleidigung zu einer Freiheitsstrafe von sechs Monaten ohne Bewährung.
Wesentliche Erwägungen der Kammer:
Wenngleich die strafgerichtlichen Entscheidungen teilweise ein unpräzises Verständnis der vom Bundesverfassungsgericht in seiner Wunsiedel-Entscheidung anerkannten Ausnahme vom Allgemeinheitserfordernis des Art. 5 Abs. 2 GG in Bezug auf die Verherrlichung der nationalsozialistischen Gewalt- und Willkürherrschaft (§ 130 Abs. 4 StGB) zugrunde gelegt haben, begegnen sie im Ergebnis keinen verfassungsrechtlichen Bedenken.
Diese Ausnahme betrifft - entgegen der Annahme des Landgerichts - allein die formelle Anforderung, dass Gesetze nicht gegen eine bestimmte Meinung gerichtet sein dürfen (Standpunktneutralität). Sie erlaubt dem Gesetzgeber, Strafnormen zu schaffen, die nicht abstrakt formuliert sind, sondern gegen die Verherrlichung der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft gerichtet sind. Eine solche Strafvorschrift, die spezifisch an den Nationalsozialismus anknüpft, steht hier jedoch nicht in Frage, sondern der allgemeine Volksverhetzungstatbestand des § 130 Abs. 1 StGB. Demgegenüber gilt auch für Äußerungen mit Bezug auf den Nationalsozialismus keine allgemeine, auch inhaltliche Ausnahme von den Anforderungen an meinungsbeschränkende Gesetze. Das Grundgesetz kennt kein allgemeines antinationalsozialistisches Grundprinzip, das ein Verbot der Verbreitung rechtsradikalen oder auch nationalsozialistischen Gedankenguts schon in Bezug auf die geistige Wirkung seines Inhalts erlaubte. Vielmehr gewährleistet Art. 5 Abs. 1 und 2 GG die Freiheit der Meinung als Geistesfreiheit unabhängig von der inhaltlichen Bewertung ihrer Richtigkeit oder Gefährlichkeit. Die Meinungsfreiheit verbietet daher den staatlichen Zugriff auf die Gesinnung und lässt Eingriffe erst zu, wenn Meinungsäußerungen die rein geistige Sphäre des Für-richtig-Haltens verlassen und in Rechtsgutverletzungen oder erkennbar in Gefährdungslagen umschlagen. Das ist der Fall, wenn sie den öffentlichen Frieden als Friedlichkeit der öffentlichen Auseinandersetzung gefährden und so den Übergang zu Aggression oder Rechtsbruch markieren.
Allerdings ist für die Beurteilung von Äußerungen nach allgemeinen Grundsätzen ihre konkrete Wirkung im jeweiligen Kontext in Betracht zu nehmen. Dabei gebieten die besonderen Erfahrungen der deutschen Geschichte, insbesondere die damals durch zielgerichtete und systematische Hetze und Boykottaufrufe eingeleitete und begleitete Entrechtung und systematische Ermordung der jüdischen Bevölkerung Deutschlands und Europas, eine gesteigerte Sensibilität im Umgang mit der abwertenden Bezeichnung eines anderen als „Juden“. Insoweit kommt es darauf an, ob in der Äußerung eine die Friedlichkeitsgrenze überschreitende Aggression liegt. Je nach Einzelfall, insbesondere wenn die sich äußernde Person auf eine Stimmungsmache gegen die jüdische Bevölkerung zielt oder sich in der Äußerung mit der nationalsozialistischen Rassenideologie identifiziert, kann darin eine menschenverachtende Art der hetzerischen Stigmatisierung von Juden und damit implizit verbunden auch eine Aufforderung an andere liegen, sie zu diskriminieren und zu schikanieren. Maßgeblich bleibt allerdings die Äußerung selbst und ihr unmittelbarer Kontext, nicht die innere Haltung oder die parteiliche Programmatik, die möglicherweise den Hintergrund einer Äußerung bilden.
b) Nach diesen Maßstäben begegnen die angegriffenen Entscheidungen keinen verfassungsrechtlichen Bedenken. Die Gerichte haben ihre Bewertung der bestraften Äußerungen als ein Aufstacheln zum Hass gegen die jüdische Bevölkerung insbesondere nicht auf die allgemeine ideologische Ausrichtung des Beschwerdeführers und seiner Partei, sondern auf die Äußerung selbst gestützt. Sie weisen nachvollziehbar darauf hin, dass das Ziel des Beschwerdeführers, zum Hass gegen die jüdische Bevölkerung aufzustacheln, insbesondere aus der Verwendung von seitens der nationalsozialistischen antisemitischen Propaganda verwendeter Termini („frecher Jude“), aus der positiven Hervorhebung der „Männer der Waffen-SS“ und aus dem unmittelbar an die Äußerung angeschlossenen Boykottaufruf gegenüber der vom Betroffenen geleiteten jüdischen Gemeinde deutlich wurde. Diese Stoßrichtung der Äußerung wird auch durch deren Einbettung in den Vorwurf eines angeblich besonders ausgeprägten Einflusses jüdischer Organisationen auf die Politik in Deutschland, die ersichtlich den Topos einer angeblichen jüdischen Weltverschwörung aufgreifen soll, klar kenntlich. Schließlich weisen die Strafgerichte zutreffend darauf hin, dass die Ankündigung, den Einfluss jüdischer Organisationen auf die deutsche Politik „in allerkürzester Zeit auf genau Null reduzieren“ zu wollen, in ihrer Militanz an nationalsozialistische Vernichtungsrhetorik anknüpft. Spezifisch gegen die jüdische Bevölkerung gerichtet begründet eine solche verbale Anlehnung aufgrund der historischen Erfahrung und Realität eines solchen Vernichtungsunterfangens einen konkret drohenden Charakter, trägt die Gefahr in sich, die politische Auseinandersetzung ins Feindselige und Unfriedliche umkippen zu lassen und gefährdet damit deren grundlegende Friedlichkeit. Eben dagegen schützt der Tatbestand der Volksverhetzung nach § 130 Abs. 1 StGB.
------------------------------------------------------
Verstoß gegen Art. 38 Abs. 1 Satz 2 GG durch polizeiliches Betreten von Abgeordnetenbüros
Pressemitteilung Nr. 53/2020 vom 30. Juni 2020
Beschluss vom 09. Juni 2020
2 BvE
2/19
Mit heute veröffentlichtem Beschluss hat der Zweite Senat entschieden, dass der Präsident des Deutschen Bundestages einen Abgeordneten in seinem Recht aus Artikel 38 Absatz 1 Satz 2 des Grundgesetzes dadurch verletzt hat, dass die Polizei beim Deutschen Bundestag seine Abgeordnetenräume betreten hat. Anlässlich eines Staatsbesuchs des türkischen Staatspräsidenten hatten die Beamten dort angebrachte Plakatierungen mit Zeichen der kurdischen Volksverteidigungseinheiten YPG entfernt. Zur Begründung der Entscheidung hat der Senat ausgeführt, dass das Handeln der Polizei beim Deutschen Bundestag einen Eingriff in den verfassungsrechtlich geschützten Abgeordnetenstatus darstellt. Dieser Eingriff ist nicht gerechtfertigt, weil das Vorgehen jedenfalls nicht verhältnismäßig im engeren Sinne war. Im konkreten Fall waren die Anhaltspunkte für eine Gefahrenlage nur schwach ausgeprägt. Zudem war nicht ersichtlich, dass die Plakatierungen überhaupt von Passanten wahrgenommen worden oder zum Anlass von Angriffen auf das Parlamentsgebäude oder die Mitarbeiter genommen worden wären.
Sachverhalt:
Der Antragsteller gehört als Mitglied der Fraktion DIE LINKE dem Deutschen Bundestag an. Am Samstag, dem 29. September 2018, hielt sich der türkische Staatspräsident in Berlin auf. Anlässlich dieses Staatsbesuchs wurden Straßensperrungen im Regierungsviertel vorgenommen, wobei sich innerhalb des gesperrten Gebiets auch das Gebäude mit den Abgeordnetenräumen des Antragstellers befand. Im Bereich der Fenster dieser Räume, die zum abgesperrten Straßenbereich gerichtet sind, hingen auf Papier gedruckte Abbildungen von Zeichen der kurdischen Volksverteidigungseinheiten YPG in Syrien, jeweils im Format DIN A4. Beamte der Polizei beim Deutschen Bundestag stellten diese Plakatierungen anlässlich eines Kontrollgangs fest, als die Straßensperrungen im Bereich des Gebäudes bereits wieder aufgehoben waren. Der Antragsteller hielt sich zu diesem Zeitpunkt nicht in seinen Abgeordnetenräumen auf. Versuche, ihn telefonisch oder auf anderem Wege zu erreichen, unternahm die Polizei beim Deutschen Bundestag nicht. Die Beamten betraten die Abgeordnetenräume und nahmen die Plakatierungen ab. Der Antragsteller begehrt die Feststellung, dass er durch das Betreten und das Durchsuchen seiner Abgeordnetenräume in seinen verfassungsmäßigen Rechten als Abgeordneter verletzt worden sei.
Wesentliche Erwägungen des Senats:
I. Den Abgeordneten des Deutschen Bundestages steht aus Art. 38 Abs. 1 Satz 2 GG das Recht zu, die ihnen zugewiesenen Räumlichkeiten ohne Beeinträchtigungen durch Dritte nutzen zu können. Die effektive Wahrnehmung des Mandats setzt in materieller Hinsicht voraus, dass die Abgeordneten eine gewisse Infrastruktur nutzen können, ohne eine unberechtigte Wahrnehmung ihrer Arbeit durch Dritte befürchten zu müssen. Andernfalls bestünde von vornherein die latente Gefahr, dass Arbeitsentwürfe und Kommunikationsmaterial im Zuge entsprechender Maßnahmen wahrgenommen werden und nach außen dringen. Die Freiheit des Mandats erfordert es jedoch, dass der Abgeordnete über Art, Zeitpunkt und Umfang der Veröffentlichung seiner Arbeitsinhalte selbst entscheidet. Ein Eingriff in den durch Art. 38 Abs. 1 Satz 2 GG geschützten Abgeordnetenstatus ist zulässig, wenn und soweit andere Rechtsgüter von Verfassungsrang ihn rechtfertigen. Die Repräsentations- und die Funktionsfähigkeit des Parlaments sind als solche Rechtsgüter von Verfassungsrang anerkannt.
II. Die streitgegenständliche Maßnahme genügt den verfassungsrechtlichen Anforderungen an einen Eingriff in das freie Mandat des Antragstellers nicht.
1. Dabei kann offenbleiben, ob Art. 40 Abs. 2 Satz 1 GG selbst eine taugliche Ermächtigungsgrundlage für ein polizeiliches Handeln des Antragsgegners darstellt oder ob es insoweit eines formellen Gesetzes bedurft hätte. Jedenfalls genügt die streitgegenständliche Maßnahme nicht den Anforderungen von Art. 40 Abs. 2 Satz 1 GG. Selbst dann, wenn Art. 40 Abs. 2 Satz 1 GG als eine taugliche Ermächtigungsgrundlage angesehen würde, müsste das polizeiliche Handeln den Anforderungen der Dienstanweisung für den Polizeivollzugsdienst der Polizei beim Deutschen Bundestag (DA-PVD) genügen, die eine ermessenslenkende Verwaltungsvorschrift ist. Das ist hier nicht der Fall.
2. Die Zulässigkeit des Betretens von Abgeordnetenräumen bestimmt sich nach § 23 DA-PVD, der der Polizei beim Deutschen Bundestag das Betreten eines Raums zur Abwehr einer Gefahr gestattet. Zwar mögen die tatbestandlichen Voraussetzungen der Vorschrift erfüllt sein. Jedenfalls genügt die streitgegenständliche Maßnahme aber nicht den allgemeinen Anforderungen an die Verhältnismäßigkeit, die auch für ein polizeiliches Handeln des Bundestagspräsidenten gegenüber einem Abgeordneten gelten.
Hier fehlt es an der Verhältnismäßigkeit der Maßnahme im engeren Sinne. Der Eingriff wiegt schwer. Auf Seiten des Antragstellers sind dessen Statusrechte aus Art. 38 Abs. 1 Satz 2 GG betroffen, die ein hochrangiges Rechtsgut darstellen. Das freie Mandat sichert gemäß Art. 38 Abs. 1 Satz 2 GG die freie Willensbildung der Abgeordneten und damit eine von staatlicher Beeinflussung freie Kommunikationsbeziehung zwischen den Abgeordneten und den Wählerinnen und Wählern. Es dient auch dazu, die Funktionsfähigkeit des Deutschen Bundestages insgesamt zu gewährleisten. Die Absicht, die Funktionsfähigkeit des Deutschen Bundestages durch die Abwehr äußerer Gefahren zu sichern, wiegt nicht schwerer als die Sicherung der Funktionsfähigkeit durch die Gewährleistung der Integrität der Abgeordnetenbüros. Darüber hinaus waren die Anhaltspunkte für eine Gefahrenlage nur schwach ausgeprägt. Zum Zeitpunkt der Durchführung der Maßnahme war nicht ersichtlich, dass Passanten die Plakatierungen bereits wahrgenommen hatten. Die Polizei beim Deutschen Bundestag hatte keinen ersichtlichen Anhaltspunkt anzunehmen, dass jemand bereits im Begriff war, Handlungen zum Nachteil des Parlamentsgebäudes oder der Parlamentsmitarbeiter vorzunehmen. Unabhängig davon war das Provokationspotential gering, denn die Plakatierungen waren nur eingeschränkt wahrnehmbar. Sie waren in einem Format gehalten, das sich bezogen auf die Außenfassade eines Bürokomplexes als äußerst kleinformatig darstellt. Außerdem bestand eine gewisse räumliche Distanz zu den Passanten.
Grundrechtskomitee© dpa
Europa / Lager / Demokratie / Soziale Menschenrechte / Armut / Polizei / (Anti-)Rassismus / Rechtsstaatlichkeit / Menschenrechte / Repression
Pandemie versus Demokratie – oder: die Einübung in den Ausnahmezustand
In diesen virusdurchseuchten Zeiten sind wohl viele in beklemmender Sorge um Familienangehörige, Freund:innen und Kolleg:innen. Eine Infizierung mit dem Coronavirus kann lebensgefährlich, gar tödlich verlaufen. Die Mortalitätsraten der Pandemie werden uns allabendlich länderbezogen zur Kenntnis gegeben. Es nimmt sich aus, als würde in dieser Krise angsterfüllt um das nackte Überleben gekämpft, die selbst Hamsterkäufe als notwendig geboten erscheinen lässt. Ausgangsbeschränkt ist man zuhause verbannt in einem allgemeinen gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Stillstand und den politischen Verlautbarungen und der epidemiologisch-medizinischen Informationsflut nahezu hilflos ausgesetzt. Politisch wird angesichts eines unheimlichen Krankheitserregers eine Gesellschaft der Vereinzelten, ein „a-sozialer Volkskörper“ hergestellt. Gehorsam und diszipliniert wird sich den politischen und medizinischen Anweisungen des nationalen Krisenmanagements weitgehend unterworfen, da deren Angemessenheit und Verhältnismäßigkeit vom Vereinzelten nur noch schwer beurteilt werden kann. Der Blick droht sich zu verengen. Der italienische Philosoph Giorgio Agamben merkt zu diesem aktuellen Ausnahmezustand an: „Das nackte Leben – und die Angst, es zu verlieren – ist nicht etwas, was die Menschen verbindet, sondern was sie trennt und blind macht.“
In Zeiten des Notstandes verschärfen sich gesellschaftliche Ausschließung und Ausgrenzung
Deshalb erscheint es angezeigt, auf all jene Menschen aufmerksam zu machen, die in den nationalen Notstandsprogrammen kaum oder keine Berücksichtigung finden. Beginnen wir mit den Menschen, die als „Flüchtlinge“ Schutz in Deutschland suchen. Sie werden teils in Massenunterkünften verbannt und sind gezwungen unter Bedingungen zu leben, unter denen die minimalen Schutzregelungen gegen eine Infizierung mit dem Virus überhaupt nicht eingehalten werden können. Dabei wäre ihr Grundrecht auf Leben und körperliche Unversehrtheit (Art. 2.2 GG) staatlicherseits zu schützen. Das gilt umso mehr für die Elendslager an den europäischen Außengrenzen, in der die geflüchteten Menschen wie Todgeweihte eingesperrt sind. Menschenrechtlich allein angemessen wäre es, diese Lager und Massenunterkünfte endlich aufzulösen. Wer den Schutz von Menschen vor einem hochinfektiösen Erreger lediglich auf den Kreis der eigenen Staatsbürger:innen beschränkt, gibt unter der Hand bereits alle zivilisatorischen Standards auf: Der den Staat verpflichtende Schutz der Menschenwürde (Art. 1.1 GG) und der des Rechts auf Leben sind unteilbar.
Schon immer existieren weitere gewöhnlich an den Rand der gesellschaftlichen Aufmerksamkeit gedrängte Bevölkerungsgruppen. Deren staatlich zu garantierender Menschenwürdeschutz ist in diesen Zeiten der Pandemie, vorsichtig formuliert, zumindest begrenzt zu nennen. Menschen drohen aus der Solidarität der nationalen Krisengemeinschaft herauszufallen: die Inhaftierten und Abschiebehäftlinge, die Wohnungs- und Obdachlosen, die Papierlosen, die pflegebedürftigen alten Menschen, die Sexarbeiterinnen, die Drogenkonsument:innen. Allen ist gemein, dass sie unter extrem ungünstigen existenziellen Bedingungen leben müssen, die sie für eine Infektion mit dem Virus in vielfältiger Weise anfälliger machen. Ihre besondere Gefährdung sticht heraus. Darum wären für sie alle staatlicherseits Lebensverhältnisse her- und bereitzustellen, die den Schutz vor einer Infektion nachhaltig ermöglichen. Zahlreiche politische Initiativen aus der Gesellschaft bemühen sich derzeit darum und haben Vorschläge und Forderungen unterbreitet, die verwaltungsseitig leicht umgesetzt werden könnten, um die Lage der Betroffenen zu erleichtern.
Die durch die Pandemie hervorgerufene Krise trifft nicht alle gleich, sie hat eine klassenspezifische Dimension. Gesundheit, Krankheit und Tod sind eben auch eine soziale Frage. Haushalte mit geringem Einkommen, Familien unter beengten Wohnverhältnissen, prekär Beschäftigte, die mit dem sich nun abzeichnenden Einbruch der Weltwirtschaft wahrscheinlich ihren Job verlieren werden, sowie alle formal Kleinselbständigen und Kleinstunternehmungen, denen die Insolvenz droht, werden in ihrer materiellen Existenz schwer getroffen. Auch wenn nun staatliche Hilfen auf den Weg gebracht sind, die Ungleichheits- und Abhängigkeitsbedingungen dieser Bevölkerungsschichten, die die parteiübergreifend neoliberal betriebene Politik in den letzten Jahrzehnten produziert hat, werden sich in der sich abzeichnenden Wirtschaftskrise weiter vertiefen und verstetigen.
Jetzt werden Rufe lauter, lediglich die „Risikogruppen“ in der Bevölkerung, sprich, die Betagten, Kranken und Verwundbaren, unter Quarantäne zu stellen, sie zwangsweise zu isolieren – mit dem Argument, schließlich könne man nicht alle Bürger:innen in die Solidaritätspflicht nehmen und die Produktion müsse wieder hochgefahren werden, um den völligen wirtschaftlichen Zusammenbruch zu vermeiden. Damit sind die Grenzen der Solidarität im engsten nationalen Rahmen bereits angezeigt. So nähern wir uns gesellschaftlichen Bedingungen extremer Stigmatisierung und Exklusion. Wege in eine „posthumane Zivilisation“ (Milo Rau) wären vorgezeichnet, in der moralische und menschenrechtliche Standards infrage gestellt sind. Allein, dass aktuell Kriterien entworfen werden, nach denen Patient:innen notfalls triagiert werden, eröffnet Denkräume, in denen von der Gleichheit allen menschlichen Lebens Abschied genommen wird. Und schon heute geraten in Sorge um die eigenen schmalen Privilegien und das nackte Überleben die katstrophischen Auswirkungen der Pandemiekrise für die Menschen in den Ländern jenseits bundesdeutscher Grenzen im „Globalen Süden“ fast gänzlich aus dem Blick.
Der Maßnahmenstaat und die rechtsstaatliche Demokratie
In Krisenzeiten schlug schon immer die „Stunde der Exekutive“, wie auch in dieser besonderen, weltumspannenden Gesundheitskrise und in der mit dieser einhergehenden wirtschaftlichen Depression. Gewöhnlich legitimiert sich die staatliche Existenz durch das Versprechen von Sicherheit für die eigenen Staatsbürger:innen. Die Coronaepidemie stellt ohne Zweifel eine Gefahr für die Bevölkerung dar, vor der der Staat zu schützen in Anspruch nimmt (Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit, Art. 2.2 GG). Auf der Grundlage des Infektionsschutzgesetzes (IfSG – Gefahrenabwehr) und aufgrund seiner aktuellen Änderungen infolge des „Gesetzes zum Schutz der Bevölkerung bei einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite“ haben deshalb Bund, Länder und Kommunen sowie zuständige Gesundheitsbehörden Maßnahmen erlassen (Kontaktverbote, Ausgangsbeschränkungen, Grenzschließungen etc.), die tief in die Grundrechte der Bürger:innen eingreifen. Der Notstand wurde offiziell nicht ausgerufen, gleichwohl leben wir im Ausnahmezustand. Lediglich aufgrund des im parlamentarischen Schnelldurchgang novellierten Infektionsschutzgesetzes wird der Staatsapparat zu weitgehenden Grundrechtseinschränkungen ermächtigt: u.a. der Freiheit der Person (Art. 2.2), der Versammlungsfreiheit (Art. 8.1), der Vereinigungsfreiheit (Art.9.1), der Freizügigkeit (Art. 11.1) und der Unverletzlichkeit der Wohnung (Art. 13.1). Vor allem außerhalb der fast oppositionslosen Parlamente wird breit darüber diskutiert, ob die Ermächtigungsgrundlage für die weitgehenden Grundrechtseinschränkungen, bloße Rechtsverordnungen, ausreichend sei und ob die in der Bevölkerung weitgehend akzeptierten Maßnahmen der Freiheitsbeschränkungen noch verhältnismäßig zum Zweck der Bekämpfung der Epidemie seien. Es wäre wohl anmaßend, dies schlichtweg zu verneinen. Zu diesem Zeitpunkt, Anfang April 2020, scheint sich die Verbreitung des Virus tatsächlich zu verlangsamen. Die Belastung des neoliberal auf Kosteneffizienz und Rentabilität getrimmten Gesundheitssystems wird entsprechend den Ratschlägen der Fachwissenschaften über eine gewisse Zeit gestreckt, damit es nicht unter einer zu raschen Ausbreitung des Virus und den damit einhergehenden intensivmedizinischen Notfällen zusammenbricht, wie es in anderen europäischen Ländern geschehen ist. Das ist der eigentliche Zweck der Maßnahmen, die momentan zu greifen scheinen. Noch Anfang des Jahres hieß es von deutschen „Gesundheitspolitikern“, dass auf Grundlage einer Studie der Bertelsmann Stiftung hunderte Krankenhäuser geschlossen gehörten (sic). Offene Fragen bleiben, ob die Bundesregierung zu spät auf die sich anbahnende Pandemie reagiert hat und warum sie trotz ausgewiesener Pandemie-Notfallpläne nicht ausreichend vorbereitet war – beispielsweise durch eine Bevorratung medizinisch notwendiger Ausrüstung. Es zeigt sich, dass die Bundesregierung jedenfalls diesen gesundheitspolitischen Notstand sehenden Auges mit produziert hat.
In dieser Krise wird die politische Machtordnung der Gesellschaft massiv verschoben. Außerparlamentarische Proteste, die ein Korrektiv sein könnten, sind dagegen nahezu verunmöglicht. Dazu trägt auch die Konformität in der Gesellschaft selbst bei, die die Notstandsmaßnahmen allergrößten Teils befürwortet. Noch da, wo kleine Proteste unter Beachtung der vorgeschriebenen hygienischen Anordnungen (Abstand, Mundschutz) stattfinden, werden dieselben aufgelöst und einzelne Teilnehmende mit Bußgeldern sanktioniert. Mit solchen Maßnahmen wird nicht die Bevölkerung geschützt, sondern allein die untertänige Befolgung der Anordnungen durchgesetzt. Dafür spricht auch ein Übermaß an bundesweiten Kontrollen. Das gleicht mehr einer gesellschaftlichen Einübung in den Gehorsam, sprich, einer Einübung in den Ausnahmezustand. Daher ist es aus demokratischer Perspektive unerlässlich, dass Mittel (Maßnahmen) und Zweck (Schutz der Bevölkerung vor der Coronaepidemie mittels Aufrechterhaltung des Gesundheitssystems) dauernd auf Verhältnismäßigkeit und Angemessenheit überprüft werden, wie es beispielsweise das „Tagebuch der Inneren Sicherheit“ angesichts der Corona-Epidemie unternimmt, das seitens des Instituts für Bürgerrechte und öffentliche Sicherheit (CiLiP) als Blog eingerichtet wurde. Der Staat gewährt nicht Freiheitsrechte, sondern hat ihren Schutz zu gewährleisten, darum hat er Einschränkungen penibel zu rechtfertigen. Der Staat ist insofern rechtfertigungspflichtig, nicht die Bürgerinnen und Bürger, nehmen sie ihre Freiheit in Anspruch.
Es ist noch nicht abzusehen, wie lange der Ausnahmezustand anhalten wird. Schon aus demokratischer Perspektive müssen die Maßnahmen zeitlich begrenzt, verfassungsrechtlich überprüft und spätestens in Post-Corona-Zeiten vollständig zurückgenommen werden. Darauf wird argusäugig zu achten sein. Rechtsnormen werden in innergesellschaftlichen Krisen dauernd den herrschenden Verhältnissen angepasst – siehe etwa die bundesdeutsche Anti-Terrorgesetzgebung nach dem 11. September 2001 mit weitgehenden präventiven Befugnissen und Ermächtigungen des Sicherheitsapparats. Insofern ist der Ausnahmezustand immer schon Teil des Normalzustands. Uwe Volkmann, Professor für Rechtsphilosophie und öffentliches Recht, warnt in der aktuellen Situation zu Recht: „Man bekommt […] eine Ahnung davon, was auch in demokratischen Rechtsstaaten binnen kurzer Zeit alles möglich ist, wenn einmal die falschen Leute die Hebel der Macht – oder sagen wir es, wie es ist: die des Rechts – in die Hand bekommen.“
Solidarität jenseits von Gemeinsamkeiten – außer denen des Menschseins
Aktuell sprießen die Post-Corona-Träume in den Himmel. Eine sozial-ökologische Transformation der Gesellschaft stehe an. Eine soziale Infrastruktur (Gesundheit, Bildung, Wohnen und andere Gemeingüter) könne aufgebaut werden, die nicht mehr nach Renditeprinzipien, sondern nach den Bedürfnissen aller gemeinwohlorientiert entwickelt werden könnte. Wir sollten uns keinen Illusionen hingeben. Die national beschränkte Wohlfühlsolidarität der Gegenwart wird in der aufkommenden Wirtschaftskrise rasch von der Angst vor wirtschaftlichem Abstieg und existenzieller Not aufgebraucht sein. Angst ist der Motor des Kapitalismus und des nationalistischen, neofaschistischen Populismus. Das konkurrenztolle Rattenrennen wird erneut einsetzen, in das uns ein digital reorganisierter Kapitalismus zwingen wird. Denn wir werden weiterhin in einem kapitalistischen Staat leben, so Wilhelm Heitmeyer, der als Soziologe das Konzept und den Begriff der „Gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit“ entwickelt hat, und das bedeute, „dass der Finanzmarktkapitalismus kein besonderes Interesse an gesellschaftlicher Integration hat, sondern da geht es um die Kriterien von Nützlichkeit, Verwertbarkeit, Effizienz, …“ Man müsse aufpassen, so Heitmeyer weiter, dass die Kriterien nicht auf Menschen und Menschengruppen angewandt würden. Die autoritäre Versuchung besteht fort und die alten, neu eingekleideten Ideologien treffen auf fruchtbaren Boden. Selbstverständlich müssen wir dringend über die Post-Corona-Zeiten nachdenken und diskutieren. Wir sollten aber wissen, um tatsächlich eine andere gesellschaftliche Ordnung herstellen zu können, müssen wir nicht nur die Straßen erneut bevölkern, sondern die Herzen und Köpfe der Menschen gewinnen – mit einer an den Menschenrechten ausgerichteten Solidarität, die nur internationalistisch/universalistisch sein kann. Das wird wohl nicht leicht.
Autor: Dirk Vogelskamp
-------------------------------------------------------
" Wundert euch nicht, wenn Richter statistisch gesehen eher für das Kapital und gegen die kleinen Leute entscheiden. Denn: Richter verdienen viel Geld. Und das kommt ja auch irgendwo her...."
Gottesdienstverbot bedarf als überaus schwerwiegender Eingriff in die Glaubensfreiheit einer fortlaufenden strengen Prüfung seiner Verhältnismäßigkeit anhand der jeweils aktuellen Erkenntnisse
Pressemitteilung Nr. 243/2020 vom 10. April 2020
Beschluss vom 10. April 2020
1 BvQ
28/20
Die 2. Kammer des Ersten Senats des Bundesverfassungsgerichts hat mit heutigem Beschluss einen Antrag auf vorläufige Außervollzugsetzung einer Regelung der Verordnung zur Bekämpfung des Corona-Virus der hessischen Landesregierung (im Folgenden: Corona-Verordnung), die unter anderem ein Verbot von Zusammenkünften in Kirchen enthält, auf der Grundlage einer Folgenabwägung abgelehnt.
Der Antragsteller ist katholischen Glaubens und besucht regelmäßig die Heilige Messe. Er hat unter Bezugnahme auf Aussagen des II. Vatikanischen Konzils (Dogmatische Konstitution über die Kirche, Nr. 11) und des Katechismus der Katholischen Kirche (Nr. 1324 bis 1327) nachvollziehbar dargelegt, dass die gemeinsame Feier der Eucharistie nach katholischer Überzeugung ein zentraler Bestandteil des Glaubens ist, deren Fehlen nicht durch - nach wie vor zulässige - alternative Formen der Glaubensbetätigung wie die Übertragung von Gottesdiensten im Internet oder das individuelle Gebet kompensiert werden kann. Vor diesem Hintergrund hat die Kammer das Verbot von Zusammenkünften in Kirchen nach der Corona-Verordnung des Landes Hessen als überaus schwerwiegenden Eingriff in die Glaubensfreiheit gewertet. Das gilt nach den plausiblen Angaben des Antragstellers verstärkt, soweit sich das Verbot auch auf Eucharistiefeiern während der Osterfeiertage als dem Höhepunkt des religiösen Lebens der Christen erstreckt. Damit sind die Nachteile für den Fall, dass die begehrte einstweilige Anordnung nicht ergeht, eine Verfassungsbeschwerde aber Erfolg hätte, überaus schwerwiegend und nach dem Glaubensverständnis des Antragstellers auch irreversibel.
Bei einer antragsgemäßen vorläufigen Außervollzugsetzung des Verbots von Zusammenkünften in Kirchen versammelten sich demgegenüber voraussichtlich sehr viele Menschen in Kirchen, gerade auch über die Osterfeiertage. Damit würde sich die Gefahr der Ansteckung mit dem Virus, der Erkrankung vieler Personen, der Überlastung der gesundheitlichen Einrichtung bei der Behandlung schwerwiegender Fälle und schlimmstenfalls des Todes von Menschen nach der maßgeblichen Risikoeinschätzung des Robert-Koch-Instituts vom 26. März 2020 erheblich erhöhen, obwohl dies im Falle der Erfolglosigkeit einer Verfassungsbeschwerde durch ein Gottesdienstverbot in verfasssungsrechtlich zulässiger Weise hätte vermieden werden können. Diese Gefahren blieben dann auch nicht auf jene Personen beschränkt, die freiwillig an den Gottesdiensten teilgenommen haben, sondern erstreckten sich auf einen erheblich größeren Personenkreis.
Nach Auffassung der Kammer hat der Schutz vor diesen Gefahren für Leib und Leben derzeit trotz des damit verbundenen überaus schwerwiegenden Eingriffs in die Glaubensfreiheit Vorrang vor dem Schutz dieses Grundrechts. Nach der Bewertung des Robert-Koch-Instituts kommt es in dieser frühen Phase der Corona-Pandemie darauf an, die Ausbreitung der hoch infektiösen Viruserkrankung durch eine möglichst weitgehende Verhinderung von Kontakten zu verlangsamen, um ein Kollabieren des staatlichen Gesundheitssystems mit zahlreichen Todesfällen zu vermeiden. Die Kammer stellt klar, dass für die Folgenabwägung auch die Befristung der Corona-Verordnung bis zum 19. April 2020 von Bedeutung ist. Damit ist sichergestellt, dass die Verordnung unter Berücksichtigung neuer Entwicklungen der Corona-Pandemie fortgeschrieben werden muss. Bei jeder Fortschreibung der Verordnung muss mit Blick auf den mit einem Gottesdienstverbot verbundenen überaus schwerwiegenden Eingriff in die Glaubensfreiheit eine strenge Prüfung der Verhältnismäßigkeit erfolgen und untersucht werden, ob es angesichts neuer Erkenntnisse etwa zu den Verbreitungswegen des Corona-Virus oder zur Gefahr einer Überlastung des Gesundheitssystems verantwortet werden kann, das Verbot von Gottesdiensten unter - gegebenenfalls strengen - Auflagen und möglicherweise auch regional begrenzt zu lockern.
Die Kammer weist abschließend darauf hin, dass Gleiches auch für andere Religionsgemeinschaften gilt, die durch das Verbot von Zusammenkünften vergleichbar schwerwiegend betroffen sind, weil für sie die gemeinsame Zusammenkunft ihrer Gläubigen ebenfalls zentraler Bestandteil ihres Glaubens ist.
-------------------------------------------------------
Gericht Greifswald kippt Osterreiseverbot der Landesregierung
- Aktualisiert am 09.04.2020-17:33
Das Oberverwaltungsgericht Greifswald hat am Donnerstag überraschend in zwei Eilverfahren das von der Landesregierung verfügte Reiseverbot rückgängig gemacht. Es bezieht sich auf die Einwohner Mecklenburg-Vorpommerns.
Permalink: https://www.faz.net/-gpg-9ycvw
Einwohner Mecklenburg-Vorpommerns dürfen zu Ostern nun doch Tagesausflüge zu den Ostseeinseln, zur Küste und in die Mecklenburgische Seenplatte machen. Das Oberverwaltungsgericht Greifswald hat am Donnerstag überraschend in zwei Eilverfahren das von der Landesregierung verfügte Reiseverbot für die heimische Bevölkerung rückgängig gemacht. Die Entscheidung sei unanfechtbar, sagte ein Gerichtssprecher.
Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) appellierte an die Bürger des Landes, in den nächsten Tagen trotzdem keine Ausflüge zu den touristischen Hotspots Mecklenburg-Vorpommerns zu unternehmen. Sie hoffe, dass die Bürger an den Feiertagen möglichst in ihrem Wohnumfeld bleiben, um die bisherigen Erfolge bei der Eindämmung des Coronavirus nicht zu gefährden.
Wie das Gericht am Abend mitteilte, wurde der umstrittene Paragraf 4a der Verordnung über Maßnahmen zur Bekämpfung der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus Sars-CoV-2 bis zu einer Entscheidung in der Hauptsache außer Vollzug gesetzt. Dieser Paragraf in der Verordnung war erst am Mittwoch neu gefasst worden, um die verbotenen Reiseziele zu präzisieren.
Demnach waren von Karfreitag bis Ostermontag für Einwohner Mecklenburg-Vorpommerns Ausflüge zu den Ostseeinseln, zur Halbinsel Fischland-Darß-Zingst, in Gemeinden direkt an der Ostsee und Boddengewässern sowie zu Tourismuszentren in der Mecklenburgischen Seenplatte verboten worden. Damit wollte die Regierung die Umsetzung der Kontaktbeschränkungen insbesondere über die Feiertage erzwingen.
Eilverfahren Gericht Greifswald kippt Osterreiseverbot der Landesregierung
- Aktualisiert am
Das Oberverwaltungsgericht Greifswald hat am Donnerstag überraschend in zwei Eilverfahren das von der Landesregierung verfügte Reiseverbot rückgängig gemacht. Es bezieht sich auf die Einwohner Mecklenburg-Vorpommerns.
Einwohner Mecklenburg-Vorpommerns dürfen zu Ostern nun doch Tagesausflüge zu den Ostseeinseln, zur Küste und in die Mecklenburgische Seenplatte machen. Das Oberverwaltungsgericht Greifswald hat am Donnerstag überraschend in zwei Eilverfahren das von der Landesregierung verfügte Reiseverbot für die heimische Bevölkerung rückgängig gemacht. Die Entscheidung sei unanfechtbar, sagte ein Gerichtssprecher.
Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) appellierte an die Bürger des Landes, in den nächsten Tagen trotzdem keine Ausflüge zu den touristischen Hotspots Mecklenburg-Vorpommerns zu unternehmen. Sie hoffe, dass die Bürger an den Feiertagen möglichst in ihrem Wohnumfeld bleiben, um die bisherigen Erfolge bei der Eindämmung des Coronavirus nicht zu gefährden.
Wie das Gericht am Abend mitteilte, wurde der umstrittene Paragraf 4a der Verordnung über Maßnahmen zur Bekämpfung der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus Sars-CoV-2 bis zu einer Entscheidung in der Hauptsache außer Vollzug gesetzt. Dieser Paragraf in der Verordnung war erst am Mittwoch neu gefasst worden, um die verbotenen Reiseziele zu präzisieren.
Demnach waren von Karfreitag bis Ostermontag für Einwohner Mecklenburg-Vorpommerns Ausflüge zu den Ostseeinseln, zur Halbinsel Fischland-Darß-Zingst, in Gemeinden direkt an der Ostsee und Boddengewässern sowie zu Tourismuszentren in der Mecklenburgischen Seenplatte verboten worden. Damit wollte die Regierung die Umsetzung der Kontaktbeschränkungen insbesondere über die Feiertage erzwingen.
-----------------------------------------------------
v.Wolfgang J.
Reus
(1959 - 2006), deutscher Journalist, Satiriker, Aphoristiker und Lyriker
"Wenn Du Menschen beurteilst, so frage nicht, nach den Wirkungen, sondern nach den Ursachen der Fehler, die sie machen"
von Walther Rathenow(1867-1922) deutscher demokratischer Politiker
„ Die einen wissen, dass sie viel wissen und schweigen. Und die anderen wissen nicht, dass sie nicht viel wissen. Und reden. Und richten.“
Autor unbekannt
Liebe Besucherinnen, Liebe Besucher diese Seite,
mit Datum des 20. April 2016 werde ich den Services und die Informationübermittlung meiner Homepage mit dieser neuen Seite erweitern. Ich möchte einfach somit, dem Bedürfnis der Leser entsprechen, die sich auch über die aktuelle Rechtssprechung informieren möchten. Natürlich kann ich hier nicht die Erwartung erfüllen, über sämtliche täglich gefassten Urteilen auf bundesweitem Gebiet bishin zu Europarecht zu informieren. Es werden hier Urteile erscheinen, die mir entsprechend meinen Informationsquellen bekannt gemacht werden. Dabei spielt es keine Rolle, inwieweit ich persönlich das Urteil bewerte, es geht hier nur über den Inhalt der Rechtssprechung an sich.
Carsten Hanke
------------------------------------------------------
Erfolgreiche Verfassungsbeschwerde gegen Ungleichbehandlung eingetragener Lebenspartnerschaften bei der Zusatzversorgung im öffentlichen Dienst
Pressemitteilung Nr. 91/2019 vom 20. Dezember 2019
Beschluss vom 11. Dezember 2019
1 BvR
3087/14
Die 3. Kammer des Ersten Senats hat mit heute veröffentlichtem Beschluss der Verfassungsbeschwerde eines ehemaligen Beschäftigten des öffentlichen Dienstes stattgegeben, der in eingetragener Lebenspartnerschaft lebt, für den aber eine Zusatzrente der Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder (VBL) wie für ledige Versicherte berechnet worden war. Zwar waren die Fachgerichte zutreffend davon ausgegangen, dass verpartnerte Versicherte bei der Berechnung der Zusatzrente so zu behandeln sind wie Verheiratete. Doch durfte dies nicht von einem Antrag abhängig gemacht werden, da verpartnerte Versicherte damals nicht erkennen konnten, dass sie diesen Antrag hätten stellen müssen. Weder bezog sich die Antragsregel auf sie noch hielt die damals herrschende Auffassung in Rechtsprechung und Fachliteratur eine Gleichstellung für geboten. Die formal gleiche Anforderung, einen Antrag auf eine günstigere Berechnung der Zusatzrente zu stellen, führt in diesem Fall zu einer ungerechtfertigten Ungleichbehandlung. Sie ist rückwirkend zu beseitigen.
Sachverhalt:
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des öffentlichen Dienstes erhalten nach Renteneintritt regelmäßig eine Zusatzversorgung über die VBL. Diese wurde bei Eheleuten nach deren günstigeren Steuerklasse berechnet, wenn sie nach § 56 Abs. 1 Satz 4 der Satzung der VBL in der damals geltenden Fassung (VBLS a. F.) einen entsprechenden Antrag stellten. Der Beschwerdeführer bezieht seit 1998 eine solche Zusatzrente, der die für Unverheiratete geltende Steuerklasse I/0 zugrunde gelegt worden war. Er begründete im Jahr 2001 eine eingetragene Lebenspartnerschaft, worüber er die VBL im Oktober 2006 unterrichtete, und beantragte 2011 eine Neuberechnung seiner Rente ab dem Zeitpunkt der Verpartnerung wie für Eheleute. Die VBL leistete daraufhin eine Nachzahlung nur für den Zeitraum ab der Mitteilung über die Verpartnerung, da für die Zeit zuvor ein Antrag fehle. Die Klage auf eine höhere Zusatzrente für die Zeit davor blieb in allen Instanzen ohne Erfolg.
Wesentliche Erwägungen der Kammer:
Die angegriffenen Urteile verletzen den Beschwerdeführer in seinem Grundrecht aus Art. 3 Abs. 1 GG, soweit sie für die Zeit vor November 2006 einen Anspruch auf Neuberechnung der Rente unter Verweis auf den fehlenden Antrag verneinen.
1. Art. 3 Abs. 1 GG gebietet die allgemeine Gleichbehandlung. Dabei verschärfen sich die Anforderungen an die Rechtfertigung einer Ungleichbehandlung umso mehr, je weniger die Merkmale, an die sie anknüpft, für die Betroffenen verfügbar sind und je mehr sich diese Merkmale den in dem besonderen Gleichbehandlungsgebot des Art. 3 Abs. 3 GG ausdrücklich benannten Merkmalen annähern. Das ist bei der Ungleichbehandlung von Menschen in einer Ehe und in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft der Fall, denn sie knüpft an das personenbezogene Merkmal der sexuellen Orientierung an. Daher gilt für die Prüfung, ob eine Ungleichbehandlung zwischen verheirateten und verpartnerten Personen zu rechtfertigen ist, ein strenger Maßstab.
2. Wenden die Gerichte die Regelung des § 56 Abs. 1 Satz 4 VBLS a. F., wonach nur auf Antrag für die Zusatzrente die für Ehepaare geltende günstigere Steuerklasse zugrunde gelegt wird, uneingeschränkt auf verpartnerte Versicherte an, benachteiligt das den Beschwerdeführer in nicht gerechtfertigter Weise. Die Gerichte haben hier verkannt, dass die formal gleiche Anwendung einer Bestimmung auf Lebenssachverhalte, die in diskriminierender Weise ungleich geregelt waren, eine Diskriminierung fortschreiben kann.
a) Die formale Gleichbehandlung hinsichtlich des erforderlichen Antrags auf Neuberechnung der Zusatzrente bewirkt hier eine verfassungsrechtlich nicht gerechtfertigte Ungleichbehandlung. Zwar scheint es formal gleich, sowohl verheiratete als auch verpartnerte Anspruchsberechtigte an einen Antrag zu binden. Tatsächlich war die Situation der Betroffenen jedoch in dem hier streitigen Zeitraum in einer Weise unterschiedlich, dass die formale Gleichbehandlung tatsächlich eine Ungleichbehandlung in der Sache bewirkt. Im Unterschied zu Eheleuten konnten verpartnerte Versicherte nach damals geltendem Recht nicht erkennen, dass sie ebenso wie Eheleute einen Antrag hätten stellen müssen. Die Regelung zum Antragserfordernis galt für sie schon nach dem Wortlaut nicht, denn eine Rentenberechnung auf Grundlage der günstigeren Steuerklasse war nur für Verheiratete vorgesehen. Zudem waren Rechtsprechung und Fachliteratur damals mehrheitlich der Auffassung, eine Gleichstellung zugunsten des Beschwerdeführers mit der Ehe sei nicht geboten. Geändert hat sich dies erst mit dem Beschluss des Ersten Senats des Bundesverfassungsgerichts vom 7. Juli 2009 (BVerfGE 124, 199). Erst dann war für verpartnerte Versicherte erkennbar, dass eine Regelung, die sich auf Eheleute bezog, auch auf sie Anwendung finden würde, und auch sie einen Antrag stellen müssen, um die daran gebundenen positiven Wirkungen zu erreichen.
b) Der VBL ist hier nicht vorzuwerfen, sie habe sich treuwidrig verhalten oder es pflichtwidrig unterlassen, verpartnerte Versicherte über die Möglichkeit einer Antragstellung umfassend informiert zu haben. Sie durfte ebenso wie der Beschwerdeführer damals davon ausgehen, dass verpartnerte Versicherte keine Zusatzrenten erhalten würden. Das bedeutet jedoch nicht, dass ein aus der damaligen Ungleichbehandlung zwischen Ehe und Lebenspartnerschaft entstandener Nachteil für die Betroffenen fortgeschrieben werden dürfte. Wird ein Verstoß gegen das Gleichbehandlungsgebot festgestellt, folgt daraus vielmehr grundsätzlich die Verpflichtung, die Rechtslage rückwirkend verfassungsgemäß zu gestalten. Eine auf den Zeitpunkt der Einführung des Instituts der eingetragenen Lebenspartnerschaft zurückwirkende Gleichbehandlung verpartnerter und verheirateter Personen lässt sich nur erreichen, indem auf einen entsprechenden kurz danach gestellten Antrag hin die Rente auch rückwirkend angepasst wird. Daher kann der Beschwerdeführer hier verlangen, dass seine Versorgungsrente unter Zugrundelegung der Lohnsteuerklasse III/0 rückwirkend auf den Zeitpunkt der Begründung seiner eingetragenen Lebenspartnerschaft neu berechnet wird.
Grundsatzentscheidung: Tempokontrollen durch Firma unzulässig
Aktualisiert am 13. November 2019, 11:54 Uhr
Dürfen Geschwindigkeiten auch von Privatfirmen gemessen werden? Ein geblitzter Autofahrer hatte dagegen geklagt. Schon in erster Instanz hatte er recht bekommen. Nun hat das Oberlandesgericht Frankfurt am Main am Dienstag eine Grundsatzentscheidung getroffen.
Städte und Gemeinden dürfen Geschwindigkeitsmessungen im Straßenverkehr einem Gerichtsbeschluss zufolge nicht Firmen übertragen. Die Verkehrsüberwachung durch private Dienstleister sei gesetzeswidrig, erklärte das Oberlandesgericht (OLG) Frankfurt am Main am Dienstag in einer Grundsatzentscheidung.
Auf einer solchen Grundlage dürften keine Bußgeldbescheide erlassen werden. Der Beschluss ist noch nicht rechtskräftig. Als nächstes will sich das Gericht mit dem Einsatz von privater Verkehrsüberwachung bei Falschparkern beschäftigen. (Aktenzeichen 2 Ss-OWi 942/19)
Gericht in erster Instanz: Verkehrsüberwachung ist hoheitliche Aufgabe
Bei der aktuellen Entscheidung ging es um einen Fall aus dem Main-Kinzig-Kreis in Hessen. Dort hatte die Gemeinde Freigericht den Angestellten einer privaten GmbH per Leiharbeit mit der "Unterstützung bei der Durchführung von Geschwindigkeitsprotokollen, allgemeinen Datenverarbeitung und Erstellung von Messberichten" beauftragt.
Dies sei in Abstimmung mit den Aufsichtsbehörden geschehen, betonte die Kommune.
Doch ein Anfang 2018 geblitzter Autofahrer wehrte sich und bekam in erster Instanz Recht. Das Amtsgericht Gelnhausen sprach ihn frei. Verkehrsüberwachung sei eine hoheitliche, also dem Staat vorbehaltene Aufgabe. Die Staatsanwaltschaft Hanau wollte die Sache grundsätzlich klären und legte Rechtsbeschwerde ein.
OLG-Sprecherin: Auch Zulässigkeit von privaten Dienstleistern im ruhenden Verkehr überprüfen
Nach Einschätzung des Hessischen Städte- und Gemeindebundes wissen viele Kommunen mittlerweile, dass sie Geschwindigkeitsmessungen nicht extern vergeben dürfen.
"Es ist allgemein bekannt, dass die Auswertung ein hoheitlicher Akt ist", sagt Direktor Karl-Christian Schelzke. Dass es immer noch Prozesse deswegen gebe, verwundere ihn.
Der OLG-Beschluss wird nicht die letzte Entscheidung zum Thema bleiben: "Das Oberlandesgericht wird sich voraussichtlich in den nächsten Monaten auch mit der Frage der Zulässigkeit von Verkehrsüberwachung im ruhenden Verkehr durch private Dienstleister durch die Stadt Frankfurt am Main befassen", sagte eine OLG-Sprecherin. (dpa/dh)
--------------------------------------------------------
Sanktionen zur Durchsetzung von Mitwirkungspflichten bei Bezug von Arbeitslosengeld II teilweise verfassungswidrig
Pressemitteilung Nr. 74/2019 vom 5. November 2019
Urteil vom 05. November 2019
1 BvL
7/16
Der Gesetzgeber kann die Inanspruchnahme existenzsichernder Leistungen an den Nachranggrundsatz binden, solche Leistungen also nur dann gewähren, wenn Menschen ihre Existenz nicht selbst sichern können. Er kann erwerbsfähigen Bezieherinnen und Beziehern von Arbeitslosengeld II auch zumutbare Mitwirkungspflichten zur Überwindung der eigenen Bedürftigkeit auferlegen, und darf die Verletzung solcher Pflichten sanktionieren, indem er vorübergehend staatliche Leistungen entzieht. Aufgrund der dadurch entstehenden außerordentlichen Belastung gelten hierfür allerdings strenge Anforderungen der Verhältnismäßigkeit; der sonst weite Einschätzungsspielraum des Gesetzgebers ist hier beschränkt. Je länger die Regelungen in Kraft sind und der Gesetzgeber damit deren Wirkungen fundiert einschätzen kann, desto weniger darf er sich allein auf Annahmen stützen. Auch muss es den Betroffenen möglich sein, in zumutbarer Weise die Voraussetzungen dafür zu schaffen, die Leistung nach einer Minderung wieder zu erhalten.
Mit dieser Begründung hat der Erste Senat des Bundesverfassungsgerichts mit heute verkündetem Urteil zwar die Höhe einer Leistungsminderung von 30 % des maßgebenden Regelbedarfs bei Verletzung bestimmter Mitwirkungspflichten nicht beanstandet. Allerdings hat er auf Grundlage der derzeitigen Erkenntnisse die Sanktionen für mit dem Grundgesetz unvereinbar erklärt, soweit die Minderung nach wiederholten Pflichtverletzungen innerhalb eines Jahres die Höhe von 30 % des maßgebenden Regelbedarfs übersteigt oder gar zu einem vollständigen Wegfall der Leistungen führt. Mit dem Grundgesetz unvereinbar sind die Sanktionen zudem, soweit der Regelbedarf bei einer Pflichtverletzung auch im Fall außergewöhnlicher Härten zwingend zu mindern ist und soweit für alle Leistungsminderungen eine starre Dauer von drei Monaten vorgegeben wird. Der Senat hat die Vorschriften mit entsprechenden Maßgaben bis zu einer Neuregelung für weiter anwendbar erklärt.
Sachverhalt:
1. Nach § 31 Abs. 1 SGB II verletzen erwerbsfähige Empfänger von Arbeitslosengeld II, die keinen wichtigen Grund für ihr Verhalten darlegen und nachweisen, ihre Pflichten, wenn sie sich trotz Rechtsfolgenbelehrung nicht an die Eingliederungsvereinbarung halten, wenn sie sich weigern, eine zumutbare Arbeit, Ausbildung, Arbeitsgelegenheit oder ein gefördertes Arbeitsverhältnis aufzunehmen, fortzuführen oder deren Anbahnung durch ihr Verhalten verhindern oder wenn sie eine zumutbare Maßnahme zur Eingliederung in Arbeit nicht antreten, abbrechen oder Anlass für den Abbruch gegeben haben. Rechtsfolge dieser Pflichtverletzungen ist nach § 31a SGB II die Minderung des Arbeitslosengeldes II in einer ersten Stufe um 30 % des für die erwerbsfähige leistungsberechtigte Person maßgebenden Regelbedarfs. Bei der zweiten Pflichtverletzung mindert sich der Regelbedarf um 60 %. Bei jeder weiteren wiederholten Pflichtverletzung entfällt das Arbeitslosengeld II vollständig. Die Dauer der Minderung beträgt nach § 31b SGB II drei Monate.
2. Das zuständige Jobcenter verhängte gegen den Kläger des Ausgangsverfahrens zunächst eine Sanktion der Minderung des maßgeblichen Regelbedarfes in Höhe von 30 %, nachdem dieser als ausgebildeter Lagerist gegenüber einem ihm durch das Jobcenter vermittelten Arbeitgeber geäußert hatte, kein Interesse an der angebotenen Tätigkeit im Lager zu haben, sondern sich für den Verkaufsbereich bewerben zu wollen. Nachdem der Kläger einen Aktivierungs- und Vermittlungsgutschein für eine praktische Erprobung im Verkaufsbereich nicht eingelöst hatte, minderte das Jobcenter den Regelbedarf um 60 %. Nach erfolglosem Widerspruch erhob er Klage vor dem Sozialgericht. Dieses setzte das Verfahren aus und legte im Wege der konkreten Normenkontrolle dem Bundesverfassungsgericht die Frage vor, ob die Regelungen in § 31a in Verbindung mit § 31 und § 31b SGB II mit dem Grundgesetz vereinbar seien.
Wesentliche Erwägungen des Senats:
I. Die zentralen Anforderungen für die Ausgestaltung der Grundsicherungsleistungen ergeben sich aus der grundrechtlichen Gewährleistung eines menschenwürdigen Existenzminimums aus Art. 1 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 20 Abs. 1 GG. Der Gesetzgeber verfügt bei den Regeln zur Sicherung des menschenwürdigen Existenzminimums über einen Gestaltungsspielraum.
Die eigenständige Existenzsicherung des Menschen ist nicht Bedingung dafür, dass ihm Menschenwürde zukommt; die Voraussetzungen für ein eigenverantwortliches Leben zu schaffen, ist vielmehr Teil des Schutzauftrags des Staates aus Art. 1 Abs. 1 Satz 2 GG. Das Grundgesetz verwehrt dem Gesetzgeber jedoch nicht, die Inanspruchnahme sozialer Leistungen zur Sicherung der menschenwürdigen Existenz an den Nachranggrundsatz zu binden, solche Leistungen also nur dann zu gewähren, wenn Menschen ihre Existenz nicht selbst sichern können. Damit gestaltet der Gesetzgeber das Sozialstaatsprinzip des Art. 20 Abs. 1 GG aus.
Der Nachranggrundsatz kann nicht nur eine Pflicht zum vorrangigen Einsatz aktuell verfügbarer Mittel aus Einkommen, Vermögen oder Zuwendungen Dritter enthalten. Das Grundgesetz steht auch der gesetzgeberischen Entscheidung nicht entgegen, von denjenigen, die staatliche Leistungen der sozialen Sicherung in Anspruch nehmen, zu verlangen, an der Überwindung ihrer Hilfebedürftigkeit selbst aktiv mitzuwirken oder die Bedürftigkeit gar nicht erst eintreten zu lassen. Solche Mitwirkungspflichten beschränken allerdings die Handlungsfreiheit der Betroffenen und müssen sich daher verfassungsrechtlich rechtfertigen lassen. Verfolgt der Gesetzgeber mit Mitwirkungspflichten das legitime Ziel, dass Menschen die eigene Hilfebedürftigkeit insbesondere durch Erwerbsarbeit vermeiden oder überwinden, müssen sie dafür auch geeignet, erforderlich und zumutbar sein.
Der Gesetzgeber darf verhältnismäßige Mitwirkungspflichten auch durchsetzbar ausgestalten. Er kann für den Fall, dass Menschen eine ihnen klar bekannte und zumutbare Mitwirkungspflicht ohne wichtigen Grund nicht erfüllen, belastende Sanktionen vorsehen, um so ihre Pflicht zur Mitwirkung an der Überwindung der eigenen Hilfebedürftigkeit durchzusetzen. Solche Regelungen berücksichtigen die Eigenverantwortung, da die Betroffenen die Folgen zu tragen haben, die das Gesetz an ihr Handeln knüpft.
Entscheidet sich der Gesetzgeber für die Sanktion der vorübergehenden Minderung existenzsichernder Leistungen, fehlen der bedürftigen Person allerdings Mittel, die sie benötigt, um die Bedarfe zu decken, die ihr eine menschenwürdige Existenz ermöglichen. Mit dem Grundgesetz kann das dennoch vereinbar sein, wenn diese Sanktion darauf ausgerichtet ist, dass Mitwirkungspflichten erfüllt werden, die gerade dazu dienen, die existenzielle Bedürftigkeit zu vermeiden oder zu überwinden. Es gelten jedoch strenge Anforderungen der Verhältnismäßigkeit. Der sonst bestehende weite Einschätzungsspielraum des Gesetzgebers ist enger, wenn er auf existenzsichernde Leistungen zugreift. Je länger eine solche Sanktionsregelung in Kraft ist, umso tragfähigerer Erkenntnisse bedarf es, um ihre Eignung, Erforderlichkeit und Angemessenheit zu belegen.
Bei der Ausgestaltung der Sanktionen sind zudem weitere Grundrechte zu beachten, wenn ihr Schutzbereich berührt ist.
II.1. Die Regelungen staatlicher Sozialleistungen sind mit dem Grundgesetz vereinbar, soweit sie erwerbsfähige Erwachsene zu einer zumutbaren Mitwirkung verpflichten, um ihre Hilfebedürftigkeit zu überwinden oder zu verhindern.
Der Gesetzgeber verfolgt mit den in § 31 Abs. 1 SGB II geregelten Mitwirkungspflichten legitime Ziele, denn sie sollen Menschen wieder in Arbeit bringen. Diese Pflichten sind auch im verfassungsrechtlichen Sinne geeignet, die erwähnten Ziele zu erreichen. Der Gesetzgeber überschreitet auch nicht seinen Einschätzungsspielraum zur Erforderlichkeit, denn es ist nicht evident, dass weniger belastende Mitwirkungshandlungen oder positive Anreize dasselbe bewirken könnten. Die Ausgestaltung der Mitwirkungspflichten ist auch zumutbar. Der Gesetzgeber muss hier – anders als im Recht der Arbeitsförderung – keinen Berufsschutz normieren, denn das Recht der Sozialversicherung und das Grundsicherungsrecht unterscheiden sich strukturell. Es ist daher nicht zu beanstanden, dass hier andere als bislang ausgeübte und auch geringerwertige Tätigkeiten zumutbar sind. Darüber hinaus ist nicht erkennbar, dass eine der in § 31 Abs. 1 SGB II benannten Mitwirkungspflichten gegen das Verbot der Zwangsarbeit (Art. 12 Abs. 2 GG) verstoßen würde. Es ist verfassungsrechtlich auch nicht zu beanstanden, wenn die Mitwirkungspflicht eine Erwerbstätigkeit betrifft, die nicht dem eigenen Berufswunsch entspricht. In den allgemeinen Zumutbarkeitsregelungen, die auch für die Mitwirkungspflichten gelten, ist auch der grundrechtliche Schutz der Familie (Art. 6 GG) berücksichtigt.
2. Die Entscheidung des Gesetzgebers, legitime Pflichten mit Sanktionen durchzusetzen, ist verfassungsrechtlich im Ausgangspunkt nicht zu beanstanden, denn damit verfolgt er ein legitimes Ziel. Die hier zu überprüfenden gesetzlichen Regelungen genügen allerdings dem in diesem Bereich geltenden strengen Maßstab der Verhältnismäßigkeit nicht.
a) Die in § 31a Abs. 1 Satz 1 SGB II normierte Höhe einer Leistungsminderung von 30 % des maßgebenden Regelbedarfs ist nach den derzeitigen Erkenntnissen verfassungsrechtlich nicht zu beanstanden. Zwar ist schon die Belastungswirkung dieser Sanktion außerordentlich und die Anforderungen an ihre Verhältnismäßigkeit sind entsprechend hoch. Doch kann sich der Gesetzgeber auf plausible Annahmen stützen, wonach eine solche Minderung der Grundsicherungsleistungen auch aufgrund einer abschreckenden Wirkung dazu beiträgt, die Mitwirkung zu erreichen, und er kann davon ausgehen, dass mildere Mittel nicht ebenso effektiv wären. Zumutbar ist eine Leistungsminderung in Höhe von 30 % des maßgebenden Regelbedarfs jedoch nur, wenn in einem Fall außergewöhnlicher Härte von der Sanktion abgesehen werden kann und wenn die Minderung nicht unabhängig von der Mitwirkung der Betroffenen starr drei Monate andauert.
aa) Der in § 31a Abs. 1 Satz 1 SGB II geregelten Leistungsminderung in Höhe von 30 % des Regelbedarfs ist im Ergebnis eine generelle Eignung zur Erreichung ihres Zieles, durch Mitwirkung die Hilfebedürftigkeit zu überwinden, nicht abzusprechen. Der gesetzgeberische Einschätzungsspielraum ist zwar begrenzt, weil das grundrechtlich geschützte Existenzminimum berührt ist. Doch genügt die Annahme, die Sanktion trage zur Erreichung ihrer Ziele bei, den verfassungsrechtlichen Anforderungen, weil der Gesetzgeber jedenfalls von einer abschreckenden ex ante-Wirkung dieser Leistungsminderung ausgehen kann. Zudem hat er Vorkehrungen getroffen, die den Zusammenhang zwischen der Mitwirkungspflicht zwecks eigenständiger Existenzsicherung und der Leistungsminderung zu deren Durchsetzung stärken.
Auch die Einschätzung des Gesetzgebers, dass eine solche Sanktion zur Durchsetzung von Mitwirkungspflichten erforderlich ist, hält sich noch in seinem Einschätzungsspielraum. Die gesetzgeberische Annahme, dass mildere, aber gleich wirksame Mittel nicht zur Verfügung stehen, ist hinreichend tragfähig. Es erscheint jedenfalls plausibel, dass eine spürbar belastende Reaktion die Betroffenen dazu motivieren kann, ihren Pflichten nachzukommen, und eine geringere Sanktion oder positive Anreize keine generell gleichermaßen wirksame Alternative darstellen.
Die Regelung verletzt insgesamt auch nicht die hier strengen Anforderungen der Verhältnismäßigkeit im engeren Sinne.
bb) Hingegen genügt die weitere Ausgestaltung dieser Sanktion zur Durchsetzung legitimer Mitwirkungspflichten den verfassungsrechtlichen Anforderungen nicht. Die Vorgabe in § 31a Abs. 1 Satz 1 SGB II, den Regelbedarf bei einer Pflichtverletzung ohne weitere Prüfung immer zwingend zu mindern, ist jedenfalls unzumutbar. Der Gesetzgeber stellt derzeit nicht sicher, dass Minderungen unterbleiben können, wenn sie außergewöhnliche Härten bewirken, insbesondere weil sie in der Gesamtbetrachtung untragbar erscheinen. Er muss solchen Ausnahmesituationen Rechnung tragen, in denen es Menschen zwar an sich möglich ist, eine Mitwirkungspflicht zu erfüllen, die Sanktion aber dennoch im konkreten Einzelfall aufgrund besonderer Umstände unzumutbar erscheint.
cc) Nach der hier vorzunehmenden Gesamtabwägung ist es auch unzumutbar, dass die Sanktion der Minderung des Regelbedarfs nach § 31a Abs. 1 Satz 1 SGB II unabhängig von der Mitwirkung, auf die sie zielt, immer erst nach drei Monaten endet. Der starr andauernde Leistungsentzug überschreitet die Grenzen des gesetzgeberischen Gestaltungsspielraums. Da der Gesetzgeber an die Eigenverantwortung der Betroffenen anknüpfen muss, wenn er existenzsichernde Leistungen suspendiert, weil zumutbare Mitwirkung verweigert wird, ist dies nur zumutbar, wenn eine solche Sanktion grundsätzlich endet, sobald die Mitwirkung erfolgt. Die Bedürftigen müssen selbst die Voraussetzungen dafür schaffen können, die Leistung tatsächlich wieder zu erhalten. Ist die Mitwirkung nicht mehr möglich, erklären sie aber ihre Bereitschaft dazu ernsthaft und nachhaltig, muss die Leistung jedenfalls in zumutbarer Zeit wieder gewährt werden. Auch hier ist der sonst weite Einschätzungsspielraum des Gesetzgebers begrenzt, weil die vorübergehende Minderung existenzsichernder Leistungen im durch Art. 1 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 20 Abs. 1 GG grundrechtlich geschützten Bereich harte Belastungen schafft, ohne dass sich die existenziellen Bedarfe der Betroffenen zu diesem Zeitpunkt verändert hätten.
b) Die im Fall der ersten wiederholten Verletzung einer Mitwirkungspflicht nach § 31a Abs. 1 Satz 2 SGB II vorgegebene Minderung der Leistungen des maßgebenden Regelbedarfs in einer Höhe von 60 % ist nach den derzeit vorliegenden Erkenntnissen nicht mit dem Grundgesetz vereinbar. In der Gesamtabwägung der damit einhergehenden gravierenden Belastung mit den Zielen der Durchsetzung von Mitwirkungspflichten zur Integration in den Arbeitsmarkt ist die Regelung in der derzeitigen Ausgestaltung auf Grundlage der derzeitigen Erkenntnisse über die Eignung und Erforderlichkeit einer Leistungsminderung in dieser Höhe verfassungsrechtlich nicht zu rechtfertigen. Zwar ist es nicht ausgeschlossen, erneut zu sanktionieren, wenn sich eine Pflichtverletzung wiederholt und die Mitwirkungspflicht tatsächlich nur so durchgesetzt werden kann. Doch ist die Minderung in der Höhe von 60 % des Regelbedarfs unzumutbar, denn die hier entstehende Belastung reicht weit in das grundrechtlich gewährleistete Existenzminimum hinein.
aa) Der Gesetzgeber hat zwar Vorkehrungen getroffen, um zu verhindern, dass Menschen durch eine Sanktion die Grundlagen dafür verlieren, überhaupt wieder in Arbeit zu kommen. Sie beseitigen aber die verfassungsrechtlichen Bedenken nicht. Der Gesetzgeber kann sich bei der Minderung um 60 % des maßgebenden Regelbedarfs nicht auf tragfähige Erkenntnisse dazu stützen, dass die erwünschten Wirkungen bei einer Sanktion in dieser Höhe tatsächlich erzielt und negative Effekte vermieden werden. Die Wirksamkeit dieser Leistungsminderung ist bisher nicht hinreichend erforscht. Wenn sich die Eignung tragfähig belegen lässt, Betroffene zur Mitwirkung an der Überwindung der Hilfebedürftigkeit durch Erwerbsarbeit zu veranlassen, mag der Gesetzgeber ausnahmsweise auch eine besonders harte Sanktion vorsehen. Die allgemeine Annahme, diese Leistungsminderung erreiche ihre Zwecke, genügt aber angesichts der gravierenden Belastung der Betroffenen dafür nicht. Es ist im Übrigen auch zweifelhaft, dass einer wiederholten Pflichtverletzung nicht durch mildere Mittel hinreichend effektiv entgegengewirkt werden könnte, wie durch eine zweite Sanktion in geringerer Höhe oder längerer Dauer.
Die Zweifel an der Eignung dieser Leistungsminderung in Höhe von 60 % des maßgebenden Regelbedarfs beseitigt die Regelung zu möglichen ergänzenden Leistungen in § 31a Abs. 3 Satz 1 SGB II nicht, da ihre Ausgestaltung den verfassungsrechtlichen Anforderungen nicht hinreichend Rechnung trägt.
bb) Im Übrigen ergeben sich auch bei der Minderung in Höhe von 60 % des Regelbedarfs nach § 31a Abs. 1 Satz 2 SGB II die genannten Zweifel daran, dass die Sanktion auch in erkennbar ungeeigneten Fällen zwingend vorgegeben ist und unabhängig von jeder Mitwirkung starr drei Monate andauern muss.
c) Der vollständige Wegfall des Arbeitslosengeldes II nach § 31a Abs. 1 Satz 3 SGB II ist auf Grundlage der derzeitigen Erkenntnisse mit den verfassungsrechtlichen Maßgaben nicht vereinbar. Hier entfallen neben den Geldzahlungen für den maßgebenden Regelbedarf hinaus auch die Leistungen für Mehrbedarfe und für Unterkunft und Heizung sowie die Beiträge zur gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung. Daher bestehen bereits Zweifel, ob damit die Grundlagen der Mitwirkungsbereitschaft erhalten bleiben. Es liegen keine tragfähigen Erkenntnisse vor, aus denen sich ergibt, dass ein völliger Wegfall von existenzsichernden Leistungen geeignet wäre, das Ziel der Mitwirkung an der Überwindung der eigenen Hilfebedürftigkeit und letztlich der Aufnahme von Erwerbsarbeit zu fördern.
aa) Auch gegen die Erforderlichkeit dieser Sanktion bestehen erhebliche Bedenken. Der grundsätzliche Einschätzungsspielraum des Gesetzgebers ist hier eng, weil die Sanktion eine gravierende Belastung im grundrechtlich geschützten Bereich der menschenwürdigen Existenz bewirkt. Er ist überschritten, weil in keiner Weise belegt ist, dass ein Wegfall existenzsichernder Leistungen notwendig wäre, um die angestrebten Ziele zu erreichen. Es ist offen, ob eine Minderung der Regelbedarfsleistungen in geringerer Höhe, eine Verlängerung des Minderungszeitraumes oder auch eine teilweise Umstellung von Geldleistungen auf Sachleistungen und geldwerte Leistungen nicht genauso wirksam oder sogar wirksamer wäre, weil die negativen Effekte der Totalsanktion unterblieben.
bb) Schon angesichts der Eignungsmängel und der Zweifel an der Erforderlichkeit einer derart belastenden Sanktion zur Durchsetzung der Mitwirkungspflichten ergibt sich in der Gesamtabwägung, dass der völlige Wegfall aller Leistungen auch mit den begrenzten Möglichkeiten ergänzender Leistungen bereits wegen dieser Höhe nicht mit den hier strengen Anforderungen der Verhältnismäßigkeit vereinbar ist.
Unabhängig davon hat der Gesetzgeber auch im Fall eines vollständigen Wegfalls des Arbeitslosengeldes II dafür Sorge zu tragen, dass die Chance realisierbar bleibt, existenzsichernde Leistungen zu erhalten, wenn zumutbare Mitwirkungspflichten erfüllt werden oder, falls das nicht möglich ist, die ernsthafte und nachhaltige Bereitschaft zur Mitwirkung tatsächlich vorliegt. Anders liegt dies, wenn und solange Leistungsberechtigte es selbst in der Hand haben, durch Aufnahme einer ihnen angebotenen zumutbaren Arbeit ihre menschenwürdige Existenz tatsächlich und unmittelbar durch die Erzielung von Einkommen selbst zu sichern. Wird eine solche tatsächlich existenzsichernde und zumutbare Erwerbstätigkeit ohne wichtigen Grund verweigert, obwohl im Verfahren die Möglichkeit bestand, dazu auch etwaige Besonderheiten der persönlichen Situation vorzubringen, kann ein vollständiger Leistungsentzug zu rechtfertigen sein.
III. Bis zum Inkrafttreten einer Neuregelung bleibt die – für sich genommen verfassungsrechtlich nicht zu beanstandende – Leistungsminderung in Höhe von 30 % nach § 31a Abs. 1 Satz 1 SGB II mit der Maßgabe anwendbar, dass eine Sanktionierung nicht erfolgen muss, wenn dies im konkreten Einzelfall zu einer außergewöhnlichen Härte führen würde. Die gesetzlichen Regelungen zur Leistungsminderung um 60 % sowie zum vollständigen Leistungsentzug (§ 31a Abs. 1 Sätze 2 und 3 SGB II) sind bis zu einer Neuregelung mit der Maßgabe anwendbar, dass wegen wiederholter Pflichtverletzung eine Leistungsminderung nicht über 30 % des maßgebenden Regelbedarfs hinausgehen darf und von einer Sanktionierung auch hier abgesehen werden kann, wenn dies zu einer außergewöhnlichen Härte führen würde. § 31b Abs. 1 Satz 3 SGB II zur zwingenden dreimonatigen Dauer des Leistungsentzugs ist bis zu einer Neuregelung mit der Einschränkung anzuwenden, dass die Behörde die Leistung wieder erbringen kann, sobald die Mitwirkungspflicht erfüllt wird oder Leistungsberechtigte sich ernsthaft und nachhaltig bereit erklären, ihren Pflichten nachzukommen.
-----------------------------------------------------
Laubrente vom Nachbarn bei heftigem Blätterfall |
|
| Stand: 25.10.2016 |
Nürnberg (D-AH) - Nicht erst im kalten Winter, wenn es schneit, geht es bei den Räumdiensten mitunter sehr heiß zu. „Auch bei heftigem Blätterfall können genervte Hausbesitzer und Anwohner schon mal ins herbstliche Schwitzen kommen", sagt Rechtsanwältin Jetta Kasper von der Deutschen Anwaltshotline. Denn für die Laubbeseitigung vor den Anwesen gelten ähnlich strenge Auflagen wie für das Schneeschieben und Enteisen auf öffentlichen Wegen.
Wer dagegen mit den Blättern von Nachbars Bäumen auf dem eigenen Grundstück Probleme hat, müsse sich in der Regel um die Beseitigung selbst kümmern. „Nur wenn deutlich mehr Laub als üblich fällt, gilt das als wesentliche Beeinträchtigung, bei der man unter Umständen Anspruch auf eine sogenannte Laubrente hat", erklärt die Anwältin. Der Baumbesitzer von nebenan müsse dann mit einem jährlichen Geldbetrag den erhöhten Reinigungsaufwand seines Nachbarn bezahlen.
Keine Chance auf Zahlung einer Laubrente bestehe allerdings, wenn die Verursacher des Übels von einer Baumschutzverordnung erfasst sind. „Das öffentliche Recht mutet es nicht nur den Eigentümern, sondern auch allen anderen Betroffenen zu, die Auswirkungen des geschützten Baumes klaglos zu ertragen", erklärt Rechtsanwältin Kasper.
Auch die Räumpflicht auf den Wegen hat ihre Grenzen. Kasper: „Ein Hausbesitzer oder Mieter haftet nur dann, wenn er seine Verkehrssicherungspflicht schuldhaft verletzt hat." Wenn das Laub etwa zu lange liegen bleibt und die vermoderte Masse extrem glitschig wird. „Jeden Unfall kann man nicht ausschließen, denn der Aufwand zur Beseitigung muss der Gefahrenquelle angemessen sein", betont die Anwältin. Herbstlaub falle ständig, und hierauf habe sich jeder Fußgänger einzustellen.
Rutscht ein Passant schon um sieben Uhr früh auf dem Bürgersteig in den nassen Blättern von der Nacht aus und bricht sich dabei ein Bein, habe er keinen Anspruch auf Schadenersatz. Dem Hausbesitzer kann nämlich nach einem Urteil des Landgerichts Frankfurt am Main nicht zugemutet werden, so früh schon den Gehweg zu kehren.
|
|||||||||
-----------------------------------------------------
Energiesparen im Haushalt: Einfache Tipps für niedrige Strom- und Heizkosten
Lesermeinungen:
Wer seinen Energieverbrauch senkt, kann viel Geld sparen – und muss dabei nicht zwangsläufig auf Komfort verzichten. Mit diesen Tipps verringern Verbraucher ihre Strom- und Heizkosten und verbessern die CO2-Bilanz.

Wenn die Stromrechnung ins Haus flattert, kommt für viele der Schock: Die Kosten und der Verbrauch sind mal wieder höher als erwartet. Kommt ein besonders kalter Winter hinzu, fällt auch die Heizkostenabrechnung teurer aus. Verbraucher fragen sich dann unweigerlich, warum die Rechnungen so hoch sind, obwohl sie sich keiner Energieverschwendung bewusst sind. Häufig liegt das nicht an einem verschwenderischen Lebensstil, sondern an ineffizienten Geräten, Energiepreissteigerungen oder unbewusstem Energieverbrauch.

Energieexperte Professor Timo Leukefeld erklärt, wie Verbraucher Strom sparen und ihre Heizkosten senken können, ohne an Lebensqualität einbüßen zu müssen. Er selbst wohnt mittlerweile in einem energieautarken Haus und initiiert Projekte rund ums energieautarke Wohnen.
Strom sparen leichtgemacht: 9 Tipps für geringe Stromkosten
Kein Licht, keine Spülmaschine, kein Laptop: Ohne Elektrizität wäre die Menschheit heutzutage aufgeschmissen. Strom gibt es aber nicht gratis. Da wir jeden Tag reichlich davon brauchen, kann das ziemlich ins Geld gehen. Um Energie zu sparen, müssen Verbraucher aber nicht zurück ins Mittelalter. Wer die folgenden Tipps berücksichtigt, spart jede Menge Strom und Geld ein.
1. Mini-Solaranlage verwenden
„Mieter oder Wohnungseigentümer in einem Mehrfamilienhaus, die mithilfe von Sonnenenergie Stromkosten sparen möchten, sollten mit einer Mini-Solaranlage starten“, empfiehlt Energieexperte Leukefeld. Im Mai 2018 wurde die Vornorm DIN VDE V 0100-551-1 (VDE V 0100-551-1) in Deutschland veröffentlicht. Seitdem dürfen Verbraucher Photovoltaik-Anlagen in einen vorhandenen Endstromkreis einbinden.
Bei Mini-Solaranlagen handelt es sich um mobile Solaranlagen, die sich über eine spezielle Energiesteckdose oder über eine feste Installation mit dem Stromnetz verbinden lassen. Sie haben einen Wechselrichter, der Sonnenenergie in Gleichstrom umwandelt. Bevor der Strom ins Hausnetz eingespeist wird, wandelt ihn der Wechselrichter in Wechselstrom um. Mobilie Solaranlagen haben eine Leistung zwischen 150 und 600 Watt. “Mit einer Solarleistung von 600 Watt können Verbraucher im Süden Deutschlands bis zu 660 Kilowattstunden Strom pro Jahr erzeugen“, so Leukefeld. Das entspräche etwa 20 Prozent des jährlichen Stromverbrauchs eines Durchschnittshaushalts und einer CO2-Einsparung von rund 320 Kilogramm. Eine Strom-Einspeisung ins öffentliche Stromnetz ist allerdings nur möglich, wenn ein Zweirichtungszähler vorhanden ist und die Anlage bei der Bundesnetzagentur und beim örtlichen Netzbetreiber angemeldet ist.
Achtung: Der Anschluss einer Plugin-Solaranlage über eine gewöhnliche Steckdose ist in Deutschland verboten und brandgefährlich. Hierbei kann die Sicherung ihre Schutzfunktion nicht mehr vollständig erfüllen, da sie den Strom, der in die Steckdose eingespeist wird, nicht erkennt. Das kann zur Überlastung des Stromkreises und zu einem Leitungsbrand führen. Daher ist es wichtig, Mini-Solaranlagen normgerecht nach den VDE-Sicherheitsvorschriften über eine spezielle Energiesteckdose oder über eine feste Installation zu installieren. Verbraucher sollten sich daher an einen fachkundigen Elektriker wenden.
2. LED- und Energiesparlampen nutzen
Um Strom zu sparen, sollten Verbraucher auf LED- oder Energiesparlampen setzen, wenn sie ihre Leuchten ohnehin wechseln müssen. LED- und Energiesparleuchten sind zwar teurer als gewöhnliche Glühbirnen, dafür halten sie viel länger. Eine Glühlampe brennt in der Regel circa 1.000 Betriebsstunden, was ungefähr dem Betrieb von einem Jahr entspricht. Energiesparlampen halten etwa 10.000 und LED-Lampen 25.000 Betriebsstunden durch. Darüber hinaus verbrauchen Energiesparlampen und LED-Leuchten weniger Strom, da sie effizienter sind. Eine gewöhnliche Glühlampe verwendet gerade mal fünf Prozent der Energie für die Erzeugung von Licht. Die restlichen 95 Prozent werden in ungenutzte Wärme umgewandelt. LED-Lampen – die effizientesten Leuchten – verbrauchen circa 90 Prozent weniger Strom als Glühlampen, da sie deutlich weniger Wärme produzieren.
Die nachfolgende Tabelle stellt eine 75-Watt-Glühlampe einer Energiesparlampe und einer LED-Leuchte mit einer entsprechenden Lichtstärke von 1.000 Lumen gegenüber:
| LED-Lampe | Energiesparlampe | Glühlampe | |
| Lebensdauer | 25.000 Std. | 10.000 Std. | 1.000 Std. |
| Leistung | 12 Watt | 15 Watt | 75 Watt |
| Anschaffungskosten | 25 Euro | 9 Euro | 0,5 Euro |
| Stromkosten pro Jahr (bei 29 ct/kWh und 1.000 Std. Brenndauer) | 3,48 Euro | 4,35 Euro | 21,75 Euro |
| Jährl. Gesamtkosten (inkl. Anschaffungskosten, bei 1.000 Std. Brenndauer) | 4,08 Euro | 5,25 Euro | 22,25 Euro |
| Jährl. Co2-Ausstoß* (bei 1.000 Std. Brenndauer im Jahr) | 5,87 kg | 7,34 kg | 36,68 kg |
* Laut Schätzungen des Umweltbundesamtes verursachte 2017 eine Kilowattstunde Strom 489 Gramm CO2.
Wie man sieht, lassen sich mit LED- beziehungsweise Energiesparlampen Energie und Kosten sparen. Zudem verbessern Verbraucher ihre CO2-Bilanz erheblich. „Eine Umstellung auf LED-Lampen lohnt sich finanziell aber nur, wenn die alten Leuchten kaputt sind“, betont Energieexperte Leukefeld, „denn es macht wirtschaftlich keinen Sinn, funktionierende Leuchten zu ersetzen.“
.....................................................
Energieeffizient Waschen
Auch beim Wäsche waschen, können Verbraucher Strom und Geld sparen. Schließlich werden mehr als 75 Prozent der Energie, die für einen Waschgang nötig ist, für das Erhitzen des Wassers genutzt.
So geht Energiesparen beim Waschen:
- Mit niedriger Temperatur waschen: „Wer Textilien mit 30 statt 60 Grad Celsius wäscht, verbraucht zwei Drittel weniger Strom beim Waschen,“ so Leukefeld. Waschmittel reinigen die Wäsche auch bei geringen Temperaturen optimal und die Kleidung bleibt länger schön. Ab und an ist jedoch ein Kochwaschgang nötig, damit sich in der Maschine keine Gerüche bilden.
- Auf Vorwaschgang verzichten: Meist ist der Vorwaschgang überflüssig, da Textilien nur selten stark verschmutzt sind. Wenn Verbraucher auf den Vorwaschgang verzichten, verringern sich die fürs Waschen nötige Mengen an Strom und damit auch die Kosten.
-
Wäsche lufttrocknen lassen: Laut der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz verbraucht ein äußerst effizienter Wäschetrockner mit der Effizienzklasse A+++ bei 160 Trockengängen pro Jahr 158
Kilowattstunden Strom. Daraus ergeben sich bei einem Strompreis von 0,29 €/kWh Stromkosten von rund 46 Euro pro Jahr, die man sich beim Lufttrocknen der Wäsche spart. Zudem verringert sich der
CO2-Ausstoß um 77,26 kg pro Jahr – schließlich ist das Lufttrocknen klimaneutral.
Energieeffizient Waschen
Auch beim Wäsche waschen, können Verbraucher Strom und Geld sparen. Schließlich werden mehr als 75 Prozent der Energie, die für einen Waschgang nötig ist, für das Erhitzen des Wassers genutzt.
So geht Energiesparen beim Waschen:
- Mit niedriger Temperatur waschen: „Wer Textilien mit 30 statt 60 Grad Celsius wäscht, verbraucht zwei Drittel weniger Strom beim Waschen,“ so Leukefeld. Waschmittel reinigen die Wäsche auch bei geringen Temperaturen optimal und die Kleidung bleibt länger schön. Ab und an ist jedoch ein Kochwaschgang nötig, damit sich in der Maschine keine Gerüche bilden.
- Auf Vorwaschgang verzichten: Meist ist der Vorwaschgang überflüssig, da Textilien nur selten stark verschmutzt sind. Wenn Verbraucher auf den Vorwaschgang verzichten, verringern sich die fürs Waschen nötige Mengen an Strom und damit auch die Kosten.
- Wäsche lufttrocknen lassen: Laut der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz verbraucht ein äußerst effizienter Wäschetrockner mit der Effizienzklasse A+++ bei 160 Trockengängen pro Jahr 158 Kilowattstunden Strom. Daraus ergeben sich bei einem Strompreis von 0,29 €/kWh Stromkosten von rund 46 Euro pro Jahr, die man sich beim Lufttrocknen der Wäsche spart. Zudem verringert sich der CO2-Ausstoß um 77,26 kg pro Jahr – schließlich ist das Lufttrocknen klimaneutral.
Laptop statt PC
Wer sich einen neuen Computer anschaffen möchte, sollte zu einem mobilen Laptop greifen. Energieexperte Leukefeld sagt: „Im Vergleich zu einem Desktop-PC verbraucht ein Laptop in der Regel 91 kg CO2 weniger pro Jahr“. Schließlich benötigt ein Laptop mit vergleichbarer Leistung und Ausstattung wie ein Multimedia-PC nur 30 Watt im Normalbetrieb, ein Desktop-PC hingegen mindestens 200 Watt.
| Laptop | Desktop-PC | |
| Nutzungsdauer/Tag | 3 Std. | 3 Std. |
| Leistung | 30 Watt | 200 Watt |
| Stromkosten pro Jahr bei 29 ct / kWh | 9,53 Euro | 63,51 Euro |
| Jährl. C02-Ausstoß* | 16,06 kg | 107,09 kg |
* Laut Schätzungen des Umweltbundesamts verursachte 2017 eine Kilowattstunde Strom 489 Gramm C02.
Elektronische Geräte ganz ausschalten
Bequemlichkeit versus Energiesparen: Wenn es um elektronische Geräte geht, siegt oftmals die Bequemlichkeit. Statt die Geräte komplett auszuschalten, werden sie meist im Stand-by-Modus belassen. Auf Stand-by ziehen Stereoanlage, Fernseher und Co. kontinuierlich Strom. So werfen die Deutschen laut Umweltbundesamt vier Milliarden Euro pro Jahr aus dem Fenster. Das macht im Haushalt rund 10 Prozent der Stromkosten aus.
Geräte, die keinen Schalter haben, beziehen ebenfalls kontinuierlich Strom, wenn sie am Netz angeschlossen sind. „Es lohnt sich, deren Energieverbrauch mit einem Stromverbrauch-Messgerät zu ermitteln“, weiß Timo Leukefeld. Diese Geräte gibt es für wenige Euro im Baumarkt oder Internet zu kaufen. „Die größten Stromfresser sollten Verbraucher an eine Steckdosenleiste mit Schalter anschließen. So kann man die Stromzufuhr bei Nichtgebrauch einfach unterbinden“, erklärt der Energieexperte.
Steckdosenleisten sind auf eine Leistung von rund 3.000 bis 3.500 Watt ausgelegt. Die angeschlossenen Geräte sollten dies nicht überschreiten, denn sonst können die Stromleitungen überhitzen und zu brennen beginnen.
So vermeiden Verbraucher unnötige Stromkosten:
- Elektro- und Ladegeräte nach dem Gebrauch ausschalten beziehungsweise vom Netz nehmen.
- Geräte, die keinen Schalter haben, an eine Steckdosenleiste mit Schalter anschließen
- Beim Neukauf zu Elektrogeräten greifen, die sich vollständig vom Netz trennen lassen und einen niedrigen Stand-by-Verbrauch haben.
7. Haushaltsgeräte: Auf eine gute Effizienzklasse achten
Um zu gewährleisten, dass Verbraucher die Energieeffizienz eines Elektrogerätes sofort erkennen können, wurden in der Europäischen Union Energielabels eingeführt. Diese Etiketten ordnen Produkte in Energieeffizienzklassen ein und müssen deutlich sichtbar auf den Verpackungen der Geräte aufgeführt werden. Die darauf abgebildeten Effizienzklassen sind für jede Gerätegruppe einzeln festgelegt. Sie geben den Verbrauch eines Gerätes im Vergleich zu Referenzgeräten an. Daher lässt sich also nicht die Effizienz verschiedener Gerätetypen miteinander vergleichen.
Hier eine Übersicht über die Effizienzklassen nach Produktgruppen:

Wer sich ein neues Haushaltsgerät anschafft, sollte auf eine möglichst gute Effizienzklasse achten. Timo Leukefeld betont: „Je besser die Energieeffizienz ist, desto weniger Strom braucht das Gerät für den Betrieb. So sparen Verbraucher langfristig viel Energie und Geld ein.“
Am 1. August 2017 ist die neue Rahmen-Verordnung für die Energieverbrauchskennzeichnung in Kraft getreten: Bis Ende 2019 sollen die sogenannten Plus-Klassen verschwinden und es wieder eine einheitliche Skala von A bis G geben. So möchte man die die Vergleichbarkeit der Geräte pro Produktgruppe verbessern.
Kühlschrank und Gefriertruhe regelmäßig abtauen

Besitzer eines älteren Kühlschranks oder einer älteren Gefriertruhe, sollten das Gerät circa zwei Mal im Jahr abtauen. „Diese Maßnahme ist immer dann nötig, wenn nicht nur ein Reifansatz, sondern eine Eisschicht an den Innenwänden des Kühl- oder Gefrierschranks vorhanden ist“, erklärt Energieexperte Leukefeld. Mit einer fünf Millimeter dicken Eisschicht erhöht sich der Stromverbrauch des Kühlschranks um circa 30 Prozent. Eis ist eine gute Dämmung, daher ist mehr Energie nötig, um die Lebensmittel zu kühlen.
So beugen Verbraucher der Bildung einer Eisschicht vor:
- Nur verpackte Lebensmittel in den Kühlschrank stellen. Unverpackt geben sie zu viel Feuchtigkeit ab. Es lohnt sich also, offene Wurst und Co. in einer Plastik- oder Glasbox im Kühlschrank zu lagern.
- Kühl- und Gefriertruhe an einem möglichst kühlen Ort stellen. Steht das Gerät beispielsweise direkt neben dem warmen Heizkörper oder neben dem Backofen, muss es mehr Energie aufwenden, um die Lebensmittel zu kühlen und hält nicht so lange.
- Kühl- bzw. Gefrierschranktür schnell schließen. Beim Öffnen verbraucht das Gerät viel Energie, um die entweichende Kälte zu kompensieren. Verbraucher sollten sich also vorher überlegen, was sie herausnehmen möchten und die Tür danach sofort schließen. „Es ist effizienter, die Kühlschranktür mehrmals kurz zu öffnen, um Lebensmittel herauszunehmen, als einmal lang“, so Leukefeld.
Wer sich ohnehin einen neuen Kühl- oder Eisschrank kaufen möchte, sollte ein No-Frost-Gerät in Erwägung ziehen. Das No-Frost-System funktioniert ähnlich wie ein Umluftsystem. Es wälzt die Luft ständig um, sodass die Feuchtigkeit besser verteilt und aus dem Kühlschrankinneren gefiltert wird. Allerdings ist dafür Energie notwendig, sodass diese Kühlschränke meist nicht die beste Effizienzklasse erreichen. Es kann jedoch sinnvoll sein, statt einem A+++-Gerät ohne No-Frost-System ein A++-Gerät mit No-Frost-System zu kaufen.
Stromanbietervergleich spart Kosten
Mit einem Anbietervergleich können Verbraucher ihre Stromkosten erheblich reduzieren. Im Internet lassen sich die Preise der Stromanbieter sehr leicht gegenüberstellen. Verbraucher geben in den einschlägigen Portalen ihre Postleitzahl und ihren durchschnittlichen Jahresverbrauch an. Dieser lässt sich aus den letzten Jahresabrechnungen berechnen. Schon werden ihnen unterschiedliche Anbieter bzw. Tarife – sortiert nach Preis – vorgeschlagen.
Das günstigste Angebot ist aber nicht immer das Beste. Es gilt, die Konditionen der Anbieter zu vergleichen. Dabei sollten Verbraucher darauf achten, dass die Anbieter auf automatische Vertragsverlängerungen und Preiserhöhungen während der Vertragslaufzeit verzichten und Verträge mit kurzen Laufzeiten und Kündigungsfristen anbieten.
Besonders günstige Angebote haben oft einen Haken wie die Pflicht zur Kautions- oder Vorauskassenzahlung. Manchmal wirkt der Tarif aufgrund eines Neukundenbonus sehr günstig, ist aber nach einem Jahr deutlich teurer. Oder es werden Strompakete, also eine bestimmte Menge Strom für einen festgelegten Zeitraum, verkauft.
Wer der Umwelt etwas Gutes tun möchte, sollte zu einem Ökostromanbieter wechseln. Diese sind häufig ebenso günstig wie Normalstromanbieter, gewinnen aber elektrische Energie aus erneuerbaren Quellen wie Sonnenenergie oder Wasserkraft. „Ich achte hier vor allem auf die Geschichte des Stromanbieters“, erklärt der Energieexperte Timo Leukefeld, der selbst in einem energieautarken Haus wohnt und Projekte rund ums energieautarke Wohnen initiiert. „Da gibt es Unternehmen, die sich leidenschaftlich für die Umwelt einsetzen“, so Leukefeld.

Mietkaution: Rückzahlung nicht ohne Prüfung
Lesermeinungen:
Eine Mietkaution dient für den Vermieter als Sicherheit. Hat der Mieter Schäden in der Wohnung verursacht, beispielsweise den Parkettboden demoliert oder Fliesen von der Wand geschlagen, darf der Vermieter dieses Geld einbehalten, um die Reparaturkosten zu bezahlen. Was Vermieter zur Mietkaution, der Rückzahlung und den Fristen wissen müssen.

Wer eine Wohnung vermietet, verlangt in der Regel als Sicherheit eine Mietkaution, die er für den Mieter gewinnbringend anlegen muss. Findet der Vermieter nach Beendigung des Mietverhältnisses beispielsweise Schäden an der Wohnung, kann er Teile des Geldbetrags aber auch einbehalten – und das führt manchmal zu Streit. Was Vermieter zur Rückzahlung der Mietkaution wissen müssen.
Ausstehende Kosten können durch Mietkaution beglichen werden
Wenn der Vermieter gegenüber dem Mieter noch Forderungen hat, kann er auf die Mietkaution zurückgreifen. Folgende Kosten kann der Vermieter daraus begleichen:
- Beschädigung der Mietsache oder unterlassene Renovierungsarbeiten bzw. Schönheitsreparaturen. Mängel an der Wohnung sollte der Vermieter idealerweise gleich in einem Wohnungsübergabeprotokoll festhalten. „Mängel sind Schäden an der Wohnung, die der Vermieter bei der Wohnungsrückgabe gegenüber dem Mieter angibt“, erklärt Rechtsanwalt Michael Wolf aus Koblenz, Präsident des Vermietervereins. Nur dann habe der Vermieter das Recht, die Mängel bei der Kautionsabrechnung anzugeben und sie abzuziehen.
- Andere Forderungen wie Mietrückstände, die sich während des Mietverhältnisses gebildet haben.
- Bei einer zu späten Rückgabe der Wohnung durch den Mieter: Endet das Mietverhältnis also Ende Februar, der Mieter gibt die Schlüssel aber erst am 6. März zurück, kann der Vermieter für diese Tage noch Miete einfordern.
- Offene Betriebskostenabrechnungen.
Die Kaution darf nur mit Ansprüchen verrechnet werden, die aus dem eigenen Mietverhältnis herrühren, wie der BGH entschieden hat (Az.: VIII ZR 36/12). In besagtem Fall wollte ein Vermieter die Mietkaution mit einer Forderung aus einem früheren Mietverhältnis verrechnen, die durch den Vorvermieter an ihn abgetreten wurde.
Vermieter müssen angemessene Frist einhalten
Für die Überprüfung seiner Ansprüche, ob also beispielsweise Schäden an der Wohnung bestehen oder Betriebskostenabrechnungen offen sind, steht dem Vermieter eine angemessene Prüf- und Überlegungsfrist zu. „Eine gesetzlich geregelte Abrechnungsfrist besteht nicht. In der Vergangenheit haben die Gerichte unterschiedlich entschieden und dies vom Einzelfall abhängig gemacht. Wir beraten unsere Mitglieder dahingehend, dass die Kaution innerhalb von drei bis sechs Monaten abzurechnen ist“, erklärt Rechtsanwalt Michael Wolf. Gerichte würden häufig bis zu sechs Monate Zeit geben, bis eine Mieterklage auf eine Kautionsabrechnung zulässig sei.
Vorsicht: Schäden an der Mietsache verjähren nach sechs Monaten

Die Einhaltung der oben genannten Frist ist auch aus einem anderen Grund wichtig: „Schäden an der Wohnung verjähren laut BGB sechs Monate nach der Rückgabe der Wohnung“, erklärt Wolf. Das bedeutet, der Vermieter kann nach Fristablauf nur noch Ansprüche in Höhe einer nicht ausgezahlten Kaution verwerten.
Ist die Wohnungsrückgabe am 1. März, kann der Vermieter Forderungen wegen Beschädigungen in der Wohnung nur bis zum 31. August geltend machen. Ab dem 1. September sind diese Schäden verjährt, der Vermieter hat keine Ansprüche mehr.
Sonderfall: Offene Betriebskostenabrechnungen
Einzige wirkliche Ausnahme sind in diesem Fall offene Betriebskostenabrechnungen. Hier können Vermieter einen Teil der Kaution länger zurückhalten – üblicherweise aber nicht mehr als drei bis vier monatliche Vorauszahlungen.
Als Beispiel folgender Fall: „Der Vermieter kann, da die Betriebskostenabrechnung 2015 erst bis Ende 2016 vorliegen muss, einen von ihm konkret geschätzten Einbehalt im Rahmen der Kautionsabrechnung von der Kaution abziehen und so lange behalten, bis die Betriebskostenabrechnung fällig ist“, erklärt Wolf.
Checkliste: vor Rückzahlung der Mietkaution
Das sollten Vermieter vor Rückzahlung der Mietkaution überprüfen:
- Gibt es Schäden an der Wohnung?
- Wurden Schönheitsreparaturen, beziehungsweise Renovierungsarbeiten, vertragsgemäß ausgeführt?
- Bestehen andere Schadensersatzansprüche aus dem Mietverhältnis?
- Gibt es weitere Forderungen wie beispielsweise Mietrückstände?
- Wurde die Wohnung rechtzeitig übergeben?
- Gibt es noch offene Betriebskostenabrechnungen?
Mietkaution: Rückzahlung in Abrechnung festhalten
Egal ob der Vermieter nur einen Teil der Kaution ausbezahlt, sie vollständig zurückgibt oder sie sogar ganz einbehält: Die Verwendung des Geldbetrags sollte er mit einer Kautionsabrechnung transparent gestalten. Darin informiert der Vermieter den Mieter über die Rückzahlung der Mietkaution, listet aber auch eventuelle Forderungen auf. Deshalb sollte er die Kautionsabrechnung am besten per Einschreiben versenden.
-----------------------------------------------------
Regelungen zur Europäischen Bankenunion bei strikter Auslegung nicht kompetenzwidrig
Pressemitteilung Nr. 52/2019 vom 30. Juli 2019
Urteil vom 30. Juli 2019 - 2 BvR 1685/14, 2 BvR 2631/14
Die Europäische Union hat durch die Regelungen zur Europäischen Bankenunion, namentlich zum Einheitlichen Bankenaufsichtsmechanismus (Single Supervisory Mechanism, SSM) und zum Einheitlichen Abwicklungsmechanismus (Single Resolution Mechanism, SRM), bei strikter Auslegung ihre durch die Verträge zugewiesenen Kompetenzen nicht überschritten. Die SSM- und SRM-Verordnung berühren auch nicht die Verfassungsidentität. Dies hat der Zweite Senat des Bundesverfassungsgerichts mit heute verkündetem Urteil entschieden. Danach überschreitet die SSM-Verordnung nicht in offensichtlicher Weise die primärrechtliche Ermächtigungsgrundlage des Art. 127 Abs. 6 AEUV, da sie der Europäischen Zentralbank (EZB) die Aufsicht über die Kreditinstitute in der Eurozone nicht vollständig überträgt. Die Errichtung und Kompetenzausstattung des Ausschusses für die einheitliche Abwicklung (Single Resolution Board, SRB) durch die SRM-Verordnung begegnen zwar im Hinblick auf das Prinzip der begrenzten Einzelermächtigung Bedenken; eine offensichtliche Kompetenzüberschreitung liegt jedoch nicht vor, sofern die Grenzen der dem Ausschuss zugewiesenen Aufgaben und Befugnisse strikt beachtet werden. Bleibt die Gründung von unabhängigen Agenturen auf Ausnahmefälle beschränkt, so ist auch die Verfassungsidentität des Grundgesetzes nicht berührt. Die Absenkung des demokratischen Legitimationsniveaus, wie sie mit der Unabhängigkeit der unionalen und der nationalen Aufsichts- und Abwicklungsbehörden einhergeht, ist allerdings nicht unbegrenzt zulässig und bedarf der Rechtfertigung. Im Bereich der Bankenaufsicht und -abwicklung ist sie im Ergebnis noch hinnehmbar, weil sie durch besondere Vorkehrungen kompensiert wird, die eine demokratische Rückbindung ermöglichen. Im Ergebnis haben Bundesregierung und Deutscher Bundestag nicht am Zustandekommen oder der Umsetzung von Sekundärrecht, das die Grenzen des Integrationsprogramms überschreitet, mitgewirkt; eine Verletzung der Beschwerdeführer in ihrem Recht aus Art. 38 Abs. 1 Satz 1 GG scheidet damit aus.
Sachverhalt:
Unter dem Begriff „Europäische Bankenunion“ wird die Übertragung nationaler Kompetenzen auf europäische Institutionen und die Schaffung einheitlicher Regelungen für die Finanzmarktaufsicht und Abwicklung von Kreditinstituten zusammengefasst. Deren Kern sind der einheitliche Bankenaufsichtsmechanismus, bei dem Aufsichtsbefugnisse gegenüber „systemrelevanten Banken“ in den Mitgliedsstaaten des Euro-Währungsgebietes auf die Europäische Zentralbank übertragen worden sind, und der einheitliche Bankenabwicklungsmechanismus, mit dem zur Abwicklung zahlungsunfähiger Großbanken der Ausschuss sowie der Fonds für die einheitliche Abwicklung (Fonds) errichtet worden ist. Der Fonds befindet sich derzeit noch im Aufbau.
Die Verfassungsbeschwerden richten sich im Wesentlichen gegen die beiden zugrundeliegenden Verordnungen (SSM-Verordnung, SRM-Verordnung) und das zur Zustimmung ermächtigende Bundesgesetz (SSM-VO-Gesetz).
Wesentliche Erwägungen des Senats:
1. Der Erlass der SSM-Verordnung unter Zugrundelegung der vom Senat vorgenommenen Auslegung stellt keine hinreichend qualifizierte Überschreitung der der Europäischen Union durch die Verträge zugewiesenen Kompetenzen dar. Mit der SSM-Verordnung ist der EZB die Bankenaufsicht nicht vollständig übertragen worden.
a) Die Übertragung der Aufsichtsbefugnisse auf die EZB erweist sich insoweit nicht als offensichtliche Überschreitung der Einzelermächtigung aus Art. 127 Abs. 6 AEUV. Danach können der EZB besondere Aufgaben im Zusammenhang mit der Aufsicht über Kreditinstitute und sonstige Finanzinstitute mit Ausnahme von Versicherungsunternehmen übertragen werden.
aa) Die SSM-Verordnung sieht eine Zweiteilung der Bankenaufsicht vor. Dabei verbleibt es im Wesentlichen bei der Zuständigkeit der nationalen Behörden, während der EZB lediglich besondere Aufsichtsbefugnisse zukommen, die für eine kohärente und wirksame Politik der Europäischen Union in diesem Bereich entscheidend sind. Der EZB werden dazu bestimmte Aufgaben übertragen, die sie für alle Kreditinstitute in der Eurozone wahrzunehmen hat. Hinsichtlich der übrigen Bereiche wird ihr grundsätzlich nur die Aufsicht für bedeutende Kreditinstitute zugewiesen, während die nationalen Aufsichtsbehörden regelmäßig für weniger bedeutende Kreditinstitute nach Maßgabe der von der EZB erlassenen Verordnungen, Leitlinien und allgemeinen Weisungen zuständig bleiben. Auch in allen nicht von der SSM-Verordnung erfassten Bereichen der Bankenaufsicht verbleibt es bei der Zuständigkeit der nationalen Aufsichtsbehörden.
bb) Die nationalen Aufsichtsbehörden üben ihre Befugnisse aufgrund originärer Zuständigkeiten aus und nicht infolge einer Ermächtigung durch die EZB. Eine solche Rückdelegation setzte eine vollständige Übertragung der Aufsicht auf die EZB voraus, die die SSM-Verordnung jedoch gerade nicht vorsieht. Andernfalls läge darin eine offensichtliche und strukturell bedeutsame Überschreitung des Integrationsprogramms, die den Mitgliedstaaten einen zentralen Bereich der Wirtschaftsaufsicht entzöge. Eine solche Auslegung der SSM-Verordnung ist weder mit dem Wortlaut von Art. 127 Abs. 6 AEUV vereinbar noch systematisch vertretbar.
Die Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) vom 8. Mai 2019 (C-450/17 P Landeskreditbank Baden-Württemberg/Europäische Zentralbank) steht dem nicht entgegen. Der EuGH bestätigt darin die Auffassung des Gerichts der Europäischen Union (EuG), der EZB sei in Bezug auf die in Art. 4 Abs. 1 SSM-VO genannten Aufgaben eine ausschließliche Zuständigkeit übertragen worden, deren dezentralisierte Ausübung durch die nationalen Behörden im Rahmen des SSM und unter Aufsicht der EZB bei den weniger bedeutenden Kreditinstituten im Sinne von Art. 6 Abs. 4 Unterabs. 1 SSM-VO hinsichtlich einiger dieser Aufgaben durch Art. 6 gestattet werde. Auch sei der EZB die ausschließliche Befugnis eingeräumt worden, den Inhalt des Begriffs „besondere Umstände“ im Sinne von Art. 6 Abs. 4 Unterabs. 2 SSM-VO zu bestimmen, so dass der EZB die ausschließliche Aufsicht hinsichtlich aller Institute zusteht, die nach den Kriterien von Art. 6 Abs. 4 Unterabs. 2 SSM-VO grundsätzlich als bedeutend gelten. Eine umfassende Aufsichtskompetenz der EZB auch bezüglich der – zahlenmäßig weit überwiegenden – weniger bedeutenden Kreditinstitute ist damit unbeschadet des Selbsteintrittsrechts nach Art. 6 Abs. 5 SSM-VO jedoch nicht verbunden. Die bisherige Praxis der Bankenaufsicht bestätigt die vom Senat vorgenommene Auslegung.
Da die SSM-Verordnung nur die Aufgaben und Befugnisse auf die EZB übertragen hat, die für eine effektive Aufsicht zwingend erforderlich sind, und angesichts der weiterhin bestehenden umfangreichen Befugnisse der nationalen Behörden, scheidet auch eine offenkundige Verletzung des Subsidiaritätsprinzips aus.
b) Auch die Errichtung des Aufsichtsgremiums (Supervisory Board) durch Art. 26 Abs. 1 SSM-VO stellt sich nicht als offensichtlicher Verstoß gegen Art. 129 Abs. 1 AEUV und Art. 141 Abs. 1 AEUV in Verbindung mit Art. 44 ESZB-Satzung dar.
c) In der vom Senat vorgenommenen Auslegung berührt die SSM-Verordnung schließlich auch nicht die durch Art. 23 Abs. 1 Satz 3 in Verbindung mit Art. 79 Abs. 3 GG geschützte Verfassungsidentität. Soweit sie den durch Art. 38 Abs. 1 Satz 1 in Verbindung mit Art. 20 Abs. 1 und Abs. 2 in Verbindung mit Art. 79 Abs. 3 GG verankerten „Anspruch auf Demokratie“ betrifft, ist diese auch im Rahmen der Ultra-vires-Kontrolle Prüfungsmaßstab.
aa) Ultra-vires-Kontrolle und Identitätskontrolle stehen als eigenständige Prüfverfahren nebeneinander. Auch wenn sich beide Kontrollvorbehalte auf Art. 79 Abs. 3 GG zurückführen lassen, liegt ihnen ein jeweils unterschiedlicher Prüfungsansatz zugrunde. Eine zulässige Verfassungsbeschwerde erfordert daher einen hinreichend substantiierten Vortrag zu den Voraussetzungen entweder der Ultra-vires- oder der Identitätsrüge. An die jeweils zulässig erhobene Rüge ist das Bundesverfassungsgericht gebunden.
Soweit mit der Verfassungsbeschwerde dagegen zulässigerweise eine Verletzung des „Anspruchs auf Demokratie“ gerügt wird, geht es um einen einzigen Prüfungsmaßstab. In diesem Fall haben Ultra-vires- und Identitätskontrolle nicht nur dieselbe verfassungsrechtliche Wurzel, sie decken sich auch im Hinblick auf das als verletzt gerügte Recht und das Ziel der Verfassungsbeschwerde. Eine mit der Berührung des „Anspruchs auf Demokratie“ verbundene Maßnahme der Europäischen Union kann nicht auf einer primärrechtlichen Ermächtigung beruhen, weil auch der mit der Mehrheit des Art. 23 Abs. 1 Satz 3 in Verbindung mit Art. 79 Abs. 2 GG entscheidende Integrationsgesetzgeber der Europäischen Union keine Hoheitsrechte übertragen kann, mit deren Inanspruchnahme eine Berührung der von Art. 79 Abs. 3 GG geschützten Verfassungsidentität einherginge.
Wird eine Ultra-vires- oder eine Identitätsrüge zulässigerweise auf eine mögliche Verletzung des „Anspruchs auf Demokratie“ gestützt, muss die in Rede stehende Maßnahme der Europäischen Union daher (mittelbar) umfassend auf ihre Vereinbarkeit mit Art. 38 Abs. 1 Satz 1 in Verbindung mit Art. 20 Abs. 1 und Abs. 2 in Verbindung mit Art. 79 Abs. 3 GG überprüft werden.
bb) Die mit der Unabhängigkeit der EZB und der nationalen Aufsichtsbehörden verbundene Absenkung des demokratischen Legitimationsniveaus im Bereich der Bankenaufsicht stellt die parlamentarische Verantwortung für die entsprechenden Maßnahmen nicht in einer Art. 20 Abs. 2 Satz 1 in Verbindung mit Art. 79 Abs. 3 GG berührenden Weise in Frage.
Zwar ist diese Absenkung bedenklich, weil sie zu dem weitreichenden und schwer einzugrenzenden Mandat der EZB im Bereich der Währungspolitik hinzutritt. Sie ist im Ergebnis allerdings noch hinnehmbar, weil sie durch besondere Vorkehrungen kompensiert wird, die der demokratischen Rückbindung ihres hier in Rede stehenden Handelns dienen. Eine demokratische Rückbindung erfahren die im Vollzug der SSM-Verordnung ergehenden Entscheidungen durch die Bestellung der Beschlussorgane der EZB, durch ihre Bindung an das einschlägige Primärrecht – die Grundsätze der begrenzten Einzelermächtigung, der Verhältnismäßigkeit und die Charta der Grundrechte – sowie an die Vorgaben der SSM-Verordnung. Darüber hinaus wendet sie auch von den nationalen Parlamenten verabschiedetes Recht an, soweit hierdurch Richtlinien umgesetzt werden oder von in Verordnungen vorgesehenen Wahlrechten Gebrauch gemacht wurde. Soweit der EZB dort Ermessen eingeräumt wird, steht ihr zwar ein weiter Spielraum zu; das ist im Ergebnis jedoch noch hinnehmbar, weil die Einflussknicke durch besondere Vorkehrungen wie Rechtsschutzmöglichkeiten, Rechenschafts- und Berichtspflichten der EZB gegenüber den Organen der Europäischen Union und den nationalen Parlamenten kompensiert werden.
Auch die in der SSM-Verordnung enthaltene Anordnung, dass die nationalen Aufsichtsbehörden bei der Wahrnehmung der durch die SSM-Verordnung geregelten Aufgaben unabhängig handeln und keinen Weisungen unterliegen, wirft im Hinblick auf das Legitimationsniveau der von den zuständigen deutschen Behörden erlassenen Maßnahmen Probleme auf. Das betrifft die Aufsicht über die weniger bedeutenden Kreditinstitute ebenso wie die Unterstützungsaufgaben zugunsten der EZB. Ministerielle Erlasse und Weisungen sind insoweit unzulässig. Dies steht in einem deutlichen Spannungsverhältnis zu dem durch Art. 20 Abs. 2 Satz 1 in Verbindung mit Art. 79 Abs. 3 GG geschützten Grundsatz der Volkssouveränität, ist jedoch sachlich gerechtfertigt und berührt im Ergebnis nicht den verfassungsrechtlichen Identitätskern. Die unabhängige Aufgabenwahrnehmung soll der Effektivität und dem Schutz vor ungebührlicher politischer Einflussnahme und Einmischungen der Wirtschaft dienen. Sie macht eine parlamentarische Kontrolle der deutschen Aufsichtsbehörden im Übrigen nicht unmöglich: Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und die Deutsche Bundesbank verfügen jeweils unverändert über eine organisatorisch-personelle und sachlich-inhaltliche demokratische Legitimation. Diese wird durch Rechtsschutzmöglichkeiten und besondere Informationsrechte zumindest so abgesichert, dass der Deutsche Bundestag gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern für ihre Tätigkeit verantwortlich bleibt.
2. Auch die SRM-Verordnung stellt keinen Ultra-vires-Akt dar und hält im Ergebnis der verfassungsgerichtlichen Identitätskontrolle stand.
a) Errichtung und Kompetenzausstattung des Ausschusses stellen keine hinreichend qualifizierte Überschreitung der der Europäischen Union nach Art. 114 Abs. 1 AEUV zugewiesenen Kompetenzen dar. Auch wenn diese im Hinblick auf das Prinzip der begrenzten Einzelermächtigung bedenklich erscheint, so genügen Gründung und Kompetenzausstattung des Ausschusses doch den in der Rechtsprechung des EuGH entwickelten Kriterien. Jedenfalls bei strikter Beachtung der zugewiesenen Aufgaben und Befugnisse fehlt es an einem offensichtlichen und strukturell bedeutsamen Verstoß gegen Art. 114 Abs. 1 AEUV.
b) Die von der SRM-Verordnung angeordnete Unabhängigkeit sowohl des Abwicklungsausschusses als auch der BaFin bei der Wahrnehmung entsprechender Aufgaben verstößt angesichts der vorhandenen Kompensationsmaßnahmen nicht gegen Art. 20 Abs. 1 und Abs. 2 in Verbindung mit Art. 79 Abs. 3 GG.
aa) Auch hier steht die Errichtung unabhängiger Einrichtungen und sonstiger Stellen der Europäischen Union in einem Spannungsverhältnis zum Demokratiegebot, auch hier bedarf sie einer spezifischen Rechtfertigung und der Sicherstellung, dass die Mitgliedstaaten und Organe der Europäischen Union in der Lage sind, deren Handeln demokratisch zu verantworten und die diesbezüglichen Rechtsgrundlagen gegebenenfalls anzupassen, zu ändern oder aufzuheben.
Das Verfahren zur Ernennung der Mitglieder des bei der Aufgabenwahrnehmung unabhängig handelnden Ausschusses, die ihm auferlegten Rechenschaftspflichten und die Unterwerfung unter eine umfassende verwaltungsinterne wie gerichtliche Kontrolle stellen eine hinreichende demokratische Steuerbarkeit sicher.
bb) Soweit die SRM-Verordnung auch die nationalen Abwicklungsbehörden beim Vollzug des SRM für unabhängig erklärt, liegt darin eine weitere Absenkung des demokratischen Legitimationsniveaus. Dies wird jedoch durch Transparenzanforderungen sowie Berichts- und Rechenschaftspflichten gegenüber den nationalen Parlamenten ein Stück weit ausgeglichen. Auch die gerichtliche Kontrolle trägt zur demokratischen Legitimation der von der BaFin erlassenen Maßnahmen bei. Der Rechtsschutz muss jedoch den Erfordernissen des Art. 19 Abs. 4 GG gerecht werden.
Eine Berührung des Grundsatzes der Volkssouveränität lässt sich vermeiden, wenn die einzelnen Vorkehrungen im Lichte des Demokratieprinzips ausgelegt und angewandt und die Möglichkeiten für eine demokratische Rückkoppelung an den Deutschen Bundestag ausgeschöpft werden.
c) Die haushaltspolitische Gesamtverantwortung des Deutschen Bundestages wird durch die Bankenabgabe nicht in verfassungsrechtlich relevanter Weise beeinträchtigt. Eine offensichtliche Überschreitung der Binnenmarktharmonisierungskompetenz des Art. 114 Abs. 1 AEUV durch Vorgaben der SRM-Verordnung liegt nicht vor.
aa) Mit Hilfe des in Art. 67 SRM-VO geregelten Fonds soll eine Inanspruchnahme von Steuergeldern zur Abwicklung von Finanzinstituten für die Zukunft ausgeschlossen und eine gemeinschaftliche Haftung der Finanzinstitute in den teilnehmenden Mitgliedstaaten etabliert werden, die die Finanzierung einer Abwicklung auch in den Fällen sicherstellen soll, in denen die Heranziehung der Eigentümer und Gläubiger nicht genügt. Eine Haftung der teilnehmenden Mitgliedstaaten wird hierdurch nicht begründet. Der Fonds unterstützt den einheitlichen Abwicklungsmechanismus und ermöglicht es ihm, im Ausnahmefall Abwicklungsmaßnahmen zu finanzieren. Er soll insbesondere dazu beitragen, eine einheitliche Verwaltungspraxis bei der Abwicklungsfinanzierung sicherzustellen sowie Wettbewerbsverzerrungen im Binnenmarkt vorbeugen.
bb) Unabhängig davon, dass die Bankenabgabe nicht im Eigenmittelbeschluss geregelt ist und primärrechtlich daher fragwürdig sein mag, ist unter dem Blickwinkel von Art. 23 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 20 Abs. 1 und Abs. 2 in Verbindung mit Art. 79 Abs. 3 GG entscheidend, dass ihre Erhebung nicht auf der SRM-Verordnung, sondern auf dem deutschen Restrukturierungsfondsgesetz beruht. Die Übertragung des Aufkommens der Bankenabgabe auf den Fonds erfolgt ebenfalls nicht auf der Grundlage der SRM-Verordnung, sondern auf der Basis des zwischenstaatlichen Übereinkommens vom 21. Mai 2014 über die Übertragung von Beiträgen auf den einheitlichen Abwicklungsfonds und über die gemeinsame Nutzung dieser Beiträge. Ein Verstoß gegen das Integrationsprogramm liegt daher ebenso fern wie eine Berührung der haushaltspolitischen Gesamtverantwortung des Deutschen Bundestages.
3. Das SSM-VO-Gesetz ist vor diesem Hintergrund verfassungsrechtlich nicht zu beanstanden. Der Deutsche Bundestag hat mit ihm vielmehr seine Integrationsverantwortung wahrgenommen.
Aus: Ausgabe vom 04.07.2019, Seite 2 / Inland
Geldstrafe aufgehoben
Streit um Informationsrecht
Urteil gegen Ärztin wegen »Werbung« für Abbrüche aufgehoben
Boris Roessler/dpa
Ärztin Kristina Hänel (l., 24.11.2017)
Das Oberlandesgericht Frankfurt am Main hat die Verurteilung der Ärztin Kristina Hänel wegen vermeintlicher »Werbung« für Schwangerschaftsabbrüche aufgehoben. Zu ihren Gunsten sei der im März geänderte Strafrechtsparagraph 219 a anzuwenden, entschied das OLG am Mittwoch. Hänel war zu einer Geldstrafe verurteilt worden, weil sie auf ihrer Homepage über Möglichkeiten des Schwangerschaftsabbruchs informierte. Das OLG verwies den Fall zur erneuten Verhandlung zurück an das Landgericht Gießen. Der Fall der Ärztin hatte bundesweit für Aufsehen gesorgt. Sie wurde verurteilt, weil die Information über Schwangerschaftsabbrüche in Deutschland weitgehend verboten ist. Durch den im März in Kraft getretenen Paragraphen 219 a sollte aber Klarheit darüber geschaffen werden, wann Ärzte, Krankenhäuser und andere Einrichtungen straflos über Schwangerschaftsabbrüche informieren können. Diese Gesetzesänderung muss nach Ansicht des OLG auch im Fall von Hänel berücksichtigt werden. Es lasse sich nicht ausschließen, dass die von ihr veröffentlichten Informationen über Schwangerschaftsabbrüche bei Anwendung des neuen Rechts straflos wären. Darüber soll vor dem Landgericht Gießen nochmals verhandelt werden.
Kristina Hänel selbst wertet die Aufhebung des Urteils allerdings nicht als einen juristischen Erfolg für sich: Sie bedeute eine Zeitverzögerung und »Ehrenrunde auf dem Weg zum Bundesverfassungsgericht«, sagte die Medizinerin am Mittwoch der Deutschen Presseagentur. Sie wolle weiterhin dafür kämpfen, dass der Paragraph 219 a insgesamt auf Verfassungsmäßigkeit geprüft werde. »Wir werden nicht aufgeben, ehe die Informationsfreiheit für Frauen nicht erreicht ist.« In ihrem Prozesstagebuch, aus dem junge Welt im April Auszüge veröffentlichte, hatte Hänel bereits geschrieben »Ich bin Marathonläuferin, ich werde mein Ziel erreichen«.
Im März dieses Jahres wurde der Paragraph ergänzt: Ärztinnen und Ärzte dürfen nun darüber informieren, dass sie Schwangerschaftsabbrüche vornehmen – jedoch nicht über die Methoden. Für weitere Informationen müssen sie ungewollt Schwangere an offizielle Stellen verweisen – Frauen, bei denen die Zeit drängt, da ein Abbruch nur innerhalb der ersten zwölf Wochen straffrei möglich ist. (dpa/jW)
Aus: Ausgabe vom 04.07.2019, Seite 8 / Abgeschrieben
Regierungsbeteiligung abgelehnt
Der Kreisverband von Die Linke in Stuttgart hat am Dienstag anlässlich eines Kreisparteitags den Beschluss gefasst, die Regierungsbeteiligung der Partei in Bremen zu kritisieren. Angenommen wurde der entsprechende entsprechende Antrag des Ortsverbands Bad Cannstatt-Mühlhausen-Münster mit 18 Ja-, zehn Neinstimmen und fünf Enthaltungen.
In Bremen stehen die Zeichen auf Regierungsbeteiligung der Linken in Westdeutschland. Eine Beteiligung der Linken an Regierungen mit den prokapitalistischen neoliberalen Parteien SPD und Grünen diskreditiert die Partei bei Aktivisten. Wir weisen die Ansicht zurück, dass eine Ablehnung einer Regierungsbeteiligung gleichbedeutend damit wäre, die Verantwortung für ein »größeres Übel« in Form einer CDU-geführten Jamaika-Koalition zu übernehmen. Wir fordern die Genossen in Bremen auf, eine Regierungsbeteiligung abzulehnen und die Alternative der Einzelfallunterstützung zu unterstützen.
Begründung: Die Politik der Partei in Bremen hat bundesweite Bedeutung. Führende Vertreter der Partei wie Katja Kipping rühren wieder emsig die Werbetrommel für eine Regierungsbeteiligung auf Bundesebene. Das Mittragen von Maßnahmen in einer Regierung, die im Widerspruch zur Programmatik der Partei stehen, belastet unsere Arbeit bundesweit. Wir erinnern an besonders krasse Fälle wie die Unterstützung für den Klimakiller Braunkohle und die Zustimmung zum Bürgerrechte abbauenden Polizeigesetz in Brandenburg.
Die Europawahlen haben erneut bestätigt, dass Die Linke in Ländern, in denen sie mitregiert, massiv an Stimmen verloren hat, in Thüringen von 22,3 auf 13,8 Prozent (bei der Europawahl 2019, jW) und in Brandenburg von 19,7 auf 12,3 Prozent. In Berlin, das in der Partei als Modell einer Kombination von Regierungsbeteiligung und Beteiligung an außerparlamentarischen Bewegungen und Kombination der Vorteile beider Methoden verkauft wurde, fiel die Partei immerhin von 16,2 auf 11,9 Prozent.
Angesichts des hohen Schuldenstandes in Bremen, der Bekenntnisse der SPD zu einer Fortsetzung der »Sparpolitik« und des zu erwartenden Rückgangs von Steuereinnahmen wegen der Eintrübung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen befürchten wir, dass eine Regierungsbeteiligung die Partei zur Geisel von Kürzungspolitik machen würde. (…)
Zum Anschlag auf den Kommunalpolitiker des Südschleswigschen Wählerverbandes (SSW), Erik Schaller, erklärte Lorenz Gösta Beutin, Bundestagsabgeordneter von Die Linke aus Schleswig-Holstein:
Nicht erst der tödliche Schuss auf Regierungspräsident Lübcke war ein Warnsignal, sondern die ganz alltägliche Gewalt von Rechtsradikalen, unter der Menschen und Demokratie in diesem Land leiden. Der Anschlag auf den Schafflunder SSW-Politiker Erik Schaller zeigt, wie perfide und mit Mordvorsatz Rechtsaußen vorgeht. Seit Jahren, und ein Ende scheint nicht absehbar. Wir müssen den Verbrechern deutlich machen, dass Hass und Hetze keinen Platz haben in unserer Demokratie. Auch wer verbal den Boden bereitet für Anschläge und Überfälle, für Körperverletzung und Mord, muss wissen, dass er sich gegen die gesamte Gesellschaft stellt.
-----------------------------------------------------
Baden-württembergische und hessische Regelungen zur automatisierten Kraftfahrzeugkennzeichenkontrolle in Teilen verfassungswidrig
Pressemitteilung Nr. 9/2019 vom 5. Februar 2019
Beschluss vom 18. Dezember 2018
1 BvR 2795/09, 1 BvR 3187/10
Die polizeirechtlichen Vorschriften zur Kraftfahrzeugkennzeichenkontrolle in Baden-Württemberg und Hessen sind teilweise verfassungswidrig. Dies hat der Erste Senat des Bundesverfassungsgerichts mit heute veröffentlichtem Beschluss unter Zugrundelegung der Maßstäbe aus dem Beschluss vom selben Tag (vgl. dazu Pressemitteilung Nr. 8/2019) entschieden.
Beide Länder können ihre Regelungen der Kennzeichenkontrollen im Wesentlichen auf ihre Gesetzgebungszuständigkeit für die Gefahrenabwehr stützen. Soweit Baden-Württemberg jedoch automatisierte Kennzeichenkontrollen zur Unterstützung von polizeilichen Kontrollstellen und Kontrollbereichen erlaubt, die zur Fahndung nach Straftätern und damit zur Strafverfolgung eingerichtet werden, fehlt es dem Land für die Regelungen schon zur Einrichtung dieser Kontrollstellen und Kontrollbereiche selbst an der Gesetzgebungskompetenz. Dementsprechend ist auch die hieran anknüpfende Kennzeichenkontrolle formell verfassungswidrig. Aus formellen Gründen sind auch die hessischen Regelungen zur automatisierten Kennzeichenkontrolle an polizeilichen Kontrollstellen, die zur Verhütung versammlungsrechtlicher Straftaten eingerichtet sind, sowie wiederum auch die Regelung zur Einrichtung dieser Kontrollstellen selbst verfassungswidrig. Als Eingriffe in Art. 8 GG genügen sie nicht dem Zitiergebot des Art. 19 Abs. 1 Satz 2 GG.
Die Regelungen genügen auch nicht in jeder Hinsicht dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz. In beiden Ländern werden Kennzeichenkontrollen nicht umfassend auf den Schutz von Rechtsgütern von erheblichem Gewicht begrenzt und werden Kennzeichenkontrollen als Mittel der Schleierfahndung ohne eine ausreichend klare grenzbezogene Beschränkung erlaubt. Nicht zu beanstanden sind die Regelungen zum Umfang des Datenabgleichs. Entgegen der Praxis beider Länder sind sie jedoch verfassungskonform einschränkend dahingehend auszulegen, dass der Abgleich jeweils auf die Datensätze zu beschränken ist, die für die Erreichung des konkreten Zwecks der Kennzeichenkontrolle geeignet sind.
Der Senat hat die verfassungswidrigen Vorschriften größtenteils übergangsweise für weiter anwendbar erklärt, längstens jedoch bis zum 31. Dezember 2019.
Sachverhalt:
Die Polizei in Baden-Württemberg und Hessen wird mit den angegriffenen Vorschriften dazu ermächtigt, durch den Einsatz von Kennzeichenlesesystemen verdeckt die Kennzeichen von Kraftfahrzeugen zu erfassen und diese mit zur Fahndung ausgeschriebenen Kennzeichen abzugleichen (vgl. näher Pressemitteilung Nr. 8/2019 vom selben Tag zur entsprechenden Regelung in Bayern). Anders als nach der Verwaltungspraxis in Bayern wird bei Erstellung der Abgleichdatei in Baden-Württemberg und Hessen nicht nach dem Zweck der Kennzeichenkontrolle unterschieden, so dass der zum Abgleich herangezogene Datenbestand, der seine Grundlage insbesondere in den Sachfahndungsdaten des Schengener Informationssystems hat, nicht je nach Zweck der Aufstellung des Kennzeichenlesesystems variiert.
Die Beschwerdeführer wenden sich mit ihrer Verfassungsbeschwerde unmittelbar gegen die Regelungen der Kennzeichenkontrolle in den jeweiligen Landespolizeigesetzen selbst (Rechtssatzverfassungsbeschwerde). Sie seien Halter von Personenkraftwagen, mit denen sie regelmäßig auf den Straßen von Baden-Württemberg und Hessen unterwegs sind, und würden deshalb mit erheblicher Wahrscheinlichkeit unbemerkt in solche Kennzeichenkontrolle geraten. In diesen liege ein Eingriff in ihr Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung. Eine Rechtfertigung dieser Grundrechtseingriffe scheide aus, da die gesetzlichen Grundlagen der Kennzeichenkontrolle formell verfassungswidrig seien und gegen die verfassungsrechtlichen Grundsätze der Bestimmtheit und Verhältnismäßigkeit verstießen.
Wesentliche Erwägungen des Senats:
I. Die Rechtssatzverfassungsbeschwerden sind zulässig, auch wenn die Beschwerdeführer zuvor nicht den fachgerichtlichen Rechtsweg erschöpft haben.
Nach dem Subsidiaritätsgrundsatz sind Beschwerdeführer grundsätzlich dazu verpflichtet, alle Mittel zu ergreifen, die der geltend gemachten Grundrechtsverletzung abhelfen könnten. Dazu kann bei Verfassungsbeschwerden unmittelbar gegen ein Gesetz auch die Erhebung einer Feststellungs- oder Unterlassungsklage gehören. Das ist auch dann nicht ausgeschlossen, wenn die fachgerichtliche Prüfung für den Beschwerdeführer günstigstenfalls dazu führen kann, dass das angegriffene Gesetz gemäß Art. 100 Abs. 1 GG dem Bundesverfassungsgericht vorgelegt wird. Entscheidend ist, ob die fachgerichtliche Klärung erforderlich ist, um zu vermeiden, dass das Bundesverfassungsgericht seine Entscheidungen auf ungesicherter Tatsachen- und Rechtsgrundlage trifft. Die Pflicht zur vorherigen Anrufung der Fachgerichte darf Beschwerdeführer dabei aber nicht vor unabsehbare Risiken hinsichtlich der ihnen zu Gebote stehenden Handlungsmöglichkeiten und der hierbei zu beachtenden Fristen stellen. Es bedarf insoweit einer rechtsschutzfreundlichen Auslegung.
Grundsätzlich waren die Beschwerdeführer danach verpflichtet, zunächst Unterlassungsklagen gegen die Kennzeichenkontrollen vor den Fachgerichten einzulegen. Dies war ihnen vorliegend jedoch nicht zumutbar, da in der letzten Entscheidung des Ersten Senats zu dem gleichen Thema bei gleicher prozessualer Ausgangslage die Möglichkeit einer Unterlassungsklage noch nicht einmal in Erwägung gezogen wurde. Hinzu kommt, dass inzwischen über den Kern des Beschwerdevorbringens von den Fachgerichten bis hin zum Bundesverwaltungsgericht entschieden wurde und eine Verweisung der Beschwerdeführer auf den Rechtsweg die Entscheidungsgrundlagen für die Beurteilung der Vorschriften heute daher nicht mehr verbreitern könnte.
II. Die Verfassungsbeschwerden sind zudem teilweise begründet.
1. Die Regelungen zur Kraftfahrzeugkennzeichenkontrolle greifen nach den Maßstäben, die der Senat in seinem ebenfalls heute veröffentlichten Beschluss zu entsprechenden Vorschriften des Freistaats Bayerns entwickelt hat, in das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung aus Art. 2 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 1 Abs. 1 GG ein (vgl. dazu Pressemitteilung Nr. 8/2019).
2. Hinsichtlich der Vereinbarkeit der angegriffenen Normen mit den formellen Anforderungen der Verfassung bestehen weithin keine Bedenken. Die Regelungen zur Kennzeichenkontrolle in beiden Ländern sind überwiegend der Gefahrenabwehr zuzuordnen, für welche die Länder die Gesetzgebungskompetenz innehaben.
Aus formellen Gründen nicht mit der Verfassung vereinbar ist jedoch, dass in Baden-Württemberg automatisierte Kennzeichenkontrollen zur Unterstützung von polizeilichen Kontrollstellen oder Kontrollbereichen zur Fahndung nach Straftätern vorgesehen sind. Hier fehlt dem Land schon für die Bestimmungen, die die Einrichtung solcher Kontrollstellen und -bereiche selbst regeln, die Gesetzgebungskompetenz. Es handelt sich um Regelungen zur Strafverfolgung, für die der Bund die konkurrierende Gesetzgebungskompetenz hat und von der er auch abschließend Gebrauch gemacht hat. Entsprechend ist die Regelung der Kennzeichenkontrolle, die als tatbestandliche Voraussetzung auf diese Regelung verweist, verfassungswidrig. Es fehlt insoweit an einer hinreichend bestimmten und begrenzenden Anknüpfung für die Kennzeichenerfassung.
Formell nicht mit der Verfassung vereinbar sind auch die hessischen Regelungen zu automatisierten Kennzeichenkontrollen, soweit sie zur Unterstützung von polizeilichen Kontrollstellen zur Verhinderung von versammlungsrechtlichen Straftaten dienen, sowie wiederum auch die Regelung zur Einrichtung solcher Kontrollstellen selbst. Der Gesetzgeber darf solche Kontrollen zwar vorsehen. Weil in ihnen jedoch ein Eingriff in die Versammlungsfreiheit des Art. 8 GG liegt, muss das Gesetz das Grundrecht unter Angabe dessen Artikels nennen (sogenanntes Zitiergebot, vgl. Art. 19 Abs. 1 Satz 2 GG). Dem genügen die angegriffenen Vorschriften nicht.
3. In materieller Hinsicht sind die angegriffenen Vorschriften mit den aus dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz folgenden Anforderungen nicht in jeder Hinsicht vereinbar. Der Senat greift hierfür auf seine Maßstäbe für polizeiliche Kontrollen zurück, die er im ebenfalls heute veröffentlichten Beschluss zu entsprechenden Regelungen in Bayern ausgeführt hat (vgl. dazu Pressemitteilung Nr. 8/2019).
a) Den Regelungen der Kennzeichenkontrolle in Baden-Württemberg und Hessen fehlt es hinsichtlich der tatbestandlichen Voraussetzung der allgemeinen Abwehr einer Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung an einer Beschränkung auf den Schutz von Rechtsgütern von zumindest erheblichem Gewicht oder einem vergleichbar gewichtigen öffentlichen Interesse.
b) Soweit die Kennzeichenkontrolle als Mittel der Schleierfahndung erlaubt wird, stellen die Regelungen beider Länder nicht sicher, dass derartige Kontrollen nur an Orten mit einem hinreichend klaren Grenzbezug erfolgen dürfen. Indem die Schleierfahndung in Baden-Württemberg allgemein auf Straßen von erheblicher Bedeutung für die grenzüberschreitende Kriminalität im ganzen Land eröffnet wird, ist der Grenzbezug für automatisierte Kennzeichenkontrollen nicht hinreichend bestimmt und begrenzt. Diesen Anforderungen werden auch die hessischen Regelungen nicht gerecht, soweit sie die Schleierfahndung auf allen Straßen im ganzen Land zur Bekämpfung der grenzüberschreitenden Kriminalität eröffnen.
c) Im Übrigen sind die gesetzlichen Voraussetzungen für die Durchführung der Kennzeichenkontrolle in beiden Ländern, die sich wesentlich aus einem Verweis auf die Regelungen zur Identitätsfeststellung ergeben, verfassungsrechtlich weder hinsichtlich der Anforderungen an einen hinreichend bestimmten konkreten Anlass noch hinsichtlich der Anforderungen an einen hinreichend gewichtigen Rechtsgüterschutz zu beanstanden. Dies gilt für die Ermächtigung zur Kontrolle an gefährlichen und gefährdeten Orten, zum Schutz besonders gefährdeter Personen sowie zur Unterstützung polizeilicher Kontrollstellen zur Verhütung besonders schwerer Straftaten, wenn bereits die Einrichtung derartiger Kontrollstellen eine konkrete Gefahr voraussetzt.
d) Einer einschränkenden verfassungskonformen Auslegung bedürfen allerdings die Regelungen zum Datenabgleich. Sie müssen so verstanden werden, dass sich der Umfang des erlaubten Datenabgleichs jeweils auf diejenigen Fahndungsbestände beschränkt, die für den konkreten Zweck der Kennzeichenkontrolle von Bedeutung sind. Das in den Verfahren zum Ausdruck gekommene gegenläufige Verständnis in der Praxis genügt diesen Anforderungen nicht.
e) Die Vorschriften zur Verwendung der Daten für weitere Zwecke entsprechen den verfassungsrechtlichen Anforderungen an eine Zweckänderung nicht. Nach dem Kriterium der Datenneuerhebung ist die Verwendung der Informationen nur zulässig, wenn diese auch für den geänderten Zweck mit vergleichbar schwerwiegenden Mitteln neu erhoben werden dürften. Dies stellen weder die baden-württembergischen noch die hessischen Regelungen ausreichend sicher.
Automatisierte Kraftfahrzeugkennzeichenkontrollen nach dem Bayerischen Polizeiaufgabengesetz in Teilen verfassungswidrig
Pressemitteilung Nr. 8/2019 vom 5. Februar 2019
Beschluss vom 18. Dezember 2018
1 BvR
142/15
Mit heute veröffentlichtem Beschluss hat der Erste Senat des Bundesverfassungsgerichts die automatisierte Kraftfahrzeugkennzeichenkontrolle nach dem Bayerischen Polizeiaufgabengesetz als Verstoß gegen das Recht auf informationelle Selbstbestimmung in Teilen für verfassungswidrig erklärt. In solchen Kontrollen liegen Grundrechtseingriffe gegenüber allen Personen, deren Kraftfahrzeugkennzeichen erfasst und abgeglichen werden, unabhängig davon, ob die Kontrolle zu einem Treffer führt (Änderung der Rechtsprechung). Diese Eingriffe sind nur teilweise gerechtfertigt.
Hinsichtlich der angegriffenen Vorschriften steht dem Freistaat Bayern überwiegend die Gesetzgebungskompetenz zu. Die Regelung von Kennzeichenkontrollen, die als Mittel der Gefahrenabwehr ausgestaltet sind, liegt bei den Ländern, auch wenn sie im Ergebnis zugleich der Strafverfolgung nutzen, für die der Bund eine konkurrierende Gesetzgebungskompetenz hat. Kompetenzwidrig sind die bayerischen Regelungen jedoch, soweit sie Kennzeichenkontrollen unmittelbar zum Grenzschutz erlauben.
Kennzeichenkontrollen bedürfen nach dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit grundsätzlich eines hinreichend gewichtigen Anlasses. Dem genügen die Vorschriften nicht, soweit die Kontrollen nicht auf den Schutz von Rechtsgütern von zumindest erheblichem Gewicht beschränkt sind und als Mittel der Schleierfahndung keinen hinreichend bestimmten Grenzbezug aufweisen. Soweit sie automatisierte Kennzeichenkontrollen zur Unterstützung von polizeilichen Kontrollstellen erlauben, ist das nicht zu beanstanden, weil die Einrichtung solcher Kontrollstellen bei verständiger Auslegung eine konkrete Gefahr und damit selbst einen rechtfertigenden Anlass voraussetzt. Die Vorschriften zum Abgleich der erfassten Kennzeichen müssen verfassungskonform einschränkend so ausgelegt werden, dass jeweils nur die Fahndungsbestände zum Abgleich herangezogen werden dürfen, die zur Abwehr der Gefahr geeignet sind, die Anlass der jeweiligen Kennzeichenkontrolle ist. Im Übrigen fehlt es den Regelungen an einer Pflicht zur Dokumentation der Entscheidungsgrundlagen.
Der Senat hat die verfassungswidrigen Vorschriften größtenteils übergangsweise für weiter anwendbar erklärt, längstens jedoch bis zum 31. Dezember 2019.
Sachverhalt:
In Bayern ist die Polizei dazu ermächtigt, automatisierte Kraftfahrzeugkennzeichenkontrollen durchzuführen. Dabei wird das Kennzeichen eines vorbeifahrenden Kraftfahrzeugs verdeckt von einem Kennzeichenlesesystem automatisiert erfasst, kurzzeitig gemeinsam mit Angaben zu Ort, Datum, Uhrzeit und Fahrtrichtung gespeichert und mit Kennzeichen aus dem Fahndungsbestand abgeglichen. Für den Abgleich wird eine eigene Abgleichdatei erstellt, die nach der bayerischen Praxis nur Kennzeichen enthält, die für den Zweck der jeweiligen Kennzeichenkontrolle zusammengestellt werden. Ergibt der Abgleich des Kennzeichens keinen Treffer, wird der Datensatz mit-samt dem erfassten Kennzeichen unverzüglich und automatisch vom Computer gelöscht (Nichttreffer). Sofern das Kennzeichenlesesystem einen Treffer meldet, überprüft ein Polizeibeamter an einem Computerbildschirm visuell, ob das aufgenommene Bild des Kennzeichens mit dem Kennzeichen aus dem Fahndungsbestand übereinstimmt. Ist dies beispielsweise wegen einer fehlerhaften Ablesung des Kennzeichens nicht der Fall (unechter Treffer), wird der gesamte Vorgang durch den Polizeibeamten manuell gelöscht. Bei einer Übereinstimmung (echter Treffer) werden die Daten gespeichert und gegebenenfalls weitere polizeiliche Maßnahmen eingeleitet.
Der Beschwerdeführer, der seinen Hauptwohnsitz in Bayern und einen weiteren Wohnsitz in Österreich hat, ist Halter eines auf ihn zugelassenen Kraftfahrzeugs, mit dem er zwischen seinen Wohnsitzen pendelt und auf Bundesautobahnen in Bayern unterwegs ist. Er befürchtete, in die durch das Gesetz ermöglichten Kennzeichenkontrollen zu geraten, und beantragte deshalb beim Verwaltungsgericht, den Freistaat Bayern zu verurteilen, es zu unterlassen, Kennzeichen von seinen Kraftfahrzeugen mit dem Kennzeichenlesesystem zu erfassen und mit den polizeilichen Daten abzugleichen. Mittelbar wendete er sich damit gegen die Normen zur Kennzeichenkontrolle selbst.
Das Verwaltungsgericht und der Bayerische Verwaltungsgerichtshof hielten die Unterlassungsklage für zulässig, aber unbegründet. Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof entschied, dass im Fall eines Nichttreffers allerdings schon kein Grundrechtseingriff vorliege, da die Daten unverzüglich und automatisiert gelöscht würden. Es bestehe aber die hinreichende Wahrscheinlichkeit, dass es zu einem unechten Treffer komme, der einen Eingriff in das informationelle Selbstbestimmungsrecht begründe. Dieser Eingriff finde jedoch durch die Vorschriften zur Kennzeichenkontrolle eine verfassungsgemäße gesetzliche Grundlage.
Das Bundesverwaltungsgericht wies die Revision des Beschwerdeführers zurück. Die Klage sei unbegründet. Wie der Nichttreffer sei auch der unechte Treffer nicht als Grundrechtseingriff zu beurteilen. Bei einem unechten Treffer nehme der Polizeibeamte das Kennzeichen nur wahr, um den unvollkommenen Lesemodus des Systems zu korrigieren, indem er vom Kennzeichenlesesystem fehlerhaft als Treffer gemeldete Kennzeichen unverzüglich lösche. Zu einem echten Treffer könne es im Fall des Beschwerdeführers nicht kommen, da sein Kraftfahrzeugkennzeichen in keinem Fahndungsbestand gespeichert sei. Da das Bundesverwaltungsgericht damit einen Eingriff in die Grundrechte des Beschwerdeführers ausschloss, kam es auf die Verfassungsmäßigkeit der mittelbar angegriffenen Vorschriften nicht an und musste es sie in der Sache nicht prüfen.
Der Beschwerdeführer macht mit seiner Verfassungsbeschwerde geltend, durch die Entscheidungen in seinem Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung aus Art. 2 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 1 Abs. 1 GG verletzt zu sein. Die Gerichte hätten den Umfang des Schutzbereichs des Rechts auf informationelle Selbstbestimmung verkannt, indem sie in Fällen des Nichttreffers und des unechten Treffers keinen Grundrechtseingriff angenommen hätten. Ein Grundrechtseingriff liege bereits darin, von einer Kennzeichenkontrolle erfasst zu werden. Die diesbezüglichen Rechtsgrundlagen seien formell verfassungswidrig, da es sich nicht um Regelungen der Gefahrenabwehr, sondern der Strafverfolgung handle, für die der Bund zuständig sei. Ferner verstießen die Rechtsgrundlagen zur Kennzeichenkontrolle gegen die verfassungsrechtlichen Gebote der Bestimmtheit und der Verhältnismäßigkeit.
Wesentliche Erwägungen des Senats:
I. Die Verfassungsbeschwerde ist zulässig, aber nur teilweise begründet. Die angegriffenen Entscheidungen verletzen den Beschwerdeführer in seinem Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung aus Art. 2 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 1 Abs. 1 GG.
II. Das Recht auf informationelle Selbstbestimmung trägt Gefährdungen und Verletzungen der Persönlichkeit Rechnung, die sich für den einzelnen, insbesondere unter den Bedingungen moderner Datenverarbeitung, aus informationsbezogenen Maßnahmen ergeben. Der Schutzumfang beginnt bereits auf der Stufe der Gefährdung des Persönlichkeitsrechts. Umfasst sind alle personenbezogenen Daten unabhängig davon, ob sie für sich genommen nur einen geringen Informationsgehalt haben, sensibel oder öffentlich zugänglich sind. Insofern gibt es unter den Bedingungen der elektronischen Datenverarbeitung kein schlechthin belangloses personenbezogenes Datum.
Grundrechtseingriff
III. Die Kennzeichenkontrolle greift jeweils durch die Erfassung der Kennzeichen, den Abgleich und die darauffolgende Verwendung der Daten in das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung ein. Ein Eingriff liegt auch im Falle eines unechten Treffers und eines Nichttreffers vor. Soweit dem die Entscheidung des Senats vom 11. März 2008 (BVerfGE 120, 378) entgegensteht, wird daran nicht festgehalten.
Allerdings fehlt es nach der Rechtsprechung des Senats an einer Eingriffsqualität, sofern Daten ungezielt und allein technikbedingt zunächst miterfasst, aber unmittelbar nach der Erfassung technisch wieder anonym, spurenlos und ohne Erkenntnisinteresse für die Behörden ausgesondert werden. Hieran wird festgehalten. Maßgeblich ist, ob sich bei einer Gesamtbetrachtung mit Blick auf den durch den Überwachungs- und Verwendungszweck bestimmten Zusammenhang das behördliche Interesse an den betroffenen Daten bereits derart verdichtet hat, dass ein Betroffensein in einer einen Grundrechtseingriff auslösenden Qualität zu bejahen ist.
Dies ist bei einer Kennzeichenkontrolle jedoch gegenüber allen erfassten Personen der Fall. Die Einbeziehung der Daten auch von Personen, deren Abgleich letztlich zu Nichttreffern führt, erfolgt nicht ungezielt und allein technikbedingt, sondern ist notwendiger und gewollter Teil der Kontrolle und gibt ihr als Fahndungsmaßnahme erst ihren Sinn. Dem steht nicht entgegen, dass den Betroffenen im Nichttrefferfall weder Unannehmlichkeiten noch Konsequenzen erwachsen. Denn das ändert nichts daran, dass die Betroffenen überprüft werden, ob sie behördlich gesucht werden und ihre ungehinderte Weiterfahrt unter den Vorbehalt gestellt wird, dass Erkenntnisse gegen sie nicht vorliegen. Eine solche Maßnahme ist nicht erst hinsichtlich ihrer Folgen, sondern als solche freiheitsbeeinträchtigend. Zur Freiheitlichkeit des Gemeinwesens gehört es, dass sich die Bürgerinnen und Bürger grundsätzlich fortbewegen können, ohne dabei beliebig staatlich registriert zu werden, hinsichtlich ihrer Rechtschaffenheit Rechenschaft ablegen zu müssen und dem Gefühl eines ständigen Überwachtwerdens ausgesetzt zu sein.
Formelle Verfassungsmäßigkeit
IV. In formeller Hinsicht sind die angegriffenen Normen überwiegend mit der Verfassung vereinbar. Da die Regelungen der Gefahrenabwehr zuzuordnen sind, liegt die Gesetzgebungskompetenz bei den Ländern. Insbesondere handelt es sich bei den bayerischen Regelungen zur Kennzeichenkontrolle nicht um Regelungen der Strafverfolgung, für die der Bund eine konkurrierende Gesetzgebungskompetenz hat. Für die Abgrenzung zwischen Regelungen zur Gefahrenabwehr und zur Strafverfolgung kommt es auf eine genaue Bestimmung des Zwecks der Normen an. Die Kennzeichenkontrolle in Bayern ist nur in Fällen erlaubt, in denen eine Identitätsfeststellung zulässig ist und ist dabei auf die Gefahrenabwehr gerichtet. Die Kennzeichenkontrolle dient in Anknüpfung hieran der Abwehr von im Einzelfall auftretenden Gefahren, der Bekämpfung der Herausbildung und Verfestigung gefährlicher Orte, dem Schutz von gefährdeten Orten, der Unterstützung von polizeilichen Kontrollstellen sowie der Bekämpfung grenzüberschreitender Kriminalität oder der Verhütung oder Unterbindung des unerlaubten Aufenthalts mittels der Schleierfahndung. Darüber hinaus liegt es auch in der Gesetzgebungskompetenz der Länder, die weitere Nutzung der Daten im Wege der Zweckänderung für andere Zwecke zu regeln. Denn hierin liegt noch keine abschließende Entscheidung, sondern nur eine Öffnung, die weitere gesetzliche Regelungen erfordert.
Dem Freistaat Bayern fehlt allerdings die Gesetzgebungskompetenz, soweit durch einen Verweis auf Art. 13 Abs. 1 Nr. 5 des Bayerischen Polizeiaufgabengesetzes (BayPAG) die Kennzeichenkontrolle zur Verhütung oder Unterbindung der unerlaubten Überschreitung der Landesgrenze erlaubt ist. Diese Variante der Vorschrift ist eine Frage des Grenzschutzes, für die gemäß Art. 73 Abs. 1 Nr. 5 GG ausschließlich der Bund die Gesetzgebungskompetenz innehat. Der Einsatz der Kennzeichenkontrollen zur Verhütung oder Unterbindung des unerlaubten Aufenthalts und zur Bekämpfung der grenzüberschreitenden Kriminalität, wie er nach den beiden anderen Varianten des Art. 13 Abs. 1 Nr. 5 BayPAG erlaubt ist, unterliegt keinen kompetenzrechtlichen Bedenken, da es sich um Regelungen der Gefahrenabwehr handelt.
Materielle Verfassungsmäßigkeit
V. Im Hinblick auf die materielle Verfassungsmäßigkeit ergeben sich Maßgaben zur Regelung von Kennzeichenkontrollen aus dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz.
1. Polizeiliche Kontrollen zur gezielten Suche nach Personen oder Sachen im öffentlichen Raum setzen danach grundsätzlich einen objektiv bestimmten und begrenzten Anlass voraus. Die Durchführung von Kontrollen zu beliebiger Zeit und an beliebigem Ort ins Blaue hinein ist mit dem Rechtsstaatsprinzip grundsätzlich unvereinbar. Der Gesetzgeber hat eine Eingriffsschwelle vorzugeben, durch die das staatliche Handeln an vorhersehbare und kontrollierbare Voraussetzungen gebunden wird. Dies können einzelne Gefahren, typisierte Gefahrenlagen oder auch Situationen sein, in denen eine spezifisch gesteigerte Wahrscheinlichkeit besteht, gesuchte Personen oder Sachen aufzufinden. Es muss diesbezüglich aber stets ein auf einer hinreichenden Tatsachenbasis beruhender rechtfertigender Grund vorliegen. Abzugrenzen ist dies von Konstellationen, in denen polizeiliche Kontrollen – anders als hier ‑ an ein gefährliches oder risikobehaftetes Tun anknüpfen wie etwa bei Verkehrskontrollen oder in weiten Bereichen etwa des Umwelt- oder Wirtschaftsverwaltungsrechts. Dort können auch anlasslose Kontrollen verfassungsrechtlich gerechtfertigt sein.
2. Kennzeichenkontrollen müssen weiterhin durch einen im Verhältnis zum Grundrechtseingriff hinreichend gewichtigen Rechtsgüterschutz gerechtfertigt sein. Angesichts ihres Eingriffsgewichts müssen automatisierte Kennzeichenkontrollen danach dem Schutz von Rechtsgütern von zumindest erheblichem Gewicht oder sonst einem vergleichbar gewichtigen öffentlichen Interesse dienen. Hierzu zählen zunächst Leib, Leben und Freiheit der Person und der Bestand und die Sicherheit des Bundes und der Länder. Darüber hinaus kommen aber auch Rechtsgüter wie der Schutz von nicht unerheblichen Sachwerten in Betracht. Der Gesetzgeber kann die Schwelle im einzelnen näher konkretisieren.
3. Schließlich muss sich die gesetzliche Ausgestaltung der Kennzeichenkontrolle in einer Gesamtabwägung als zumutbar im Hinblick auf das Recht auf informationelle Selbstbestimmung erweisen. Im Übrigen müssen die Anforderungen an Transparenz, individuellen Rechtsschutz und aufsichtsrechtliche Kontrolle erfüllt werden sowie Regelungen zur Datennutzung und -löschung getroffen sein.
VI. Die angegriffenen Vorschriften genügen diesen Anforderungen nicht in jeder Hinsicht.
1. Soweit das Gesetz die Kennzeichenkontrolle allgemein zur Abwehr einer konkreten Gefahr vorsieht, mangelt es der Regelung an einer Beschränkung auf den Schutz von Rechtsgütern von zumindest erheblichem Gewicht oder einem vergleichbar gewichtigen öffentlichen Interesse.
2. Verfassungsrechtlich nicht zu beanstanden ist – sofern die Vorschriften im Lichte der Verfassung ausgelegt und angewendet werden – die Ermächtigung zu Kennzeichenkontrollen an gefährlichen und gefährdeten Orten.
3. Soweit Kennzeichenkontrollen an polizeilichen Kontrollstellen erlaubt werden, ist das verfassungskonform, weil die gesetzliche Regelung zur Einrichtung der Kontrollstelle ihrerseits bei verständiger Auslegung so zu verstehen ist, dass sie eine konkrete Gefahr voraussetzt. Damit fehlt es nicht an einem hinreichend konkreten Anlass. Dieser Anlass hat auch hinreichendes Gewicht. Kontrollstellen dürfen nach der angegriffenen Bestimmung nur zur Verhinderung schwerer Straftaten oder bestimmter versammlungsrechtlicher Straftaten eingerichtet werden; es handelt sich folglich um den Schutz von Rechtsgütern von erheblichem Gewicht. Soweit der Zugang zu einer Versammlung kontrolliert wird, greift die Regelung zwar zusätzlich auch in die Versammlungsfreiheit nach Art. 8 GG ein; sie genügt aber auch insoweit den verfassungsrechtlichen Anforderungen.
4. Die automatisierte Kennzeichenkontrolle ist auch als Mittel der Schleierfahndung grundsätzlich mit der Verfassung vereinbar. Zwar handelt es sich um eine Befugnis, die allein final durch eine weit gefasste Zwecksetzung definiert ist und mangels näheren Anlasses in dieser Weite grundsätzlich mit verfassungsrechtlichen Anforderungen nicht vereinbar ist. Ihre Rechtfertigung ergibt sich hier aber aus den besonderen Bedingungen des Wegfalls der innereuropäischen Grenzkontrollen, für die sie zur Gewährleistung von Sicherheit einen Ausgleich darstellt. Erforderlich ist dafür aber eine hieran orientierte konsequente und klare Begrenzung der Zwecke und Orte solcher Kontrollen. Die angegriffenen Vorschriften genügen diesen Anforderungen nicht vollständig. Verfassungsrechtlich unbedenklich ist die Regelung, soweit die Kennzeichenkontrollen in einem Grenzgebiet bis zu einer Tiefe von 30 km oder an öffentlichen Einrichtungen des internationalen Verkehrs durchgeführt werden dürfen. Die Befugnis zu Kontrollen allgemein auf Durchgangsstraßen im ganzen Land ist demgegenüber nicht hinreichend bestimmt und begrenzt und weist nicht den erforderlichen klaren Grenzbezug auf. Für die Beurteilung der Vorschriften als verhältnismäßig fallen überdies die einschränkenden Maßgaben des Unionsrechts ins Gewicht, denen der Gesetzgeber nach dem Stand der fachgerichtlichen Rechtsprechung noch Rechnung zu tragen hat.
5. Die angegriffenen Vorschriften genügen ferner im Wesentlichen den Maßgaben an Transparenz, individuellen Rechtsschutz und aufsichtsrechtliche Kontrolle. Verfassungsrechtlich zu beanstanden ist jedoch, dass das Gesetz keine Pflicht zur Dokumentation der Entscheidungsgrundlagen für den Einsatz der verdeckt erfolgenden automatisierten Kennzeichenkontrollen vorsieht. Eine Dokumentationspflicht befördert die Selbstkontrolle, ermöglicht die Aufsicht durch den Landesdatenschutzbeauftragten und erleichtert die verwaltungsgerichtliche Kontrolle.
6. Für den Kennzeichenabgleich dürfen bei verfassungskonformer Auslegung nicht alle im Gesetz insgesamt zum Abgleich eröffneten Fahndungsbestände herangezogen werden, sondern jeweils nur diejenigen Datensätze, die für den konkreten Zweck der Kennzeichenkontrolle Bedeutung haben können. Bei Zugrundelegung dieser Auslegung sind die angegriffenen Vorschriften zum Datenabgleich verfassungsrechtlich nicht zu beanstanden. Unter dem Gesichtspunkt der Bestimmtheit genügt die durch die angegriffenen Bestimmungen erfolgte abstrakte Umschreibung der zum Abgleich eröffneten Fahndungsbestände verfassungsrechtlichen Anforderungen.
7. Soweit das Gesetz eine Verwendung der Daten für weitere Zwecke als denen, die den Anlass der Kontrolle bildeten, erlaubt und damit insbesondere auch die Verwertung von Zufallserkenntnissen eröffnet, genügt die Regelung den verfassungsrechtlichen Anforderungen nicht vollständig. Nach verfassungsrechtlichen Maßstäben ist eine Zweckänderung allerdings grundsätzlich zulässig. Die entsprechenden Daten müssten aber neu auch für den geänderten Zweck mit vergleichbar schwerwiegenden Ermittlungsmaßnahmen erhoben werden dürfen. Eine weitere Nutzung ist daher nur zulässig, wenn sie dem Schutz von Rechtsgütern dient, die auch die Durchführung einer Kraftfahrzeugkennzeichenkontrolle rechtfertigen könnte. Dies ist bei den bayerischen Regelungen zur weiteren Verwendung der Daten der Kennzeichenkontrolle nicht sichergestellt.
VII. Zum Zeitpunkt der angegriffenen Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts wurden Kraftfahrzeugkennzeichenkontrollen auf Art. 33 Abs. 2 Satz 2 bis 5, Art. 13 Abs. 1 Nr. 1 bis 5 sowie auf Art. 38 Abs. 3 BayPAG gestützt. Art. 33 Abs. 2 Satz 2 bis 5 BayPAG und Art. 38 Abs. 3 BayPAG wurden in einem neuen Art. 39 Abs. 1 und Abs. 3 Satz 1 bis 3 BayPAG bei geringfügigen redaktionellen Änderungen im Wesentlichen identisch zusammengeführt. Der Erste Senat des Bundesverfassungsgerichts hat sowohl die zum Zeitpunkt der Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts geltenden Normen als auch die Nachfolgeregelungen teilweise für verfassungswidrig erklärt.
Erfolglose Verfassungsbeschwerde gegen die Verpflichtung zur Übermittlung von IP-Adressen
Pressemitteilung Nr. 7/2019 vom 29. Januar 2019
Beschluss vom 20. Dezember 2018
2 BvR
2377/16
Es verstößt nicht gegen das Grundgesetz, dass der Anbieter eines E-Mail-Dienstes im Rahmen einer ordnungsgemäß angeordneten Telekommunikationsüberwachung verpflichtet ist, den Ermittlungsbehörden die Internetprotokolladressen (im Folgenden: IP-Adressen) der auf ihren Account zugreifenden Kunden auch dann zu übermitteln, wenn er seinen Dienst aus Datenschutzgründen so organisiert hat, dass er diese nicht protokolliert. Dies hat die 3. Kammer des Zweiten Senats mit heute veröffentlichtem Beschluss entschieden und die Verfassungsbeschwerde eines solchen Diensteanbieters nicht zur Entscheidung angenommen. Zur Begründung hat sie angeführt, dass das auch unter dem Gesichtspunkt des Art. 12 Abs. 1 GG grundsätzlich schützenswerte Anliegen, ein datenschutzoptimiertes Geschäftsmodell anzubieten, nicht von der Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben, die dem verfassungsrechtlichen Erfordernis einer funktionstüchtigen Strafrechtspflege Rechnung tragen, entbinden kann.
Sachverhalt:
Der Beschwerdeführer betreibt einen E-Mail-Dienst, der mit einem besonders effektiven Schutz der Kundendaten wirbt und sich den Grundsätzen der Datensicherheit und der Datensparsamkeit verpflichtet sieht. Er erhebt und speichert Daten nur dann, wenn dies aus technischen Gründen erforderlich oder - aus seiner Sicht - gesetzlich vorgesehen ist. Die Staatsanwaltschaft Stuttgart führte ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts von Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz und das Kriegswaffenkontrollgesetz. Mit Beschluss vom 25. Juli 2016 ordnete das Amtsgericht auf Antrag der Staatsanwaltschaft gemäß §§ 100a, 100b StPO in der damals geltenden Fassung die Sicherung, Spiegelung und Herausgabe aller Daten, die auf den Servern des Dienstes bezüglich des betreffenden E-Mail-Accounts elektronisch gespeichert sind, „sowie sämtlicher bezüglich dieses Accounts künftig anfallender Daten“ an. Das Landeskriminalamt gab dem Beschwerdeführer die angeordnete Überwachungsmaßnahme sowie den zu überwachenden Account bekannt. Daraufhin richtete der Beschwerdeführer die Telekommunikationsüberwachung ein, wies jedoch darauf hin, dass Verkehrsdaten der Nutzer nicht „geloggt“ würden und solche Daten inklusive der IP-Adressen deshalb nicht zur Verfügung gestellt werden könnten, sie seien nicht vorhanden. Der Annahme der Staatsanwaltschaft, die IP-Adressen seien beim Anbieter vorhanden, widersprach der Beschwerdeführer unter Darstellung seiner Systemstruktur. Er trenne sein internes Netz über ein sogenanntes NAT-Verfahren (Network Address Translation), bei dem die Adressinformationen in Datenpaketen automatisiert durch andere ersetzt würden, aus Sicherheitsgründen strikt vom Internet ab. Die IP-Adressen der Kunden würden daher bereits an den Außengrenzen des Systems verworfen und seien dem Zugriff des Beschwerdeführers entzogen. Mit Beschluss vom 9. August 2016 setzte das Amtsgericht ein Ordnungsgeld in Höhe von 500 Euro, ersatzweise sieben Tage Ordnungshaft, gegen den Beschwerdeführer fest. Aufgrund des Beschlusses vom 25. Juli 2016 sei der Beschwerdeführer verpflichtet, zukünftig die Verkehrsdaten und insbesondere die IP-Adressen zu erheben. Das Landgericht verwarf die hiergegen gerichtete Beschwerde mit Beschluss vom 1. September 2016 als unbegründet. Im November 2016 teilte das Landeskriminalamt dem Beschwerdeführer mit, dass die Überwachung des Anschlusses abgeschaltet werden könne. Das Ordnungsgeld wurde schließlich bezahlt.
Wesentliche Erwägungen der Kammer:
Soweit sich die Verfassungsbeschwerde gegen die Beschwerdeentscheidung richtet, ist sie jedenfalls unbegründet. Zwar greift die Festsetzung des Ordnungsgeldes in die durch Art. 12 Abs. 1 Satz 2 GG geschützte Freiheit der Berufsausübung des Beschwerdeführers ein. Die Annahme des Landgerichts, der Eingriff in den Schutzbereich des Art. 12 Abs. 1 Satz 2 GG sei nach Maßgabe der einschlägigen gesetzlichen Vorschriften gerechtfertigt, begegnet jedoch keinen verfassungsrechtlichen Bedenken.
Art. 12 Abs. 1 Satz 2 GG erlaubt Eingriffe in die Berufsfreiheit nur auf Grundlage einer gesetzlichen Regelung, die Umfang und Grenzen des Eingriffs erkennen lässt. Dabei muss der Gesetzgeber selbst alle wesentlichen Entscheidungen treffen, soweit sie gesetzlicher Regelung zugänglich sind. Je stärker in grundrechtlich geschützte Bereiche eingegriffen wird, desto deutlicher muss das gesetzgeberische Wollen zum Ausdruck kommen. Danach ist ein Grundrechtsverstoß nicht ersichtlich. Die Fachgerichte haben die Vorschriften über die Mitwirkungs- und Vorhaltungspflichten von Telekommunikationsdiensteanbietern in verfassungsrechtlich vertretbarer Weise ausgelegt. Sie durften ohne Verfassungsverstoß davon ausgehen, dass der Beschwerdeführer verpflichtet war seinen Betrieb so zu gestalten, dass er den Ermittlungsbehörden die am überwachten Account vom Zeitpunkt der Anordnung an anfallenden externen IP-Adressen zur Verfügung stellen kann. Denn die Überwachung der Telekommunikation im Sinne von § 100a StPO erfasst nicht nur die Kommunikationsinhalte, sondern auch die näheren Umstände der Telekommunikation einschließlich der fraglichen IP-Adressen.
1. Die - verfassungskonforme - Vorschrift des § 100a StPO ermächtigt zur Überwachung und Aufzeichnung der Telekommunikation. Vor dem Hintergrund des „weiten“ Telekommunikationsbegriffs unterfällt der Zugriff auf E-Mail-Kommunikation, jedenfalls soweit es sich um die Übertragung der Nachricht vom Gerät des Absenders über dessen Mailserver auf den Mailserver des E-Mail-Providers und um den späteren Abruf der Nachricht durch den Empfänger handelt, unstrittig dem Anwendungsbereich des § 100a StPO.
Vom Schutz des Fernmeldegeheimnisses nach Art. 10 Abs. 1 GG sind aber nicht nur die Kommunikationsinhalte, sondern auch die näheren Umstände der Telekommunikation erfasst. Vor diesem Hintergrund betrifft die Überwachung der Telekommunikation gemäß § 100a StPO auch die Verkehrsdaten im Sinne des § 3 Nr. 30 TKG, soweit diese im Rahmen der zu überwachenden Telekommunikation anfallen. Zu den Verkehrsdaten in diesem Sinne gehören auch und gerade die anfallenden IP-Adressen. Diese werden dementsprechend in § 96 Abs. 1 Satz 1 TKG als Nummern der beteiligten Anschlüsse oder Einrichtungen aufgeführt. Dynamische oder statische IP-Adressen, mit denen die Kunden eines Anbieters von E-Mail-Diensten mit ihren internetfähigen Endgeräten auf ihren E-Mail-Account zugreifen wollen, unterfallen daher grundsätzlich dem Anwendungsbereich des § 100a StPO.
Der Umstand, dass die Überwachung des E-Mail-Verkehrs im Rahmen einer Anordnung nach § 100a StPO auch die bezeichneten IP-Adressen umfasst, bedeutet allerdings nicht schon zwangsläufig, dass der Beschwerdeführer als Betreiber einer Telekommunikationsanlage verpflichtet ist, Vorkehrungen zu treffen, um den Ermittlungsbehörden auch und gerade diese IP-Adressen zur Verfügung zu stellen. § 100b Abs. 3 Satz 2 StPO a. F. verweist insoweit auf die Vorschriften des TKG und der TKÜV.
Nach § 110 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 TKG besteht für Betreiber von öffentlich zugänglichen Telekommunikationsdiensten die Verpflichtung, ab dem Zeitpunkt der Betriebsaufnahme auf eigene Kosten technische Einrichtungen zur Umsetzung der Telekommunikationsüberwachung vorzuhalten und die entsprechenden organisatorischen Vorkehrungen für deren unverzügliche Umsetzung zu treffen. Die grundlegenden technischen Anforderungen und organisatorischen Eckpunkte für die Umsetzung der Überwachungsmaßnahmen regelt dabei die auf Grundlage der Ermächtigung in § 110 Abs. 2 TKG erlassene TKÜV. Danach unterliegt auch der Beschwerdeführer der Vorhaltungsverpflichtung; dass die in § 3 Abs. 2 TKÜV vorgesehenen Ausnahmen für bestimmte Arten von Telekommunikationsanlagen eingreifen, ist weder vorgetragen noch ersichtlich.
Der Umfang der bereitzustellenden Daten bestimmt sich nach § 5 Abs. 1 und 2 in Verbindung mit § 7 Abs. 1 TKÜV. Gemäß § 5 Abs. 1 TKÜV besteht die zu überwachende Telekommunikation - dem weiten Telekommunikationsbegriff des § 100a StPO entsprechend - aus dem Inhalt und den Daten über die näheren Umstände der Telekommunikation. Nach Absatz 2 der Vorschrift hat der Verpflichtete eine vollständige Kopie der Telekommunikation bereitzustellen, die über seine Telekommunikationsanlage abgewickelt wird. Als Teil dieser Überwachungskopie hat der Verpflichtete gemäß § 7 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2, 3 und 4 TKÜV schließlich auch die bei ihm vorhandenen Daten über eine gewählte Rufnummer oder eine andere Adressierungsangabe bereitzustellen. Nach dem Sprachgebrauch des TKG unterfallen die bei einer Telekommunikation anfallenden IP-Adressen dabei ohne weiteres dem Begriff „andere Adressierungsangabe“, denn sie dienen gerade der Adressierung, also dem Erreichen oder Auffinden eines bestimmten Ziels im Internet. So unterfallen IP-Adressen unstrittig der Legaldefinition des § 3 Nr. 13 TKG, wonach Nummern im Sinne des TKG Zeichenfolgen sind, die in Telekommunikationsnetzen Zwecken der Adressierung dienen.
Es ist auch jedenfalls verfassungsrechtlich vertretbar anzunehmen, die Daten seien beim Beschwerdeführer vorhanden im Sinne des § 7 Abs. 1 Satz 1 TKÜV und von diesem als Teil der vollständigen Kopie der überwachten, über seine Telekommunikationsanlage abgewickelten Telekommunikation bereitzustellen. Schon aus der von ihm beschriebenen Systemstruktur ergibt sich, dass der Beschwerdeführer die öffentlichen IP-Adressen seiner Kunden wenigstens für die Dauer der Kommunikation speichern muss, da er ansonsten die abgerufenen Datenpakete seinen Kunden gar nicht übersenden könnte. Jedenfalls fallen die Daten beim Zugriff auf den überwachten E-Mail-Account an, sind der Telekommunikationsanlage des Beschwerdeführers wenigstens zeitweise bekannt und werden von dieser auch zur Herstellung einer erfolgreichen Kommunikation mit dem anfragenden Kunden benutzt.
Die Überwachung der ‑ künftigen - Telekommunikation gemäß § 100a StPO ist - anders als die Erhebung von Verkehrsdaten nach § 100g StPO - auch nicht auf die Verkehrsdaten beschränkt, die nach § 96 Abs. 1 TKG vom Diensteanbieter zulässigerweise erhoben werden dürfen.
Dass der Beschwerdeführer auf die externen IP-Adressen - derzeit - nicht zugreifen kann, steht dem nicht entgegen. Denn dies liegt nicht daran, dass die Daten an sich nicht vorhanden wären, sondern allein daran, dass sich der Beschwerdeführer aus Datenschutzgründen dazu entschlossen hat, diese vor seinen internen Systemen zu verbergen und sie nicht zu protokollieren. Das ist indes allein dem vom Beschwerdeführer bewusst gewählten Geschäfts- und Systemmodell geschuldet. Zwar erscheint das Anliegen des Beschwerdeführers, ein datenschutzoptimiertes und daher für viele Nutzer attraktives Geschäftsmodell anzubieten, auch unter dem Gesichtspunkt des Art. 12 Abs. 1 GG grundsätzlich durchaus schützenswert. Dies kann ihn jedoch nicht von den im Rahmen einer vertretbaren Auslegung gewonnen Vorgaben des TKG und der TKÜV, die dem verfassungsrechtlichen Erfordernis einer funktionstüchtigen Strafrechtspflege Rechnung tragen, entbinden.
Diesem Ergebnis steht schließlich auch nicht entgegen, dass sich die bereitzustellenden Daten nach der im Rahmen der Neubekanntmachung der TKÜV vom 11. Juli 2017 neu eingefügten Regelung in § 7 Abs. 1 Satz 1 Nr. 9 TKÜV nunmehr ausdrücklich auch auf die der Telekommunikationsanlage des Verpflichteten bekannten öffentlichen IP-Adressen der beteiligten Nutzer erstrecken. Denn diese Neuregelung lässt jedenfalls keinen verfassungsrechtlich zwingenden Schluss darauf zu, dass die fraglichen IP-Adressen bislang aus dem Kreis der bereitzustellenden Daten ausgenommen gewesen wären. Vielmehr kommt dem neu eingefügten § 7 Abs. 1 Satz 1 Nr. 9 TKÜV ersichtlich eine klarstellende Funktion zu.
2. Entgegen der Auffassung des Beschwerdeführers verdrängt § 100g Abs. 1 StPO, soweit die (Echtzeit-)Überwachung künftiger Telekommunikation betroffen ist, die Vorschrift des § 100a StPO nicht.
3. Gegen die Festsetzung des Ordnungsgeldes in Höhe von 500 Euro ist im konkreten Fall von Verfassungs wegen ebenfalls nichts zu erinnern.
RTDeutsch
Deutschland
Grundgesetz "völkerrechtlich bedenklich" und "von Westmächten oktroyiert" – Ex-Staatsanwalt (Teil 1)
26.01.2019 • 07:30 Uhr
Quelle: www.globallookpress.com © Christian Ohde/face to face
403
Hans Bauer, ehemaliger stellvertretende Generalstaatsanwalt der DDR, sprach im Interview mit RT Deutsch über Verfassungsrecht. Im ersten Teil liefert er eine kritische Einschätzung zur Entstehungsgeschichte des Grundgesetzes und des Rechtsstaats.
Hans Bauer war ab dem Jahr 1966 als Staatsanwalt in der Deutschen Demokratischen Republik tätig. Er diente auf den verschiedenen Ebenen der staatlichen Strukturen der DDR. Im Umbruchsjahr 1989 wurde er zum stellvertretenden Generalstaatsanwalt ernannt. Während seiner Dienstzeit als Staatsanwalt war er ein Jahr im Außenministerium abgeordnet. Dort arbeitete er an Menschenrechtsfragen. Später, in den 1980er Jahren, wirkte er über mehrere Jahre als Berater in der Volksdemokratischen Republik Jemen. Dort half er, die südjemenitische Staatsanwaltschaft aufzubauen.
Sein Spezialgebiet ist die Kriminalitätsforschung, insbesondere die Kriminalitätsvorbeugung. Im Frühling des Jahres 1991 wurde er dann arbeitslos. Nach der Übernahme des DDR-Gebiets durch die BRD erhielt er im Jahr 1992 die Zulassung zur Rechtsanwaltschaft und ist seitdem als Anwalt tätig. Im Jahr 1993 wirkte er führend bei der Gründung der Gesellschaft zur Rechtlichen und Humanitären Unterstützung mit, die sich um Solidarität mit den nach 1990 von der westdeutschen Justiz verfolgten DDR-Vertretern bemüht, und ist seit 2005 deren Vorsitzender.
Das Gespräch führte Hasan Posdnjakow.
Unter welchen Bedingungen ist das Grundgesetz entstanden? Hat das Volk bei der Erarbeitung dieser Verfassung eine Rolle gespielt?
Das Volk hat eigentlich gar keine Rolle gespielt. Das Grundgesetz war praktisch ein Auftrag von den drei Westalliierten, die auch Vorgaben machten. Dann wurde ein Rat eingesetzt, der einen Entwurf erarbeitete. Es gab Expertenkommissionen zu den einzelnen Artikeln. Nachdem der Gesamtentwurf vorlag, stimmte der Parlamentarische Rat darüber ab. Das Alles dauerte zirka ein Dreivierteljahr. Bei der Abstimmung gab es nicht nur die zwei Gegenstimmen der Kommunisten, aus unterschiedlichen Gründen. Danach wurde der Entwurf in die Länderparlamente delegiert und dort abgestimmt. Aber es erfolgte keine Diskussion im Volk, etwa zu den Fragen, was in das Grundgesetz aufgenommen wird, womit man sich auseinandersetzen muss, was positive und negative Aspekte sind. Das Grundgesetzt wurde im Prinzip nach Vorgabe der drei Westalliierten in einem kleinen Expertenkreis ausgearbeitet und von den Ländern abgestimmt.
Dazu muss man sagen, dass es ja nur eine provisorische Verfassung war. Deswegen nannte man sie auch Grundgesetz. Das geschah auch vor dem Hintergrund, dass man die Einheit Deutschlands anstrebte. Die Verfassung der DDR, die im Oktober 1949 angenommen wurde, war auch provisorisch, auch unter dem Gesichtspunkt der Einheit Deutschlands. Insoweit hatten beide Verfassungen den Hintergedanken, die Einheit Deutschlands herzustellen.
Der entscheidende Unterschied war, dass im Grundgesetz die Einheit Deutschlands unter dem Gesichtspunkt gefasst wurde, auch noch die "Ostgebiete" zu bekommen, also Deutschland in den Grenzen von 1937 und insbesondere die Sowjetische Besatzungszone. Daher wollte man noch nichts Endgültiges schaffen.
Die Verfassung der DDR, die ja auch die Einheit Deutschlands vorsah, sollte in ganz Deutschland diskutiert werden. Wie bekannt ist, wurden mehrere Vorschläge unterbreitet, wie eine Diskussion zur Einheit Deutschlands in ganz Deutschland in Gang gebracht werden könnte. Der letzte Vorschlag war Stalins berühmte Note im Jahr 1952. Diese vorgesehene Diskussion im ganzen Volk war für das Grundgesetz gar nicht angedacht. Zumindest zu dieser Zeit hatte ja der Bundeskanzler der BRD, Konrad Adenauer, den Gedanken, dass man den Osten militärisch "befreien" könnte. Insofern gab es völlig unterschiedliche Voraussetzungen unter dem Gesichtspunkt der Einheit Deutschlands.
Mehr lesen:Grundgesetz egal? Koalitionsstreit um Syrien-Einsatz der Bundeswehr
Das Grundgesetz der BRD ist nicht nur nicht mit der Bevölkerung zustande gekommen und von den Westmächten oktroyiert worden, sondern ist genau genommen auch gegen das Potsdamer Abkommen zustande gekommen und daher völkerrechtlich bedenklich. Im Potsdamer Abkommen wurde festgelegt für ganz Deutschland: Entwicklung der Demokratie, Antifaschismus (vor allem Antinazismus), Enteignungen der Großkonzerne, die am Krieg verdient hatten und so weiter. Das alles findet sich im Grundgesetz nicht wieder. Schon darin zeigt sich, dass dieses Grundgesetz nicht antifaschistisch-demokratisch zustande kam, aber auch nicht in Übereinstimmung mit dem geltenden Völkerrecht.
Wie positionierte sich die KPD zu dem Entwurf des Grundgesetzes?
Dazu gibt es eine ganze Menge Literatur. Bekannt ist insbesondere, dass die KPD grundsätzlich gegen das Grundgesetz war. Die zwei KPD-Vertreter im Parlamentarischen Rat haben das Grundgesetz auch in den Gremien nicht befördert. Max Reimann (KPD-Vorsitzender) hat viele der Sitzungen dann gar nicht mehr besucht. Andererseits war die KPD nur mit zwei Vertretern dort anwesend. Während der Ausarbeitung wurde Reimann auch kurzzeitig inhaftiert. Nach der Abstimmung des Grundgesetzes erklärte Reimann dann, dass die KPD zwar dem Grundgesetz nicht zugestimmt habe, aber die Erste sein werde, die es verteidigen müsse. Das, was in den ersten Jahren nach Annahme des Grundgesetzes geschah, verstieß schon gegen das Grundgesetz, wenn man es genau nimmt. Und heute erst recht.
Die Bedenken der KPD gegen das Grundgesetz bestanden hauptsächlich darin, dass es nicht in Übereinstimmung mit dem Völkerrecht und undemokratisch war sowie auf die Spaltung Deutschlands hinauslief. Im Prinzip hat sich diese Einschätzung bestätigt, vor allem, was die Verteidigung des Grundgesetzes angeht.
Wie ist das Grundgesetz anhand der Kriterien eines Rechtsstaates zu bewerten?
Was ist ein Rechtsstaat? Das klingt erst einmal gut und ist in aller Munde. Es gibt keine wissenschaftliche Definition dazu, zum Unrechtsstaat schon gar nicht. Aber das Grundgesetz formuliert etwas, was in deutschen Verfassungen schon seit Jahrzehnten stand: allgemein Menschliches. Von "die Würde des Menschen ist unantastbar" bis hin zu allgemeinen Regelungen, die die grundlegenden Bürger- und Menschenrechte betreffen. Das ist in etwa wie in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte von 1948. Solch eine Erklärung war zu dieser Zeit ein gewaltiger Fortschritt. Schon damals stimmten aber die Sowjetunion und andere der Erklärung nicht zu, aber nicht, weil sie dagegen waren, sondern ganz einfach deshalb, weil es sehr allgemein gehalten und nicht greifbar war sowie auch zu wenig das Selbstbestimmungsrecht der Völker beinhaltete.
Mehr lesen:Ein Volk diskutiert: Kuba und seine Verfassungsreform
Das, was im Grundgesetz an grundlegenden Menschen- und Bürgerrechten steht, ist im Wesentlichen so allgemein gehalten, dass es nicht greifbar ist und man alles damit machen kann. Das wird dann als Rechtsstaat bezeichnet, aber der wichtigste Aspekt eines Rechtsstaats ist, dass die gesamten gesellschaftlichen Verhältnisse rechtlich geregelt sind. Alles was geschieht, muss irgendwo in einer Norm, in einem Gesetz enthalten sein. Es muss alles rechtlich exakt geregelt sein, wie sich der Mensch wann, wo und wie verhalten soll oder nicht verhalten soll. Und er soll sich (auch gegen den Staat) wehren können, wenn er meint, dass seine Rechte verletzt wurden. Eigentlich ist das als Rechtsstaat zu verstehen.
Es bedeutet aber noch nicht, dass das, was in den Gesetzen enthalten ist, besonders menschen- oder bürgerfreundlich ist, oder dass man aus dem, was im Recht, in den Normen des Grundgesetzes steht, Ansprüche geltend machen kann. Arbeit zum Beispiel. Jeder muss arbeiten, um zu existieren. Das ist sehr wichtig, jedoch steht dazu überhaupt nichts. So auch die sozialen Rechte. Insofern fehlen ganz entscheidende Punkte im Grundgesetz, wenn man schon vom Rechtsstaat spricht, wenn man vom Inhalt den Rechtsstaat verstehen will. Da kann auch der bürgerliche Rechtsstaat ein Staat sein, der kein Recht oder gar Unrecht bietet. Das ist nicht formuliert. Das steht ja nicht drin, dass man keine Arbeit bekommt. So gesehen ist der Begriff Rechtsstaat schon problematisch. Die Diskussion muss also tiefer gehen. Was die DDR angeht: Wir wollten kein bürgerlicher Rechtsstaat werden. Wenn, dann ein sozialistischer Rechtsstaat, in dem Inhalt mit Form übereinstimmt.
Formularende
Formularbeginn
Formularende
Formularbeginn
----------------------------------------------------->
Erfolgreiche Verfassungsbeschwerde wegen fehlender Begründungstiefe der Haftfortdauerentscheidung
Pressemitteilung Nr. 6/2019 vom 25. Januar 2019
Beschluss vom 23. Januar 2019
2 BvR
2429/18
Mit heute veröffentlichtem Beschluss hat die 1. Kammer des Zweiten Senats der Verfassungsbeschwerde eines Untersuchungsgefangenen gegen einen Haftfortdauerbeschluss des Pfälzischen Oberlandesgerichts Zweibrücken stattgegeben und festgestellt, dass der Beschwerdeführer in seinem Grundrecht auf Freiheit der Person verletzt ist. Zur Begründung hat die Kammer einerseits angeführt, dass die Terminierung der 1. Großen Strafkammer des Landgerichts Frankenthal (Pfalz) in der gegen den Beschwerdeführer geführten Hauptverhandlung den verfassungsrechtlichen Anforderungen an die Verhandlungsdichte nicht genügt. Andererseits enthält der Haftfortdauerbeschluss keine tragfähige Begründung, die ausnahmsweise dennoch die weitere Fortdauer der Untersuchungshaft rechtfertigen könnte. Die Kammer hat die Sache an das Oberlandesgericht zurückverwiesen, das unter Beachtung der Ausführungen des Bundesverfassungsgerichts erneut darüber zu entscheiden haben wird, ob der Beschwerdeführer weiter in Untersuchungshaft bleibt.
Sachverhalt:
Der Beschwerdeführer befindet sich seit Mai 2016 in Untersuchungshaft. Im August 2016 erhob die Staatsanwaltschaft Anklage wegen Mordes, gefährlicher Körperverletzung und Geiselnahme in Tateinheit mit versuchtem Mord und gefährlicher Körperverletzung. Im Oktober 2016 ließ die zuständige Strafkammer des Landgerichts die Anklage zur Hauptverhandlung zu und ordnete die Haftfortdauer an. Die Hauptverhandlung begann zunächst im November 2016. Bis September 2017 waren 25 Verhandlungstage terminiert. Nach 23 Verhandlungstagen erkrankte die Vorsitzende im August 2017 dauerhaft dienstunfähig. Die Kammer setzte daraufhin die Hauptverhandlung aus. Die Hauptverhandlung begann nach Übernahme der Kammer durch einen neuen Vorsitzenden erneut im Dezember 2017. Bis August 2018 wurde an 25 Tagen, bis November 2018 wurde an vier weiteren Tagen verhandelt. Bis zum 31. Januar 2019 sind weitere 15 Termine bestimmt.
Die Strafkammer zeigte mehrmals ihre Überlastung an. Zwischenzeitlich wies das Präsidium der Kammer eine weitere Beisitzerin mit einem Arbeitskraftanteil von 0,2 zu, und es wurden Haftsachen, in denen eine Hauptverhandlung noch nicht begonnen hatte, anderen Strafkammern zugewiesen. Allerdings verhandelte die Kammer zeitgleich in zwei weiteren umfangreichen Haftsachen. Im August 2018 legte der Pflichtverteidiger des Beschwerdeführers Haftbeschwerde ein, mit der er einen Verstoß gegen das Beschleunigungsgebot rügte. Das Oberlandesgericht verwarf die Beschwerde durch den vorliegend angegriffenen Beschluss vom 16. Oktober 2018 als unbegründet.
Wesentliche Erwägungen der Kammer:
Der mit der Verfassungsbeschwerde angegriffene Beschluss verletzt den Beschwerdeführer in seinem Grundrecht aus Art. 2 Abs. 2 Satz 2 GG in Verbindung mit Art. 104 GG.
1. Die Freiheit der Person darf nur aus besonders gewichtigen Gründen und unter strengen formellen Gewährleistungen eingeschränkt werden. Bei der Anordnung und Aufrechterhaltung der Untersuchungshaft ist das Spannungsverhältnis zwischen dem Recht des Einzelnen auf persönliche Freiheit und den unabweisbaren Bedürfnissen einer wirksamen Strafverfolgung zu beachten. Der Entzug der Freiheit eines der Straftat lediglich Verdächtigen ist wegen der Unschuldsvermutung nur ausnahmsweise zulässig.
Der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz setzt der Dauer der Untersuchungshaft auch unabhängig von der Straferwartung Grenzen. Das Gewicht des Freiheitsanspruchs vergrößert sich gegenüber dem Interesse an einer wirksamen Strafverfolgung regelmäßig mit zunehmender Dauer der Untersuchungshaft. Daraus folgt zum einen, dass die Anforderungen an die Zügigkeit der Arbeit in einer Haftsache mit der Dauer der Untersuchungshaft steigen. Zum anderen nehmen auch die Anforderungen an den die Haftfortdauer rechtfertigenden Grund zu. Im Rahmen der Abwägung zwischen dem Freiheitsanspruch des Betroffenen und dem Strafverfolgungsinteresse der Allgemeinheit ist die Angemessenheit der Haftfortdauer anhand objektiver Kriterien des jeweiligen Einzelfalles zu prüfen. Der Vollzug der Untersuchungshaft von mehr als einem Jahr bis zum Beginn der Hauptverhandlung oder dem Erlass des Urteils wird dabei nur in ganz besonderen Ausnahmefällen zu rechtfertigen sein.
Das Beschleunigungsgebot in Haftsachen verlangt, dass die Strafgerichte alle möglichen und zumutbaren Maßnahmen ergreifen, um eine gerichtliche Entscheidung über die einem Beschuldigten vorgeworfenen Taten herbeizuführen. An den zügigen Fortgang des Verfahrens sind dabei desto strengere Anforderungen zu stellen, je länger die Untersuchungshaft schon andauert. Bei absehbar umfangreicheren Verfahren ist stets eine vorausschauende, auch größere Zeiträume umgreifende Hauptverhandlung mit mehr als einem durchschnittlichen Hauptverhandlungstag pro Woche notwendig. Die Untersuchungshaft kann dann nicht mehr als notwendig anerkannt werden, wenn ihre Fortdauer durch Verfahrensverzögerungen verursacht ist, die ihre Ursache nicht in dem konkreten Strafverfahren haben. Allein die Schwere der Tat und die sich daraus ergebende Straferwartung vermögen bei erheblichen, vermeidbaren und dem Staat zuzurechnenden Verfahrensverzögerungen nicht zur Rechtfertigung einer ohnehin schon lang andauernden Untersuchungshaft zu dienen.
Die nicht nur kurzfristige Überlastung eines Gerichts kann insofern niemals Grund für die Anordnung der Haftfortdauer sein. Sie kann selbst dann die Fortdauer der Untersuchungshaft nicht rechtfertigen, wenn sie auf einem Geschäftsanfall beruht, der sich trotz Ausschöpfung aller gerichtsorganisatorischen Mittel und Möglichkeiten nicht mehr innerhalb angemessener Fristen bewältigen lässt. Die Überlastung eines Gerichts fällt in den Verantwortungsbereich der staatlich verfassten Gemeinschaft. Dem Beschuldigten darf nicht zugemutet werden, eine längere als die verfahrensangemessene Aufrechterhaltung des Haftbefehls nur deshalb in Kauf zu nehmen, weil der Staat es versäumt, seiner Pflicht zur rechtzeitigen verfassungsgemäßen Ausstattung der Gerichte zu genügen.
Da der Grundrechtsschutz auch durch die Verfahrensgestaltung zu bewirken ist, unterliegen Haftfortdauerentscheidungen zudem einer erhöhten Begründungstiefe.
2. Diesen Vorgaben genügt der angegriffene Beschluss des Pfälzischen Oberlandesgerichts Zweibrücken nicht. Er zeigt keine besonderen Umstände auf, die die Anordnung der Fortdauer der Untersuchungshaft verfassungsrechtlich hinnehmbar erscheinen lassen könnten.
a) Die Terminierung der Strafkammer des Landgerichts genügt den verfassungsrechtlichen Anforderungen an die Verhandlungsdichte nicht. Die Strafkammer hat in jedem Betrachtungszeitraum weit seltener als an durchschnittlich einem Hauptverhandlungstag pro Woche verhandelt, zuletzt an nur 0,65 Tagen pro Woche. Die Verhandlungsdichte sinkt noch weiter unter diesen Wert, wenn man die Sitzungstage nicht einbezieht, an denen nur kurze Zeit verhandelt und das Verfahren dadurch nicht entscheidend gefördert wurde. Die vom Präsidium des Landgerichts als Reaktion auf die Überlastungsanzeigen getroffenen Maßnahmen haben nicht dazu geführt, dass die vorliegende Haftsache nunmehr innerhalb des durch das Beschleunigungsgebot gezogenen Rahmens bearbeitet und die bereits eingetretene Verfahrensverzögerung wirksam kompensiert worden wäre.
b) Der Beschluss des Pfälzischen Oberlandesgerichts Zweibrücken enthält keine tragfähige Begründung, die ausnahmsweise - trotz der ungenügenden Verhandlungsdichte - die weitere Fortdauer der Untersuchungshaft rechtfertigen könnte.
Das Oberlandesgericht hat nicht nachvollziehbar dargelegt, dass die erschwerte Terminfindung ihre Ursache allein in dem konkreten Strafverfahren hatte und nicht vielmehr darauf zurückzuführen ist, dass die Strafkammer neben dem gegenständlichen Verfahren mehrere weitere, teilweise umfangreiche Haftsachen zu bewältigen und daher ohnehin keine freien Verhandlungskapazitäten mehr zur Verfügung hatte.
Die vom Oberlandesgericht im Übrigen angeführten Gesichtspunkte - namentlich die Komplexität des Verfahrens, die äußerst schwerwiegenden Tatvorwürfe und die Verfahrensverzögerungen wegen des Verhaltens des Verteidigers - mögen zwar die Untersuchungshaft als solche und die Anzahl der benötigten Hauptverhandlungstage und deren Dauer rechtfertigen, nicht jedoch das Unterlassen einer dichteren Terminierung. Auch die Erkrankung der bisherigen Vorsitzenden kann als unvorhersehbares, schicksalhaftes Ereignis zwar ausnahmsweise die Fortdauer der Untersuchungshaft auch während der erforderlich werdenden neuen Hauptverhandlung rechtfertigen, nicht aber eine durchgehend zu geringe Termindichte. Auch verhält sich der Beschluss nicht dazu, ob die Belastungssituation der Strafkammer nachweislich unvorhersehbar und somit unvermeidbar war, oder ob die Strafkammer bereits vorher dauerhaft, nicht nur vorübergehend überlastet war und damit letztlich eine unzureichende Personalausstattung oder -verwaltung die wesentliche Ursache für die lange Verfahrensdauer ist. Dabei ist zu beachten, dass es nicht Aufgabe eines Gerichts sein kann, eine strukturell zu geringe Personalausstattung oder eine dauerhafte Überlastung mit Haftsachen durch einen langfristig überobligatorischen Arbeitseinsatz oder eine langfristige Beschränkung ihrer Verhandlungskapazitäten ausschließlich auf Haftsachen zu kompensieren. Überdies setzt sich der angegriffene Beschluss nicht mit den von der Justizverwaltung aus Anlass der Überlastungsanzeigen jeweils getroffenen Abhilfemaßnahmen auseinander. Das Oberlandesgericht wäre insoweit gehalten gewesen, ausgehend von der tatsächlichen Belastungssituation der Strafkammer darzulegen, inwieweit die jeweils von der Justizverwaltung getroffenen Maßnahmen nach Art, Zielrichtung und Umfang rechtzeitig, geeignet und hinreichend wirksam waren, um die Voraussetzungen für eine dem Beschleunigungsgebot genügende Verfahrensgestaltung (wieder)herzustellen.
Für den Fall, dass sowohl eine außergewöhnliche, unvorhersehbare Belastungssituation der Strafkammer anzunehmen ist als auch die Reaktionen der Justizverwaltung hierauf jeweils als ausreichend zu erachten sind, wäre schließlich darzulegen gewesen, ob die - nach Erkrankung der bisherigen Vorsitzenden neu besetzte - Strafkammer im Rahmen der neu begonnenen Hauptverhandlung das vorliegende Verfahren unter den gegebenen Voraussetzungen tatsächlich hinreichend beschleunigt betrieben hat und etwaige Verfahrensverzögerungen ihre Ursache ausschließlich in dem konkreten Strafverfahren haben.
Keine Verpflichtung aus Art. 3 Abs. 3 Satz 2 GG, die mündliche Verhandlung nach den Vorstellungen eines Verfahrensbeteiligten auszugestalten
Pressemitteilung Nr. 1/2019 vom 3. Januar 2019
Beschluss vom 27. November
2018
1 BvR
957/18
Die 1. Kammer des Ersten Senats des Bundesverfassungsgerichts hat mit dem heute veröffentlichten Beschluss eine Verfassungsbeschwerde eines unter psychischen Beeinträchtigungen leidenden Beschwerdeführers nicht zu Entscheidung angenommen, der begehrte, die mündliche Verhandlung nach seinen Vorstellungen barrierefrei durchzuführen. Der von dem Beschwerdeführer behauptete Verstoß gegen Art. 3 Abs. 3 Satz 2 GG ist durch die ablehnende Entscheidung des Landessozialgerichts nicht gegeben.
Sachverhalt:
Der Beschwerdeführer leidet an Autismus in Gestalt des Asperger-Syndroms. Auf Grund der Erkrankung begehrte er, über einen längeren Zeitraum von seinem heimischen Computer aus zu kommunizieren statt bei der mündlichen Verhandlung unmittelbar anwesend zu sein. Dies lehnte das Landessozialgericht ab und bot dem Beschwerdeführer jedoch an, die mündliche Verhandlung durch Übersendung des schriftlichen Sachberichts vorab sowie durch Kommunikation im Gerichtssaal mittels Computer an seine Bedürfnisse anzupassen.
Wesentliche Erwägungen der Kammer:
Es bestehen keine verfassungsrechtlichen Bedenken gegen die ablehnende Entscheidung des Landessozialgerichts. Das Begehren des Beschwerdeführers, die mündliche Verhandlung nach seinen Vorstellungen auszugestalten, wird von Art. 3 Abs. 3 Satz 2 GG nicht getragen.
Gerichte haben das Verfahren stets nach pflichtgemäßen Ermessen unter Beachtung von Art. 3 Abs. 3 Satz 2 GG so zu führen, dass den gesundheitlichen Belange der Verfahrensbeteiligen Rechnung getragen wird. Diese Verpflichtung besteht jedoch nicht uneingeschränkt. Die durch eine mündliche Verhandlung geschaffene Transparenz und die Wahrung des Unmittelbarkeitsgrundsatzes zur korrekten Ermittlung des Sachverhalts sind rechtsstaatlich unerlässlich.
Gemessen an diesen Maßstäben liegt nach einer Gesamtwürdigung keine von Verfassungs wegen zu beanstandende Ungleichbehandlung vor. Die von dem Beschwerdeführer begehrte Ausgestaltung der mündlichen Verhandlung würde sich zu den genannten Verfassungsprinzipien in Widerspruch setzen. Hingegen werden durch die mögliche Bestellung eines Bevollmächtigten beziehungsweise eines Beistands sowohl die Rechte des Beschwerdeführers als auch die dargestellten Prinzipien gewahrt und in einen schonenden Ausgleich gebracht.
Niedersächsische Regelungen zur Besoldung bei begrenzter Dienstfähigkeit verfassungswidrig
Pressemitteilung Nr. 86/2018 vom 14. Dezember 2018
Beschluss vom 28. November 2018
2 BvL 3/15
Mit heute veröffentlichtem Beschluss hat der Zweite Senat eine Besoldungsregelung für mit dem Grundgesetz unvereinbar erklärt, nach der aus gesundheitlichen Gründen begrenzt dienstfähige Beamte lediglich eine an der freiwilligen Teilzeitbeschäftigung orientierte Besoldung erhalten. Zur Begründung hat der Senat angeführt, dass der Gesetzgeber die durch die begrenzte Dienstfähigkeit eingetretene Störung des wechselseitigen Pflichtengefüges zwar besoldungsmindernd berücksichtigen darf. Begrenzt dienstfähige Beamte scheiden aber anders als bei einer Zurruhesetzung wegen Dienstunfähigkeit nicht vorzeitig aus dem aktiven Dienst aus. Ihre Verpflichtung, sich ganz dem öffentlichen Dienst als Lebensberuf zu widmen, bleibt unberührt. Kommen sie dieser Verpflichtung im Umfang ihrer verbliebenen Arbeitskraft nach, muss sich ihre Besoldung an der vom Dienstherrn selbst für amtsangemessen erachteten Vollzeitbesoldung orientieren.
Der Senat hat dem Gesetzgeber des Landes Niedersachsen aufgegeben, eine verfassungskonforme Regelung mit Wirkung spätestens vom 1. Januar 2020 an zu treffen.
Sachverhalt:
Nach den verfahrensgegenständlichen Besoldungsvorschriften des Landes Niedersachsen erhalten begrenzt dienstfähige Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter, die in vollem zeitlichen Umfang ihrer Dienstfähigkeit Dienst leisten, Dienstbezüge wie bei einer freiwilligen Teilzeitbeschäftigung, mindestens jedoch in Höhe des Ruhegehalts, das ihnen bei Versetzung in den Ruhestand zustünde. Hinzu kommt ein Zuschlag, der sich grundsätzlich auf 5 % der Vollzeitbezüge beläuft. Dieser Zuschlag konnte bis zu einer Gesetzesänderung im Jahr 2015 unter bestimmten Umständen vollständig aufgezehrt werden, seither beträgt er monatlich mindestens 150 Euro. Die Klägerin des Ausgangsverfahrens steht seit 1993 als Lehrerin (Besoldungsgruppe A 13) im Dienst des Landes Niedersachsen. 2003 wurde sie wegen Dienstunfähigkeit in den Ruhestand versetzt. Auf ihren Antrag hin wurde sie 2007 erneut in das Beamtenverhältnis berufen, wobei die von ihr zu unterrichtende Wochenstundenzahl entsprechend der festgestellten begrenzten Dienstfähigkeit um 50 % ermäßigt wurde. Sie erhielt Bezüge entsprechend denen einer Teilzeitbeschäftigten (50 % der Vollzeitbezüge). Diese waren höher als ihr bis dahin erdientes Ruhegehalt. Ein Zuschlag wurde ihr zunächst unter Hinweis auf die Aufzehrungsregelung verwehrt. Nach der Gesetzesänderung im Jahr 2015 wurde der Klägerin rückwirkend der Mindestzuschlag ausgezahlt. Das Bundesverwaltungsgericht hat das Verfahren mit Beschluss vom 18. Juni 2015 ausgesetzt und dem Bundesverfassungsgericht die Frage zur Entscheidung vorgelegt, ob § 24 Abs. 1 NBesG 2014 und § 24 Abs. 1 NBesG 2015 mit Art. 3 Abs. 1 und Art. 33 Abs. 5 GG vereinbar sind.
Wesentliche Erwägungen des Senats:
§ 24 Abs. 1 NBesG 2014, § 24 Abs. 1 NBesG 2015 und § 12 Abs. 1 bis 3 NBesG 2017 sind mit Art. 33 Abs. 5 GG nicht vereinbar.
1. Zu den hergebrachten Grundsätzen des Berufsbeamtentums, die durch die Regelung der Besoldung begrenzt dienstfähiger Beamter berührt werden, gehören die hauptberufliche Beschäftigung auf Lebenszeit, das Alimentationsprinzip, das Leistungsprinzip und das Abstandsgebot. Bei der Konkretisierung der hergebrachten Grundsätze besteht ein weiter Gestaltungsspielraum des Gesetzgebers. Dieser darf zur Umsetzung legitimer Gemeinwohlerwägungen und zur Auflösung zwischen den hergebrachten Grundsätzen bestehender Konflikte tätig werden. Wie bei der Kollision mit anderen Grundrechten, verfassungsrechtlichen Wertentscheidungen oder Instituten hat er die widerstreitenden Positionen entsprechend dem Grundsatz der praktischen Konkordanz in ihrer Wechselwirkung zu erfassen und im Wege der Abwägung so zu einem schonenden Ausgleich zu bringen, dass sie für alle Beteiligten möglichst weitgehend wirksam werden.
2. a) Der Gesetzgeber ist im Grundsatz berechtigt, auf ein vorzeitiges Ausscheiden von Beamten mit einer Verminderung der Versorgungsbezüge zu reagieren. Dies folgt nicht nur aus dem Leistungsgrundsatz, demzufolge sich die Länge der aktiven Dienstzeit in der Höhe der Versorgungsbezüge niederschlagen muss, sondern findet seine Rechtfertigung auch in dem Umstand, dass ein vorzeitiges Ausscheiden zu einem Ungleichgewicht zwischen Alimentierung und Dienstleistung, mithin zu einer Störung des wechselseitigen Pflichtengefüges, führt. Begrenzt dienstfähige Beamte befinden sich in einem „Teilzeitstatus besonderer Art“: Sie sind aktive Beamte, die auch dann Besoldung und keine Versorgungsbezüge erhalten, wenn das fiktive Ruhegehalt als Bemessungsgrundlage herangezogen wird. Die Herabsetzung der Arbeitszeit bei begrenzt dienstfähigen Beamten ist allerdings bei funktionaler Betrachtung mit einer teilweisen Zurruhesetzung vergleichbar. Vor diesem Hintergrund kann an die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zur versorgungsrechtlichen Behandlung des Vorruhestandes angeknüpft werden. Danach darf eine alimentationsrechtliche Regelung insbesondere (auch) darauf ausgerichtet werden, Fehlanreizen für eine verfrühte Pensionierung entgegenzuwirken.
b) Im Vergleich zur Versorgung von Ruhestandsbeamten ist der Gestaltungsspielraum des Gesetzgebers bei der Besoldung begrenzt dienstfähiger Beamter allerdings enger. Über das Abstandsgebot und das Gebot zur besoldungsrechtlichen Anerkennung eines Beförderungserfolges hinaus muss er dem Umstand Rechnung tragen, dass es sich um aktive Beamte handelt, die ihre verbliebene Arbeitskraft ganz für ihren Dienstherrn einsetzen. Deshalb hat er sich an der von ihm selbst für amtsangemessen erachteten Vollzeitbesoldung zu orientieren.
Für die Bezüge der im aktiven Dienst stehenden Beamten kommt der qualitäts- und stabilitätssichernden Funktion der Besoldung besondere Bedeutung zu. Die dienstliche Stellung der begrenzt dienstfähigen Beamten unterscheidet sich von derjenigen anderer Beamter lediglich im zeitlichen Umfang der Dienstleistungspflicht. Anders als bei einer Zurruhesetzung wegen Dienstunfähigkeit bleiben sie zur vollen Hingabe ihrer Arbeitskraft und zur loyalen Ausübung ihres Amtes verpflichtet.
Die Sicherung der wirtschaftlichen Unabhängigkeit des Beamten ist als strukturelle Voraussetzung für die Gewährleistung einer unabhängigen und nur Gesetz und Recht verpflichteten Amtsführung von grundlegender Bedeutung. Es gilt der Gefahr entgegenzuwirken, dass Beamte sich genötigt sehen könnten, eine unzureichende Alimentation durch Nebentätigkeiten aufzubessern, die sie in Loyalitätskonflikte führen können. Die Verpflichtung des Dienstherrn, sich bei der Bemessung der Alimentation am Leitbild des hauptberuflichen, seine ganze Arbeitskraft stets dem Dienstherrn widmenden Beamten und der damit einhergehenden amtsangemessenen Besoldung zu orientieren, rechtfertigt erst seine Befugnis, jede die Loyalität auch nur abstrakt beeinträchtigende Nebentätigkeit zu untersagen oder finanziell unattraktiv auszugestalten.
Die Besoldung muss zudem den Anforderungen an eine amtsangemessene Alimentation auch in den Fällen genügen, in denen begrenzt dienstfähige Beamte nicht auf Unterstützungsleistungen eines Ehe- oder Lebenspartners zurückgreifen können und umgekehrt selbst maßgeblich den Unterhalt ihrer Familie bestreiten müssen. Hierin liegt ein wesentlicher Unterschied zur freiwilligen Teilzeit, bei der der Dienstherr davon ausgehen kann, dass die Beamten ihre Entscheidung im Bewusstsein darüber getroffen haben, inwieweit sie für die Sicherung eines angemessenen Unterhalts auf die volle Besoldung angewiesen sind.
Die Besoldung begrenzt dienstfähiger Beamter, die unfreiwillig in verringertem Umfang Dienst leisten, darf sich folglich nicht allzu weit von dem Niveau entfernen, das der Gesetzgeber selbst als dem jeweiligen Amt angemessen erachtet hat. Die Vollzeitbesoldung und nicht die proportional zur geleisteten Arbeitszeit bemessene Teilzeitbesoldung muss daher den Ausgangspunkt seiner Überlegungen bilden.
Das Abstandsgebot und die Verpflichtung zur besoldungsrechtlichen Anerkennung des Beförderungserfolges sind bei der Besoldung begrenzt dienstfähiger Beamter in gleicher Weise wie bei derjenigen unbegrenzt dienstfähiger Beamter zu beachten. Dass die begrenzte Dienstfähigkeit bei funktionaler Betrachtung mit einer teilweisen Zurruhesetzung vergleichbar ist, eröffnet dem Gesetzgeber insofern keine zusätzlichen Spielräume. Denn beide Gebote wirken ungeschmälert in die Zeit des Ruhestands hinüber und erfordern auch unter den Versorgungsempfängern eine Differenzierung der Höhe des Ruhegehalts nach der Wertigkeit des zuletzt erreichten Amtes. Sie wären verletzt, wenn die amts- und dienstzeitunabhängige Mindestversorgung nicht auf Ausnahmefälle begrenzt bliebe oder die Bezüge ganzer Gruppen von Versorgungsempfängern nicht in nennenswertem Maße darüber lägen. Hinzu kommt, dass die Dienstleistungsverpflichtung begrenzt dienstfähiger Beamter gerade nicht durch (verfrühten) Eintritt in den Ruhestand beendet worden ist. Führte eine durch besondere Leistung des begrenzt dienstfähigen Beamten erreichte Beförderung zu keiner oder nur einer unwesentlichen Erhöhung der Bezüge, würden mit dem Abstandsgebot und dem Gebot zur besoldungsrechtlichen Anerkennung des Beförderungserfolgs tragende Säulen des Berufsbeamtentums umgestoßen, ohne dass dafür eine Rechtfertigung ersichtlich wäre.
3. § 24 Abs. 1 NBesG 2015 genügt diesen Maßstäben nicht.
a) Die Besoldung begrenzt dienstfähiger Beamter entfernt sich zu weit von der für amtsangemessen erachteten Vollzeitbesoldung. Bei einer auf 50 % begrenzten Dienstfähigkeit liegt die Besoldung der betroffen Beamten und Richter der Besoldungsgruppen A 11, A 13 und R 1 auch nach einer Dienstzeit von 25 Jahren bei nur rund 60 % der Vollzeitbezüge. Selbst im 35. Dienstjahr werden nur rund zwei Drittel der Vollzeitbezüge erreicht. Der Gesetzgeber hat sich folglich nicht nur gesetzestechnisch, sondern auch vom erreichten Besoldungsniveau her an der Teilzeit- und nicht an der Vollzeitbesoldung orientiert. Er hat die bestehende Konfliktlage einseitig zu Lasten der Beamten aufgelöst. Ihnen bürdet er das jedem Beamtenverhältnis immanente wirtschaftliche Risiko der verfrühten (Teil-)Dienstunfähigkeit im Wesentlichen alleine auf. Sie haben nämlich selbst dann eine Gehaltseinbuße von rund zwei Dritteln der Differenz zwischen Vollzeit- und Teilzeitbesoldung hinzunehmen, wenn sie zuvor ihre gesamte Arbeitskraft über 35 Jahre hinweg dem Dienstherrn zur Verfügung gestellt haben. Der Zuschlag des Dienstherrn beläuft sich in diesen Fällen auf nur rund 16 % beziehungsweise 17 % der Vollzeitbezüge. Tritt die begrenzte Dienstfähigkeit nach 25 bzw. 15 Dienstjahren ein, erleiden die Beamten sogar einen Einkommensausfall im Umfang von bis zu 80 % beziehungsweise 90 % der Differenz zwischen Teilzeit- und Vollzeitbezügen. Demgegenüber teilen sich in anderen Bundesländern Dienstherr und begrenzt dienstfähige Beamte die Differenz zwischen den der verbliebenen Dienstfähigkeit entsprechenden Teilzeit-bezügen und den Vollzeitbezügen hälftig: Die Beamten müssen bei einer verbliebenen Dienstfähigkeit von 50 % auf ein Viertel der Vollzeitbezüge verzichten, während ihr Dienstherr ein Viertel der Vollzeitbezüge als Zuschlag zahlt. Auch die Gesetzgebungsmaterialien, die Aufschluss über die für die Beurteilung der besoldungsrechtlichen Regelung bedeutsame Absicht des Gesetzgebers geben können, lassen nicht erkennen, dass § 24 Abs. 1 NBesG 2015 das Ergebnis einer auf die Herstellung praktischer Konkordanz zielenden Abwägungsentscheidung gewesen ist.
b) Zudem werden das Abstandsgebot und das Gebot zur besoldungsrechtlichen Anerkennung des Beförderungserfolgs missachtet. Bei Beamten, die mit 18 Jahren in den öffentlichen Dienst eingetreten sind und seither in Vollzeit beschäftigt waren, ist, wenn ihre Dienstfähigkeit nach einer 17-jährigen Dienstzeit auf 50 % herabgesetzt wird, der Abstand zwischen den verschiedenen Ämtern im einfachen und mittleren Dienst (A 4 bis A 8) eingeebnet. Auch bei einer zehn Jahre längeren Dienstzeit trifft dieser Befund noch auf die Besoldungsgruppen A 4 bis A 6 zu. Hier wirkt sich ein Beförderungserfolg während der aktiven Dienstzeit für begrenzt dienstfähige Beamte in finanzieller Hinsicht nicht aus. Bei 27-jähriger Dienstzeit wird darüber hinaus in den Besoldungsgruppen A 7 und A 8 nicht einmal die Hälfte des regulären Abstands erreicht. Der vom Besoldungsgesetzgeber selbst für amtsangemessen erachtete Abstand zwischen den Ämtern ist also in einer Vielzahl von Fällen vollständig aufgehoben oder erheblich vermindert. Das wird der Anforderung, dass die Bezüge entsprechend der unterschiedlichen Wertigkeit der Ämter abgestuft sind und dass sich für den Beamten die von ihm gezeigte Leistung durch besoldungsrechtliche Anerkennung des Beförderungserfolgs auch lohnt, in keiner Weise mehr gerecht. Diese Preisgabe des Abstandsgebots und des Gebots zur besoldungsrechtlichen Anerkennung des Beförderungserfolgs, die nicht auf Ausnahmefälle begrenzt bleibt, sondern sich über mehrere Laufbahngruppen hinweg erstreckt, ist allein durch den eingeschränkten Dienstleistungsumfang der begrenzt dienstfähigen Beamten nicht zu rechtfertigen.
4. § 24 Abs. 1 NBesG 2014 ist ebenfalls nicht mit Art. 33 Abs. 5 GG vereinbar. Die Vorschrift unterscheidet sich von § 24 Abs. 1 NBesG 2015 allein dadurch, dass sie sogar eine vollständige Aufzehrung des Zuschlags zulässt. Die Feststellung der Unvereinbarkeit mit Art. 33 Abs. 5 GG war aus Gründen der Rechtsklarheit auf die mit § 24 Abs. 1 NBesG 2015 im Wesentlichen identische Nachfolgeregelung des § 12 Abs. 1 bis 3 NBesG 2017 zu erstrecken.
Absenkung der Eingangsbesoldung in Baden-Württemberg verfassungswidrig
Pressemitteilung Nr. 82/2018 vom 28. November 2018
Beschluss vom 16. Oktober 2018
2 BvL
2/17
Der Zweite Senat hat mit heute veröffentlichtem Beschluss eine baden-württembergische Besoldungsregelung für nichtig erklärt, die eine Absenkung der Beamten- und Richtergehälter für die ersten drei Jahre des Dienstverhältnisses in bestimmten Besoldungsgruppen vorsah. Zur Begründung hat der Senat angeführt, dass Beamte nicht dazu verpflichtet sind, stärker als andere zur Konsolidierung öffentlicher Haushalte beizutragen. Eine Einschränkung des Grundsatzes der amtsangemessenen Alimentierung aus rein finanziellen Gründen kommt zur Bewältigung von Ausnahmesituationen nur in Betracht, wenn die Maßnahme Teil eines schlüssigen und umfassenden Konzepts der Haushaltskonsolidierung ist. Das notwendige Sparvolumen ist dabei gleichheitsgerecht zu erwirtschaften. Die Festlegung der Besoldungshöhe durch den Gesetzgeber ist zudem an die Einhaltung prozeduraler Anforderungen geknüpft. Trifft der Gesetzgeber zur Reduzierung der Staatsausgaben mehrere Maßnahmen in engem zeitlichem Zusammenhang, hat er sich mit den Gesamtwirkungen für die Beamtinnen und Beamten auseinanderzusetzen.
Sachverhalt:
Durch § 23 Abs. 1 des Landesbesoldungsgesetzes Baden-Württemberg (LBesGBW) vom 9. November 2010 in der Fassung des Art. 5 Nr. 1 des Haushaltsbegleitgesetzes 2013/14 vom 18. Dezember 2012 wurden zwischen dem 1. Januar 2013 und dem 31. Dezember 2017 unter anderem bei Richtern mit Anspruch auf Dienstbezüge aus der Besoldungsgruppe R 1 das Grundgehalt und etwaige Amtszulagen für die Dauer von drei Jahren nach Entstehen des Anspruchs um acht Prozent abgesenkt, nachdem zuvor bereits eine Absenkung um vier Prozent vorgesehen war. Der Kläger des Ausgangsverfahrens ist seit dem Jahr 2013 – zunächst als Staatsanwalt, später als Richter – im Dienst des Landes Baden-Württemberg tätig. Er erhielt für drei Jahre eine um acht Prozent reduzierte Besoldung nach der Besoldungsgruppe R 1. Hiergegen erhob er nach erfolgloser Durchführung des Widerspruchsverfahrens Klage beim Verwaltungsgericht Karlsruhe. Dieses hat das Ausgangsverfahren ausgesetzt und dem Bundesverfassungsgericht die Frage vorgelegt, ob § 23 Abs. 1 LBesGBW in der entscheidungserheblichen Fassung mit Art. 33 Abs. 5 GG vereinbar ist.
Wesentliche Erwägungen des Senats:
§ 23 LBesGBW verstößt gegen Art. 33 Abs. 5 GG in Verbindung mit Art. 3 Abs. 1 GG.
1. Die Regelung weicht von der aus dem Alimentationsprinzip hergeleiteten Maßgabe ab, wonach die Besoldungshöhe nach innerdienstlichen, unmittelbar amtsbezogenen Kriterien zu bemessen ist. Maßgeblich für die Anwendbarkeit der Vorschrift ist allein der erstmalige Eintritt in den baden-württembergischen Landesdienst. Hiervon sind auch Beamte und Richter betroffen, die vom Bund oder einem anderen Land nach Baden-Württemberg wechseln. Diesen Personen lässt der Landesgesetzgeber für die Dauer von bis zu drei Jahren nicht die Besoldung zukommen, die er selbst durch die Festschreibung in der Besoldungstabelle als für das jeweilige Amt angemessen erachtet hat.
2. Die vorgelegte Vorschrift wird auch den Anforderungen des Gebots der Besoldungsgleichheit aus Art. 33 Abs. 5 GG in Verbindung mit Art. 3 Abs. 1 GG nicht gerecht. Die Ungleichbehandlung liegt darin begründet, dass die Absenkungsmaßnahme nur einen Teil der Beamten- und Richterschaft trifft. Von der Regelung ausgenommen sind die Besoldungsgruppen bis einschließlich A 8, die Beförderungsämter in den höheren Besoldungsgruppen und die Besoldungsgruppen ab R 2 beziehungsweise W 2. Der Gleichheitssatz ist darüber hinaus dadurch beeinträchtigt, dass die Maßnahme nicht alle Stelleninhaber derselben Besoldungsgruppe betrifft. Namentlich bei Normerlass bereits im Dienst befindliche Beamte und Richter werden von der Norm nicht oder nur mit einer geringeren Absenkung erfasst. Es kommt also bei gleicher Ämterbewertung zu einer unterschiedlichen Besoldung der Stelleninhaber.
3. Diese Beeinträchtigungen lassen sich nicht durch sachliche Gründe rechtfertigen.
a) Das im Gesetzgebungsverfahren angeführte Ziel der Haushaltskonsolidierung trägt die Vorschrift nicht. Ein schlüssiges und umfassendes Konzept der Haushaltskonsolidierung, welches nach der Rechtsprechung des Senats notwendige Voraussetzung für die Belastung der Beamten- und Richterschaft mit Sparmaßnahmen ist und das anhand einer aussagekräftigen Begründung in den Gesetzgebungsmaterialien erkennbar werden muss, fehlt. Ein solches Konzept setzt wenigstens die Definition eines angestrebten Sparziels sowie die nachvollziehbare Auswahl der zu dessen Erreichung erforderlichen Maßnahmen voraus. Diesen Anforderungen wird das Gesetz nicht gerecht.
Unklar ist zunächst, welches Einsparvolumen zur Konsolidierung des Haushalts für erforderlich gehalten wird. Zwar bleibt es der politischen Entscheidung des Gesetzgebers überlassen, in welcher Größenordnung Einsparungen erfolgen sollen. Ohne eine Angabe hierzu lässt sich eine Aussage insbesondere zur Schlüssigkeit der vorgesehenen Maßnahmen aber nicht treffen. Vorliegend wird beispielweise nicht klar, ob bei Erlass des Gesetzes überhaupt ein klar beziffertes Sparziel formuliert war und welchen Anteil die Absenkung der Besoldung an den insgesamt notwendigen Kürzungsmaßnahmen letztlich hat; die Begründung des Gesetzentwurfs lässt lediglich erkennen, welches Sparvolumen voraussichtlich erreichbar sein werde. Auch wenn sich die Absenkung mit den anderen vorgesehenen Regelungen ins Verhältnis setzen lässt, schweigen die Gesetzgebungsmaterialien darüber, ob die Haushaltskonsolidierung noch weitere Maßnahmen erfordert oder ob die vorgesehenen Maßnahmen das eigentliche Sparziel bereits überschreiten.
Darüber hinaus lässt sich die Auswahl der zur Einsparung ergriffenen Mittel nicht nachvollziehen. Das Haushaltsbegleitgesetz 2013/14 sieht neben der Einführung einer „Schuldenbremse“ in die Landeshaushaltsordnung eine Reihe weiterer Sparmaßnahmen vor. Diese stehen aber auch unter Heranziehung der Gesetzgebungsmaterialien lediglich unverbunden nebeneinander. Die nur formelhaften Erwägungen im Gesetzentwurf sind zur Rechtfertigung des gesetzgeberischen Konzepts unzureichend. Es hätte wenigstens der konkreten Benennung der alternativ in Betracht gezogenen Mittel und der Gründe bedurft, die gegen deren Anwendung sprachen. Hinsichtlich der Sozialverträglichkeit und unter Gleichheitsgesichtspunkten wären nachvollziehbare Erläuterungen etwa zur Auswahl des von der Absenkungsregelung betroffenen Personenkreises und dazu erforderlich gewesen, warum in Bezug auf die bereits von der Norm erfassten Beamten und Richter gerade eine Verdoppelung des Absenkungsbetrages von vier auf acht Prozent erfolgte.
b) Auch die geringe Berufserfahrung der von der Norm Betroffenen rechtfertigt die Regelung nicht. Die Berufserfahrung der Beamten und Richter hat der Landesgesetzgeber durch die Einführung der Besoldungsbemessung nach Erfahrungsstufen bereits berücksichtigt. Die verfahrensgegenständliche Absenkung der Besoldung führt nicht zu einer zulässigen Präzisierung dieses Besoldungssystems. Sie kommt der Einführung einer individuellen Wartefrist gleich. Zu einer solchen hat der Senat bereits in einer früheren Entscheidung ausgeführt, dass die Besoldung kein Entgelt für bestimmte Dienstleistungen des Beamten darstellt, sondern vielmehr ein „Korrelat“ des Dienstherrn für die mit der Berufung in das Beamtenverhältnis verbundene Pflicht des Beamten, unter Einsatz seiner ganzen Persönlichkeit diesem – grundsätzlich auf Lebenszeit – seine volle Arbeitskraft zur Verfügung zu stellen. Das wahrgenommene Amt – und nicht die konkrete und möglicherweise noch zu verbessernde Tätigkeit – muss nach dem Alimentationsprinzip Maßstab für die Besoldung sein.
c) Soweit sich die Landesregierung zur Rechtfertigung der Vorschrift sinngemäß darauf beruft, diese honoriere eine mehrjährige Zugehörigkeit des Beamten oder Richters zum Dienstherrn, überzeugt dies ebenfalls nicht. Das Treueprinzip verlangt von den Beamten und Richtern von Beginn ihrer Tätigkeit an eine unbedingte Loyalität zu ihrem Dienstherrn. Für Differenzierungen auf Ebene der Besoldung ist daher kein Raum.
d) Die Belastung nur eines Teils der Beamten- und Richterschaft kann auch nicht mit sozialen Gesichtspunkten gerechtfertigt werden. Dies scheidet bereits deshalb aus, weil mit den Besoldungsgruppen ab R 2 und W 2 gerade solche Besoldungsempfänger von der Regelung ausgeschlossen sind, denen ein höheres Gehalt als den Normbetroffenen zusteht. Soweit Besoldungsgruppen mit niedrigerem Einkommen aus dem Anwendungsbereich der Norm herausgenommen werden, ist die Grenzziehung zwischen dem mittleren Dienst auf der einen und dem gehobenen Dienst ab der Besoldungsgruppe A 9 auf der anderen Seite nicht nachvollziehbar. Zwar kann eine höhere Belastung von Beziehern höherer Bezüge grundsätzlich gerechtfertigt sein, jedenfalls aber handelt es sich bei den der Besoldungsgruppe A 9 zugehörigen Beamten offensichtlich nicht um Empfänger höherer Bezüge.
4. Des Weiteren ergibt sich die Verfassungswidrigkeit der zur Prüfung gestellten Norm daraus, dass der Landesgesetzgeber den aus der Verfassung abgeleiteten Prozeduralisierungsvorgaben nicht genügt hat. Der Gesetzgeber schuldet vorliegend ausnahmsweise mehr als das Gesetz als solches. Während er bei der Haushaltskonsolidierung verpflichtet sein kann, mit der auch aus den Gesetzgebungsmaterialien ersichtlichen Aufstellung eines schlüssigen und umfassenden Sparkonzepts die Kostensenkungsmaßnahmen aller betroffenen Verwaltungsbereiche nachvollziehbar zu koordinieren, beziehen sich die Anforderungen der Prozeduralisierung unabhängig vom Regelungszweck allein auf Gesetzgebungsmaßnahmen im Besoldungsbereich. Sie sind also auch dann zu beachten, wenn die Neuregelung nicht dem Zweck der Kostenreduzierung dient. Ist dies aber – wie hier – der Fall, ergänzen sich die Vorgaben gegenseitig. Vorliegend lassen sich den Gesetzgebungsmaterialien keinerlei konkrete Erwägungen insbesondere zur Ausgestaltung des § 23 LBesGBW sowie dazu entnehmen, welche wirtschaftliche Bedeutung die Norm für sich genommen und im Zusammenspiel mit weiteren Vorschriften für die betroffenen Beamten und Richter hat. Es findet sich etwa keine Angabe dazu, warum der Absenkungsbetrag für die schon vor der Änderung von der Norm erfassten Besoldungsgruppen gerade auf acht Prozent erhöht und somit verdoppelt wurde. Zu den Wechselwirkungen mit den weiteren im Gesetz vorgesehenen Sparmaßnahmen schweigt die Begründung vollständig. Dabei wäre der Landesgesetzgeber aber vor allem angesichts deutlich spürbarer Maßnahmen im Beihilfebereich verpflichtet gewesen, sich nachvollziehbar mit der Frage zu befassen, ob die (weitere) Besoldungsabsenkung vor diesem Hintergrund überhaupt oder in ihrer Höhe gerechtfertigt erscheint.
Zur Begrenzung gerichtlicher Kontrolle durch den Erkenntnisstand der Fachwissenschaft
Pressemitteilung Nr. 81/2018 vom 23. November 2018
Beschluss vom 23. Oktober 2018
1 BvR 2523/13, 1 BvR 595/14
Stößt die gerichtliche Kontrolle nach weitestmöglicher Aufklärung an die Grenze des Erkenntnisstandes naturschutzfachlicher Wissenschaft und Praxis, zwingt Art. 19 Abs. 4 Satz 1 GG das Gericht nicht zu weiteren Ermittlungen, sondern erlaubt ihm, seiner Entscheidung insoweit die plausible Einschätzung der Behörde zu der fachlichen Frage zugrunde zu legen. Diese Einschränkung der Kontrolle folgt hier - anders als bei der Konkretisierung unbestimmter Rechtsbegriffe - nicht aus einer der Verwaltung eingeräumten Einschätzungsprärogative und bedarf nicht eigens gesetzlicher Ermächtigung. Auf dieser Grundlage hat der Erste Senat mit heute veröffentlichtem Beschluss zwei Verfassungsbeschwerden von Windkraftunternehmen als unzulässig verworfen. Dabei hat er aber auch klargestellt, dass der Gesetzgeber in grundrechtsrelevanten Bereichen Verwaltung und Gerichten nicht ohne weitere Maßgaben auf Dauer Entscheidungen in einem fachwissenschaftlichen „Erkenntnisvakuum“ übertragen darf. Vielmehr muss er jedenfalls auf längere Sicht für eine zumindest untergesetzliche Maßstabsbildung sorgen.
Sachverhalt:
Die Beschwerdeführerinnen begehrten die Erteilung einer immissionsschutzrechtlichen Genehmigung für Windenergieanlagen. Eine Genehmigung wurde in beiden Fällen wegen Unvereinbarkeit der Vorhaben mit § 44 Abs. 1 Nr. 1 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) versagt. Dieser verbietet, wild lebende Tiere besonders geschützter Arten zu töten. Das Tötungsverbot steht der Genehmigung entgegen, wenn sich durch das Vorhaben das Tötungsrisiko für die geschützten Tiere signifikant erhöht. Die Genehmigungsbehörden nahmen in beiden Fällen an, das Risiko der Kollision mit den geplanten Windenergieanlagen sei für Rotmilane signifikant erhöht. Die Klagen gegen die Versagung der Genehmigungen blieben bis in die Revisionsinstanz erfolglos. Die Verwaltungsgerichte gestanden der Genehmigungsbehörde dabei eine gerichtlich eingeschränkt überprüfbare „naturschutzfachliche Einschätzungsprärogative“ hinsichtlich der Erfassung des Bestandes und der Bewertung der von dem Vorhaben ausgehenden Risiken zu, weil die behördliche Beurteilung sich auf außerrechtliche Fragestellungen richte, für die allgemein anerkannte fachwissenschaftliche Maßstäbe und standardisierte Erfassungsmethoden zur Beurteilung des von Windenergieanlagen ausgehenden Risikos für Rotmilane fehlten. Mit der hiergegen gerichteten Verfassungsbeschwerde rügen die Beschwerdeführerinnen vor allem eine Verletzung ihres Rechts auf effektiven Rechtsschutz nach Art. 19 Abs. 4 Satz 1 GG durch die Einräumung einer behördlichen Einschätzungsprärogative.
Wesentliche Erwägungen des Senats:
Die Verfassungsbeschwerden entsprechen nicht dem Grundsatz der Subsidiarität. Die Beschwerdeführerinnen machen mit ihren Verfassungsbeschwerden geltend, dass für die aufgeworfenen außerrechtlichen Fragestellungen zum Tötungsrisiko für Rotmilane die nötigen naturschutzfachlichen Erkenntnisse bereits existieren. Dies hätten sie wegen der Subsidiarität der Verfassungsbeschwerde im fachgerichtlichen Verfahren rechtzeitig substantiiert vortragen müssen. Es ist nicht auszuschließen, dass sie damit die in ihren Augen verfassungswidrige Begrenzung der gerichtlichen Kontrolle hätten abwenden können, weil die Gerichte daraufhin, ihrem eigenen Ansatz folgend, möglicherweise die Voraussetzungen einer solchen Kontrollbegrenzung verneint hätten.
Der Kontrollansatz der Verwaltungsgerichte zu § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG ist nicht von vornherein mit der Verfassung unvereinbar.
Grundsätzlich kann es zu einer mit Art. 19 Abs. 4 Satz 1 GG vereinbaren Begrenzung der gerichtlichen Kontrolle führen, wenn die Anwendung eines Gesetzes tatsächliche naturschutzfachliche Feststellungen verlangt, zu denen weder eine untergesetzliche Normierung erfolgt ist noch in Fachkreisen und Wissenschaft allgemein anerkannte Maßstäbe und Methoden existieren. Soweit es zur Beantwortung einer sich nach außerrechtlichen naturschutzfachlichen Kriterien richtenden Rechtsfrage an normativen Konkretisierungen fehlt und in Fachkreisen und Wissenschaft bislang keine allgemeine Meinung über die fachlichen Zusammenhänge und die im Einzelfall anzuwendenden Ermittlungsmethoden besteht, stößt die verwaltungsgerichtliche Kontrolle an Grenzen. Dem Verwaltungsgericht ist es dann objektiv unmöglich, den Sachverhalt vollständig aufzuklären und eine abschließende Überzeugung davon zu gewinnen, ob das Ergebnis der Entscheidung der Behörde richtig oder falsch ist. Die Grenzen der gerichtlichen Kontrolle betreffen insoweit nicht die Konkretisierung unbestimmter Rechtsbegriffe (dazu BVerfGE 129, 1 <21ff.>) und ergeben sich hier nicht daraus, dass der Verwaltung eine Einschätzungsprärogative eingeräumt wäre, sondern rühren schlicht daher, dass sich die naturschutzfachliche Richtigkeit des Ergebnisses der Verwaltungsentscheidung objektiv nicht abschließend beurteilen lässt. Wenn die gerichtliche Kontrolle nach weitestmöglicher Aufklärung an die Grenze des Erkenntnisstandes der ökologischen Wissenschaft und Praxis stößt, zwingt Art. 19 Abs. 4 Satz 1 GG das Gericht nicht zu weiteren Ermittlungen, sondern erlaubt dem Gericht, seiner Entscheidung insoweit die Einschätzung der Behörde zu der fachlichen Frage zugrunde zu legen, wenn die von der Behörde verwendeten fachlichen Maßstäbe und Methoden vertretbar sind und die Behörde insofern im Ergebnis zu einer plausiblen Einschätzung der fachlichen Tatbestandsmerkmale einer Norm gelangt ist. Nach allgemeinen Grundsätzen bleibt aber auch dann noch verwaltungsgerichtlicher Kontrolle unterworfen, ob der Behörde bei der Ermittlung und der Anwendung der von ihr aus dem Spektrum des Vertretbaren gewählten fachlichen Methode Verfahrensfehler unterlaufen sind, ob sie anzuwendendes Recht verkannt hat, von einem im Übrigen unrichtigen oder nicht hinreichend tiefgehend aufgeklärten Sachverhalt ausgegangen ist, allgemeingültige Bewertungsmaßstäbe verletzt hat oder sich von sachfremden Erwägungen hat leiten lassen.
Verfassungsrechtliche Grenzen ergeben sich für den Gesetzgeber - ohne dass es in den vorliegenden Verfahren darauf ankam - in diesem Zusammenhang auch mit Blick auf die materiellen Grundrechte und den aus Demokratie- und Rechtsstaatsprinzip abgeleiteten Wesentlichkeitsgrundsatz. Der Gesetzgeber darf in grundrechtsrelevanten Bereichen der Rechtsanwendung nicht ohne weitere Maßgaben auf Dauer Entscheidungen in einem fachwissenschaftlichen „Erkenntnisvakuum“ übertragen, das weder Verwaltung noch Gerichte selbst auszufüllen vermögen. Er würde sich so seiner inhaltlichen Entscheidungsverantwortung entziehen. Jedenfalls auf längere Sicht muss er daher zumindest für eine untergesetzliche Maßstabsbildung sorgen.
Erfolgloser Eilantrag auf Untersagung von Äußerungen des Bundesinnenministers
Pressemitteilung Nr. 79/2018 vom 9. November 2018
Beschluss vom 30. Oktober 2018
2 BvQ 90/18
Mit heute veröffentlichtem Beschluss hat der Zweite Senat einen Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung der Partei Alternative für Deutschland (AfD) und der AfD-Bundestagsfraktion abgelehnt. Der Antrag war darauf gerichtet, dem Bundesinnenminister bis auf Weiteres zu verbieten, in seiner Eigenschaft als Minister bestimmte in einem Interview enthaltene Äußerungen zu tätigen und dieses Interview von der Homepage des Ministeriums zu entfernen. In dem Interview hatte der Bundesinnenminister erklärt, die Antragstellerinnen oder ihre Mitglieder stellten sich gegen den Staat und verhielten sich staatszersetzend. Zur Begründung hat der Senat insbesondere angeführt, dass kein Rechtsschutzbedürfnis besteht, weil die getätigten Aussagen bereits von der Internetseite des Ministeriums entfernt wurden und auch keine Anhaltspunkte für die Absicht einer Wiederholung der getätigten Aussagen von den Antragstellerinnen dargelegt wurden.
Sachverhalt:
Am 14. September 2018 veröffentlichte das Bundesministerium des Inneren, für Bau und Heimat auf seiner Internetseite ein Interview des Ministers mit der Deutschen Presse-Agentur. In dem Interview äußert sich dieser wie folgt über die Antragstellerinnen: „Die stellen sich gegen diesen Staat. Da können sie 1000 Mal sagen, sie sind Demokraten. Das haben sie am Dienstag im Bundestag miterleben können mit dem Frontalangriff auf den Bundespräsidenten. Das ist für unseren Staat hochgefährlich. Das muss man scharf verurteilen. Ich kann mich nicht im Bundestag hinstellen und wie auf dem Jahrmarkt den Bundespräsidenten abkanzeln. Das ist staatszersetzend.“ Das Interview kann seit dem 1. Oktober 2018 nicht mehr von der Homepage abgerufen werden. Die Partei Alternative für Deutschland und deren Bundestagsfraktion begehren mit dem Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung, dass dem Antragsgegner bis auf Weiteres untersagt wird, in seiner Eigenschaft als Bundesminister die besagten Äußerungen zu tätigen.
Wesentliche Erwägungen des Senats:
Der Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung hat keinen Erfolg.
1. Hinsichtlich der AfD-Bundestagsfraktion scheidet der Erlass einer einstweiligen Anordnung bereits deshalb aus, weil ein auf der Grundlage ihres Vorbringens in der Hauptsache gestellter Antrag mangels Antragsbefugnis unzulässig wäre. Parlamentsfraktionen sind zwar als notwendige Einrichtungen des Verfassungslebens im Organstreit befugt, eigene Rechte, wenn diese in der Verfassung verankert sind, und die Verletzung oder unmittelbare Gefährdung von Rechten des gesamten Parlaments geltend zu machen. Als im Organstreit verfolgbare eigene Rechte von Fraktionen kommen aber nur solche im innerparlamentarischen Raum in Betracht. Das Recht auf Chancengleichheit im Wettbewerb der politischen Parteien aus Art. 21 Abs. 1 Satz 1 GG, auf das die Fraktion sich in ihrem Antrag berufen hat, kann sie deshalb im Organstreit weder als eigenes Recht gegenüber dem Antragsgegner verfolgen, noch steht es dem Bundestag in seiner Gesamtheit zu.
2. Soweit das Begehren der AfD darauf gerichtet ist, dem Antragsgegner aufzugeben, sein Interview von der Homepage des Ministeriums zu entfernen, fehlt das Rechtsschutzbedürfnis für eine einstweilige Anordnung, weil diesem Begehren bereits Rechnung getragen ist. Das Interview kann seit dem 1. Oktober 2018 von der Homepage des von ihm geführten Ministeriums nicht mehr abgerufen werden. Eine einstweilige Anordnung, die dem Antragsgegner aufgeben würde, das Interview von der Homepage zu entfernen, ginge ins Leere.
3. Soweit das Begehren der AfD darauf gerichtet ist, dem Antragsgegner in seiner Funktion als Bundesinnenminister eine Wiederholung der im Interview vom 14. September 2018 getätigten Äußerungen in sonstiger Weise zu verbieten, betrifft der Antrag künftige Handlungen des Antragsgegners und ist damit auf die in Grundgesetz und Bundesverfassungsgerichtsgesetz grundsätzlich nicht vorgesehene Gewährung vorbeugenden vorläufigen Rechtsschutzes gerichtet. Dabei ist auf der Grundlage des Vorbringens der Antragstellerinnen auch nicht ersichtlich, dass die Gewährleistung effektiven Rechtsschutzes den Erlass der beantragten einstweiligen Anordnung erfordert. Dem steht bereits entgegen, dass es an konkreten Anhaltspunkten dafür fehlt, dass der Antragsgegner beabsichtigt, die angegriffenen Äußerungen unter Rückgriff auf die Autorität seines Regierungsamtes zu wiederholen. Hiervon kann angesichts der Löschung dieser Äußerungen auf der Homepage des Ministeriums nicht ohne Weiteres ausgegangen werden. Die Antragstellerinnen haben zwar vorgetragen, dass das Interview nur entfernt worden sei, damit der Antragsgegner die angegriffenen Äußerungen auf allen anderen, noch nicht verbotenen Kanälen umso öfter wiederholen könne. Dabei handelt es sich aber um eine bloße Mutmaßung, die mit keinerlei Tatsachen unterlegt ist. Auch aus dem Umstand, dass das Ministerium die Interview-Aussagen und deren vorübergehende Veröffentlichung auf der Homepage als mit dem Neutralitätsgebot vereinbar ansieht, ergibt sich nichts anderes. Insoweit handelt es sich lediglich um die Betonung eines Rechtsstandpunktes vor dem Hintergrund eines möglichen Hauptsacheverfahrens. Daraus kann nicht abgeleitet werden, dass der Antragsgegner seine angegriffenen Aussagen unter Einsatz der Autorität seines Regierungsamtes zu wiederholen gedenkt, ohne die Entscheidung in der Hauptsache abzuwarten.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|
|
|
|
Aus: Ausgabe vom 16.08.2018, Seite 5 / Inland
Streikbruchanreiz abgesegnet
Gericht: Prämie für Mitarbeiter, die sich nicht an Ausstand beteiligen, zulässig

Wenn schon kein Respekt
von den Gewerkschaftern, dann aber wenigstens Extrageld für Streikbrecher. So sehen das zumindest Deutschlands höchste Arbeitsrichter (1.-Mai-Demo in Nürnberg 2014)
Foto: Daniel Karmann/dpa/dpa-Bildfunk
|
Deutschlands höchste Arbeitsrichter haben entschieden: Unternehmer dürfen grundsätzlich Beschäftigte mit der Zusage von Prämien vom Streiken abhalten. Das geht aus einem am Dienstag abend bekanntgegebenen Urteil des Bundesarbeitsgerichts (BAG) in Erfurt hervor (Az.: 1 AZR 287/17).
Innerhalb eines Arbeitskampf sei es gerechtfertigt, Streikbrechern eine freiwillige Sonderleistung zu zahlen, hieß es in der Pressemitteilung des Gerichts zu dem Urteil vom Dienstag. Die in manchen Unternehmen gängige Praxis führe zwar zu einer Ungleichbehandlung zwischen den »Arbeitswilligen« und den Beschäftigten die sich am Ausstand beteiligen. Diese sei jedoch noch verhältnismäßig, so die Erfurter Richter.
Konkret ging es bei der Verhandlung um die Klage eines Verkäufers des Spielwarenhändlers Toys ’R’ Us aus dem Raum Braunschweig. Die Gewerkschaft Verdi hatte dort 2015 und 2016 versucht, mit Streiks die Firma zur Anerkennung regionaler Einzelhandelstarifverträge zu bewegen. An diesen hatte sich der Kläger beteiligt. Im Nachgang wollte der Beschäftigte unter Verweis auf den arbeitsrechtlichen Gleichbehandlungsgrundsatz gerichtlich erreichen, dass ihm der Einzelhändler die während der Arbeitsniederlegungen ausgelobten Prämien ebenfalls auszahlen muss. Insgesamt wären dies 1.200 Euro brutto gewesen. Den Streikbrechern hatte das Unternehmen zunächst bis zu 200 Euro brutto pro Tag zusätzlich in Aussicht gestellt. Während des Arbeitskampfes verringerte die Firma die Zahlung dann auf 100 Euro brutto.
Die offerierten Prämien seien nicht unangemessen, sondern verhältnismäßig gewesen, urteilten nun die Erfurter Bundesrichter, auch wenn diese den Tagesverdienst streikender Verkäufer um ein Mehrfaches überstiegen hätten. Es sei aus arbeitskampfrechtlichen Gründen gerechtfertigt gewesen, dass das Unternehmen mit den Sonderleistungen dem Streik und »betrieblichen Ablaufstörungen« entgegenwirken wollte. »Vor dem Hintergrund der für beide sozialen Gegenspieler geltenden Kampfmittelfreiheit handelt es sich um eine grundsätzlich zulässige Maßnahme des Arbeitgebers«, stellte der Erste Senat des BAG fest.
Mit der Klage war der Verkäufer bereits in den Vorinstanzen gescheitert. Streikbruchprämien werden nach Ende eines Ausstandes laut einer Gerichtssprecherin mitunter tatsächlich auch an Mitarbeiter ausgezahlt, die zuvor die Arbeit niedergelegt haben. Häufig würde eine solche Regelung danach in dem ausgehandelten Tarifvertrag festgelegt. Im konkreten Fall war allerdings kein entsprechender Abschluss zwischen der Kapitalseite und der Gewerkschaft zustande gekommen. (dpa/jW)
Liberty and Peace NOW! Human Rights Reporters – www.libertyandpeacenow.org / www.humanrightsreporters.wordpress.com
Skripal-Skandal: Strafanzeige gegen Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel und Bundesaußenminister Heiko Maas
Führten falsche Anschuldigungen zu „vergifteten“ diplomatischen Beziehungen zwischen Deutschland und Russland? Russland fordert Entschuldigung – Rechtsanwalt in Deutschland hat Strafanzeige erstattet
London/Berlin/Selfkant. 4. April 2018. Der Fall Sergeij Skripal in Groß Britannien könnte möglicherweise auch für Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel und Bundesaußenminister Heiko Maas ein juristisches Nachspiel haben. Rechtsanwalt Wilfried Schmitz (48) aus Selfkant bei Aachen hat am 2. April 2018 wegen des Skandals und dessen Folgen um einen möglichen Giftgas-Anschlag
2
Liberty and Peace NOW! Human Rights Reporters – www.libertyandpeacenow.org / www.humanrightsreporters.wordpress.com
Strafanzeige bei der Generalbundesanwaltschaft in Karlsruhe gegen Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel (CDU) und Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) erstattet.
Der Jurist hat die Strafanzeige wegen der öffentlichen Beschuldigung Russland und der russischen Förderation, für einen – „angeblichen Giftgas-Anschlag“ – in Salisbury in Großbritannien verantwortlich zu sein, erstattet. Die Strafanzeige richtet sich gegen Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel (CDU) und Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) wegen aller „in Betracht kommenden Straftatbestände“ insbesondere wegen des Tatverdachts der Volksverhetzung gemäß Paragraph 130 des Strafgesetzbuchs (StGB) und der möglichen Aufstachelung zum Verbrechen der Aggression (gemäß Paragraph 13 VStGB (Völkerstrafgesetzbuch), der üblen Nachrede nach § 186 StGB und wegen möglicher Verleumdung nach § 187 StGB sowie des Vortäuschens einer Straftat nach § 145 StGB.
Der für britische Geheimdienste früher tätige EX-Oberst der russischen Militäraufklärung GRU Sergej Skripal (66) und seine Tochter Julia (33) sind am 4. März 2018 im britischen Salisbury vergiftet worden. Die britische Regierung, vertreten von Premierministerin Theresa May, hat behauptet an der Vergiftung Skripals mit dem Stoff A234 sei „höchstwahrscheinlich“ der russische Staat beteiligt gewesen. Diese offenbar falschen Anschuldigungen wurden von Russland von Anbeginn entschieden zurückgewiesen und Russland hat eine objektive Untersuchung gefordert.
Die britische Premierministerin Theresa May hat Russland öffentlich des Verbrechens beschuldigt ohne Beweise der Öffentlichkeit zu präsentieren. Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel und Bundesaußenminister Heiko Maas folgten aus Solidarität den Anschuldigungen der britischen Premierministerin. Aus Gründen der Solidarität für Groß Britannien haben Deutschland und weitere Nationen zahlreiche russische Diplomaten ausgewiesen. Die Ausweisung der
3
Liberty and Peace NOW! Human Rights Reporters – www.libertyandpeacenow.org / www.humanrightsreporters.wordpress.com
russischen Diplomaten beantwortete Russland mit der Ausweisung zahlreicher Diplomaten der Nationen, die zuvor russische Diplomaten ausgewiesen hatten.
Der Präsident von Russland Wladimir Putin nannte den britischen Vorwurf, Russland habe das Gift im Fall Skripal geliefert, so wörtlich als „verrückt“, berichtet das Nachrichten-Magazin Spiegel. Man müsse sich auf „irgendeine Weise bei Russland entschuldigen“, sagte der Sprecher des Kreml, Dmitrij Peskow der Agentur Interfax zufolge am Dienstag bei einem Besuch des russischen Präsidenten Wladimir Putin in der Türkei.
Medien-Berichten zufolge (Tagesschau, Spiegel), habe ein britisches Labor, das den Fall untersucht, kurze Zeit zuvor erklärt, es gebe keine präzisen Hinweise, dass das Gift aus Russland gekommen sei.
Peskow erklärte zu den neuen Erkenntnissen, dass sich die Theorie aus Groß Britannien habe nicht bestätigen lassen, weil es unmöglich sei, eine solche Theorie zu bestätigen. Russland habe von Anfang an mitgeteilt, dass es nichts mit dem Fall zu tun habe.
Quellen und weiterführende Informationen:
1. Welt.de, „Theresa May: Russland höchstwahrscheinlich für Gift Attacke verantwortlich“, https://www.welt.de/politik/ausland/article174485147/Theresa-MayRussland-hoechstwahrscheinlich-fuer-Gift-Attacke-verantwortlich.html 2. Russland fordert Entschuldigung von Groß Britannien, http://www.spiegel.de/politik/ausland/sergej-skripal-russland-fordertentschuldigung-von-grossbritannien-a-1201114.html 3. Rechtsanwalt Wilfried Schmitz, Aktuelles, Web Site, Strafanzeige im Fall Skripal gegen Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel und Bundesaußenminister Heiko Maas vom 2. April 2018, https://www.rechtsanwalt-wilfriedschmitz.de/aktuelles
4
Liberty and Peace NOW! Human Rights Reporters – www.libertyandpeacenow.org / www.humanrightsreporters.wordpress.com
4. Russland fordert Entschuldigung, https://www.tagesschau.de/ausland/skripal-opcw-105.html
Die falschen Anschuldigungen im Fall Skripal in Groß Britannien haben jetzt zu einer neuen Strafanzeige von Rechtsanwalt Wilfried Schmitz aus Selfkant gegen Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel und Bundesaußenminister Heiko Maas geführt. Foto und Infografik: and
Impressum, Verlag und Redaktion: Liberty and Peace NOW! Human Rights Reporters, internationales MedienProjekt für Frieden und Menschenrechte, Andreas Klamm Sabaot, Journalist, Autor, Schriftsteller, Moderator, Gründer, Redaktions- und Projektleitung von Liberty and Peace NOW! (nach dem gleichnamigen Buch von Andreas Klamm – Sabaot) Schillerstr. 31, D 67141 Neuhofen, Verbandsgemeinde Rheinauen, Rhein-Pfalz-Kreis, RheinlandPfalz, Deutschland (Germany), Tel. 0621 5867 8054, Tel. 030 57 700 592, Fax 06236 48 90 449, E-Mail: andreas
Bottroper Gericht spricht DKP-Ratsherrn frei – und droht für das nächste Mal
Heute hat die Klassenjustiz nicht zugeschlagen“, sagt der DKP-Vorsitzende Patrik Kцbele, nachdem das Amtsgericht Bottrop den dortigen DKP-Ratsherrn Michael Gerber freigesprochen hat, „aber sie hat
die Instrumente gezeigt“.
Diese Klassenjustiz präsentiert sich am Donnerstag vergangener Woche liberal. Angeklagt ist Gerber, weil er im Herbst 2016 die Bürger seiner Stadt darüber informiert hat, dass der Vorstand die
Erfolgsbeteiligung der Beschäftigten von 150 000 auf 100 000 Euro kürzen wollte. Die beiden Vorstände sollten aber weiterhin Boni von 7 000 bzw. 6 500 Euro bekommen, nur die DKP stimmte dagegen. Das
hatte der Verwaltungsrat, in dem Gerber sitzt, in einer nichtöffentlichen Sitzung beschlossen – Gerber hat also, so die Klage, nach § 203 des Strafgesetzbuches ein „Privatgeheimnis“ verletzt. Die
Richterin sagt in ihrer Urteilsbegründung, sie verstehe das politische Anliegen hinter Gerbers Handeln, sie deutet an, dass sie eine Einstellung des Verfahrens fьr sinnvoll hält. Auch der
Staatsanwalt räumt in seinem Plädoyer ein, dass Gerbers „politische Motive“ „nachvollziehbar sein mögen“.
Aber bei allem Respekt, den Richterin und Staatsanwalt fьr Überzeugungen und freie Meinungsäußerung herausstellen: Sie sind sich einig, dass Gerber eine Straftat begangen hat. Der Staatsanwalt
fordert eine Geldstrafe von 60 Tagessätzen а 30 Euro, die Richterin spricht ihn nur deshalb frei, weil er einem „Verbotsirrtum“ unterlegen sei: Er habe nicht gewusst, dass im Verwaltungsrat eben
nicht nur als vom Stadtrat gewählter Vertreter des Rates sitzt, sondern als „fьr den öffentlichen Dienst besonders Verpflichteter“, als „Amtsträger“. Deshalb verurteilt sie ihn nicht, lässt aber
keinen Zweifel daran, dass er in einem ähnlichen Fall in Zukunft mit einer Bestrafung rechnen muss.
Die „Best“, die Bottroper Entsorgung und Stadtreinigung, gehört vollstдndig der Stadt. Als die „Best“ als Anstalt des öffentlichen Rechts gegrьndet und damit aus der Stadtverwaltung ausgegliedert
wurde, haben Michael Gerber und die DKP das bereits kritisiert: Mit dieser Rechtsform werde die öffentliche Kontrolle des Unternehmens schwerer, es handele sich um eine „Einschränkung der kommunalen
Demokratie“, stellt er vor Gericht fest. Im Prozess zeigt sich, wo diese Schranken der Demokratie verlaufen.
Bevor der „Best“-Vorstand der Belegschaft die im Tarifvertrag vorgesehene Erfolgsbeteiligung kürzte, hatte er mit Schikanen und unangemessenen Kontrollen den Personalrat gegen sich aufgebracht. So
stellt Gerber die Sache in seiner Erklärung vor Gericht dar – der „Best“-Vorstand war für UZ nicht zu erreichen. „Wir haben auf unseren Gehaltsstreifen geschaut und gesehen: Die Erfolgsbeteiligung
ist weniger als in den letzten Jahren“, sagt ein „Best“-Mitarbeiter, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen möchte, gegenüber UZ. „Und dann liest man in den ‚UZ-Notizen‘“ – der Zeitung der DKP
Bottrop -, „dass nur bei den Mitarbeitern gekьrzt worden ist und nicht bei den Vorständen. Bei uns kann man das Geld wohl wegnehmen, bei den obersten Etagen bleibt alles gleich. Durch die
Informationen, die Herr Gerber öffentlich gemacht hat, wussten wir dann, warum das so ist – wir haben uns gedacht: Oh, der traut sich was.“
Das Geld der Mitarbeiter war gekürzt worden, obwohl die „Best“ Gewinne macht. Im Fall Gerber geht es darum, wie die Kommune Mitarbeiter ihres Unternehmens bezahlt und behandelt, wie die öffentliche
Daseinsvorsorge organisiert ist und wer sie kontrolliert. Niedrige Müllgebühren und gute Versorgung fьr die Bevölkerung, anständige Löhne für die Mitarbeiter – dafür setzt sich die DKP Bottrop auch
mit ihren zwei Mandaten im Rat der Stadt ein, deshalb hat Michael Gerber sich in den „Best“-Verwaltungsrat wählen lassen. Im Prozess geht es um die Frage, welche Aufgaben und Pflichten er dort hat.
Für den Staatsanwalt ist klar: Es gehe nur um eine „verwaltungstechnische“ Aufgabe, im Verwaltungsrat „soll keine Politik betrieben werden“. Gerber habe nun nicht nur die Bonuszahlungen
verцffentlicht – sondern das auch noch „politisch instrumentalisiert“, indem er dazu sagte, dass nur die DKP gegen den Vorschlag des Vorstands war. Für den Staatsanwalt ist gerade das entscheidend –
die Bezüge der Vorstände hat die Stadt später selbst veröffentlicht, aber das Ergebnis der nichtöffentlichen Abstimmung sei in jedem Fall geheim.
Der Sache nach sind die Informationen, um die es geht, für die Öffentlichkeit wichtig und politisch. Dem Recht nach – so, wie die Richterin die Rechtsprechung auslegt – sind sie privat: Die „Best“
ist ein Unternehmen, ein Unternehmen darf Geschäftsgeheimnisse haben. Und Gerber sitzt nach diesem Recht im Verwaltungsrat nicht einfach als Ratsherr, als Abgeordneter, der den Vorstand kontrolliert.
Gerber sei durch diesen Sitz ein „Amtsträger“, ein „für den öffentlichen Dienst besonders Verpflichteter“ – schließlich sei der Sitz im Verwaltungsrat nicht direkt an das Mandat gebunden. Die
besondere Pflicht heißt, dass Gerber sich der Geheimniskrämerei unterordnen muss, sonst macht er sich strafbar. „Als Abgeordneter, der in einen Verwaltungsrat gewählt wird, begibt Gerber sich nicht
in ein Dienst- und Unterordnungsverhältnis, sondern er ist den Bürgern verpflichtet“, sagt Gerbers Verteidiger Herbert Lederer nach dem Prozess. „Er versteht sich als Kontrolleur der
Geschäftsleitung, nicht als Knecht. Die Einstufung eines frei gewählten Abgeordneten als Amtstrдger ist mit meinem Demokratieverständnis nicht zu vereinbaren.“
Nach der Juristenlogik ist die öffentliche Daseinsvorsorge eine private Angelegenheit, wenn sie von Unternehmen übernommen wird, die Information, die die Bürger der Stadt interessiert, ist ein
Privatgeheimnis. Gerber sagte nach dem Prozess, das Urteil „schränkt die künftige Ausübung des freien politischen Mandats erheblich ein“ – im UZ-Interview stellt er aber klar: „Ich lasse mir keinen
Maulkorb verpassen.“ Ob es bei dem Freispruch – und beim liberalen Anstrich der Klassenjustiz – bleibt, wird sich zeigen: Die Staatsanwaltschaft Essen hat Berufung gegen das Urteil eingelegt.
Vorab aus der UZ vom 10. Juli
Vorschriften über die Pflicht zur Abgabe landwirtschaftlicher Höfe als Voraussetzung eines Rentenanspruchs verfassungswidrig
Pressemitteilung Nr. 68/2018 vom 9. August 2018
Beschluss vom 23. Mai 2018
1 BvR
97/14, 1 BvR 97/14, 1 BvR 2392/14
Die Koppelung einer Rente an die Abgabe eines landwirtschaftlichen Hofs greift faktisch in die Eigentumsfreiheit des Art. 14 GG ein. Die Pflicht zu einer solchen Hofabgabe wird verfassungswidrig, wenn diese in unzumutbarer Weise Einkünfte entzieht, die zur Ergänzung einer als Teilsicherung ausgestalteten Rente notwendig sind. Darüber hinaus darf die Gewährung einer Rente an den einen Ehepartner nicht von der Entscheidung des anderen Ehepartners über die Abgabe des Hofs abhängig gemacht werden. Mit dieser Begründung hat der Erste Senat des Bundesverfassungsgerichts mit heute veröffentlichtem Beschluss die einschlägigen Vorschriften für verfassungswidrig erklärt, den Verfassungsbeschwerden eines Landwirtes und der Ehefrau eines Landwirtes stattgegeben und die Verfahren unter Aufhebung der Gerichtsentscheidungen an das Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen zurückverwiesen.
Sachverhalt:
Die Alterssicherung der Landwirte ist die berufsständische Altersvorsorge der Landwirtinnen und Landwirte in Deutschland. Sie ist Teil der gesetzlichen Rentenversicherung. Gesetzliche Grundlage ist das Gesetz über die Alterssicherung der Landwirte (ALG). Dieses sieht die Abgabe des landwirtschaftlichen Hofs als eine der Voraussetzungen eines Rentenanspruchs vor.
I. Die Beschwerdeführerin in dem Verfahren 1 BvR 97/14 ist im Jahr 1944 geboren und mit einem im Jahr 1940 geborenen Land- und Forstwirt verheiratet. Als Ehegattin eines landwirtschaftlichen Unternehmers gilt sie gemäß § 1 Abs. 3 Satz 1 ALG als Landwirt.
Den Rentenantrag der Beschwerdeführerin aus dem Jahr 2011 lehnte der zuständige Träger der Alterssicherung der Landwirte ab, weil ihr Ehegatte bereits die Regelaltersgrenze erreicht und das landwirtschaftliche Unternehmen noch nicht abgegeben hatte.
Die deswegen von der Beschwerdeführerin vor dem Sozialgericht erhobene Klage hatte - auch in der Berufungsinstanz - keinen Erfolg. Das Bundessozialgericht wies die Beschwerde gegen die Nichtzulassung der Revision und die dagegen erhobene Anhörungsrüge zurück.
II. Der im Jahr 1938 geborene Beschwerdeführer in dem Verfahren 1 BvR 2392/14 betreibt ein landwirtschaftliches Unternehmen. Die Landwirtschaftliche Alterskasse lehnte den Rentenantrag des Beschwerdeführers aus dem Jahr 2010 ab, weil dessen landwirtschaftliche Nutzfläche die zulässige Rückbehaltsfläche von 6 Hektar um ein Vielfaches überschritten habe und deshalb das landwirtschaftliche Unternehmen nicht abgegeben war. Das Sozialgericht wies die hiergegen gerichtete Klage ab. Die Berufung des Beschwerdeführers vor dem Landessozialgericht und die sich anschließende Beschwerde gegen die Nichtzulassung der Revision hatten, ebenso wie die Anhörungsrüge, keinen Erfolg.
Wesentliche Erwägungen des Senats:
I. Die Pflicht zur Hofabgabe als Voraussetzung eines Rentenanspruchs nach dem Gesetz über die Alterssicherung der Landwirte erweist sich als Eingriff in die grundrechtlich geschützte Eigentumsfreiheit (Art. 14 Abs. 1 GG).
1. In durch Art. 14 Abs. 1 GG geschützte Rentenanwartschaften oder Rentenansprüche der Beschwerdeführer wird aber nicht eingegriffen. Denn nach dem Gesetz über die Alterssicherung der Landwirte schafft die Abgabe des Unternehmens der Landwirtschaft erst die Voraussetzungen für die Entstehung von Anwartschaften und Ansprüchen auf eine Rente im Bereich der Alterssicherung der Landwirte und kann somit in Bezug auf diese Rechtspositionen Art. 14 Abs. 1 Satz 1 GG nicht verletzen.
2. Hingegen liegt ein Eingriff in das Sacheigentum des
Beschwerdeführers in dem Verfahren
1 BvR 2392/14 an dem landwirtschaftlichen Unternehmen vor. Denn ein Grundrechtseingriff kann nicht nur in einem rechtsförmigen Vorgang liegen, der unmittelbar und gezielt durch ein vom Staat
verfügtes, erforderlichenfalls zwangsweise durchzusetzendes Gebot oder Verbot, also imperativ, zu einer Verkürzung grundrechtlicher Freiheiten führt. Als Beeinträchtigung eines Grundrechts können
vielmehr auch staatliche Maßnahmen anzusehen sein, die mittelbar faktisch eine eingriffsgleiche Wirkung entfalten. Dies ist bei der Hofabgabeklausel der Fall. Ein Rentenanspruch steht dem Landwirt
nur dann zu, wenn er das landwirtschaftliche Unternehmen entsprechend einer der in § 21 ALG genannten Alternativen abgibt. Insofern wird auf den Landwirt ein mittelbarer, faktischer Druck zur Abgabe
des landwirtschaftlichen Unternehmens erzeugt. Der Landwirt kann sich zwar nach wie vor frei entscheiden, ob er das Unternehmen abgibt oder weiterführt; aber nur im Falle der Abgabe erhält er eine
Rente. Nur wenn eine Rente bewilligt wird, war es jedoch für den Landwirt letztendlich wirtschaftlich sinnvoll, jahrzehntelang Beiträge zur Alterssicherung der Landwirte zu leisten. Bei der
Nichtabgabe des landwirtschaftlichen Unternehmens erhält er für diese Beitragsleistung keine Gegenleistung. Die geleisteten Beiträge gehen vollständig verloren. Die Wirkung des Verlustes der
geleisteten Beiträge bei der Nichtabgabe des landwirtschaftlichen Unternehmens wird dadurch verstärkt, dass Landwirte nicht frei entscheiden können, ob sie Beiträge zur landwirtschaftlichen
Alterssicherung leisten, da sie versicherungs- und beitragspflichtig sind.
II. Mangels einer Güterbeschaffung zugunsten des Staates oder eines Dritten zum Wohl der Allgemeinheit liegt hierin keine Enteignung, sondern eine Inhalts- und Schrankenbestimmung im Sinne des Art. 14 Abs. 1 Satz 2 GG. Diese ist nur nach den folgenden Maßgaben gerechtfertigt.
1. Nach Art. 14 Abs. 1 Satz 2 GG werden Inhalt und Schranken des Eigentums durch Gesetz bestimmt. Ein solches Gesetz ist § 11 Abs. 1 Nr. 3 ALG, wonach ein Anspruch auf eine Regelaltersrente nach dem Gesetz über die Alterssicherung der Landwirte nur dann besteht, wenn das Unternehmen der Landwirtschaft abgegeben ist. Der Eingriff im Rahmen der Inhalts- und Schrankenbestimmung in die durch Art. 14 Abs. 1 Satz 1 GG geschützten Rechte muss durch Gründe des öffentlichen Interesses unter Beachtung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit gerechtfertigt sein.
2. Die Hofabgabe als Voraussetzung eines Rentenanspruchs nach dem Gesetz über die Alterssicherung der Landwirte entspricht jedoch nur mit folgenden Maßgaben dem Verhältnismäßigkeitsprinzip.
a) Der Gesetzgeber verfolgt mit der Hofabgabeklausel mehrere legitime, agrarstrukturelle Ziele. Ein Ziel ist die Förderung der frühzeitigen Hofübergabe an Jüngere, um hierdurch eine Senkung des durchschnittlichen Lebensalters der Betriebsleiterinnen oder Betriebsleiter zu bewirken. Die Hofabgabeklausel will somit einen Beitrag zur Übergabe von landwirtschaftlichen Unternehmen zu einem wirtschaftlich sinnvollen Zeitpunkt an jüngere Kräfte leisten. Im Weiteren geht es dem Gesetzgeber um die Funktion der Hofabgabe für den Bodenmarkt vor dem Hintergrund der das Angebot deutlich übersteigenden Nachfrage nach landwirtschaftlichen Flächen und des starken Anstiegs der Pachtpreise. Darüber hinaus verfolgt die Hofabgabeklausel das Ziel der Verbesserung der Betriebsstruktur durch die Schaffung größerer Entwicklungschancen für Wachstumsbetriebe. Diese können ihren Aufstockungsbedarf aus den frei werdenden landwirtschaftlichen Nutzflächen früher befriedigen, als dies ohne ein Abgabeerfordernis möglich wäre.
b) Zur Erreichung dieser Ziele ist die Hofabgabeklausel nicht von vornherein untauglich. Verfassungsrechtlich genügt für die Eignung der Regelung die Möglichkeit, dass der erstrebte Erfolg gefördert werden kann, dass also die Möglichkeit der Zweckerreichung besteht. Es besteht zwar keine Pflicht zur Hofabgabe; im Fall der Nichtabgabe des Unternehmens entfällt aber die Gegenleistung in Form einer Rente für jahrelange Beitragsleistungen. Der Landwirt unterliegt daher einem faktischen Zwang zur Hofabgabe. Verfassungsrechtlich ist die Mitursächlichkeit der Hofabgabeklausel für den Strukturwandel in der Landwirtschaft ausreichend. Die Auswertung einer Stichprobe bezüglich des Abgabeverhaltens des Rentenzugangs in der Alterssicherung der Landwirte im Jahr 2011 hat die positiven agrarstrukturellen Effekte der Hofabgabeklausel bestätigt.
c) Der Gesetzgeber durfte davon ausgehen, dass die Hofabgabeklausel erforderlich ist, da kein milderes Mittel zur Verfügung steht. Das Bundesverfassungsgericht prüft nicht, ob der Gesetzgeber die beste Lösung für die hinter einem Gesetz stehenden Probleme gefunden hat, denn er verfügt über einen Beurteilungs‑ und Prognosespielraum.
d) Die Verpflichtung zur Hofabgabe ist jedoch nicht in allen Fällen zumutbar. Eine Gesamtabwägung zwischen der Schwere des Eingriffs einerseits und dem Gewicht und der Dringlichkeit der ihn rechtfertigenden Gründe andererseits muss die Grenze der Zumutbarkeit wahren. Die Regelung darf die Betroffenen nicht übermäßig belasten.
aa) Das Erfordernis der Hofabgabe als Voraussetzung eines Rentenanspruchs wahrt nicht mehr die Grenze der Zumutbarkeit, soweit das Gesetz über die Alterssicherung der Landwirte keine Härtefallregelung für die Hofabgabe vorsieht. Härtefälle entstehen vornehmlich, wenn der abgabewillige Landwirt keinen zur Hofübernahme bereiten Nachfolger findet. In diesem Fall kann der landwirtschaftliche Unternehmer die Hofabgabe nur in einer der Formen vollziehen, die nicht mit einer Einkommenserzielung verbunden sind, also durch Unmöglichmachung der landwirtschaftlichen Nutzung, Stilllegung, Aufgabe des Fischereiausübungsrechts, Aufgabe des Unternehmens der Imkerei oder Wanderschäferei oder Aufforstung. Dann fehlen ein Kaufpreis oder Pachtzins zur Sicherung des Alters und die Hofabgabepflicht wird unzumutbar. Härtefälle entstehen aber auch dann, wenn das landwirtschaftliche Unternehmen zwar abgegeben werden könnte, dies jedoch nicht zu Einkünften des Landwirts führen würde, mit Hilfe derer er seinen Lebensunterhalt in Ergänzung der Rente sicherstellen kann. In diesen Fällen wird die Pflicht zur Hofabgabe unzumutbar, denn der abgebende Landwirt wird zur Erlangung der Rente gezwungen, seine andere Finanzquelle für das Alter aufzugeben oder zu reduzieren, obwohl seine Rente nur als Teilsicherung angelegt ist und die Einkünfte aus dem abgegebenen Hof dies nicht angemessen ergänzen.
bb) Insgesamt ist die angegriffene Regelung infolge der mit den vorliegenden Verfassungsbeschwerden nicht angegriffenen Änderung des § 21 Abs. 9 ALG zum 1. Januar 2016 durch Art. 3 Nr. 3 d) des Gesetzes zur Änderung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch und weiterer Vorschriften vom 21. Dezember 2015 unzumutbar geworden, weil sie inzwischen tatsächlich nur noch eine kleine Gruppe von Landwirten erfasst und ihnen damit im Vergleich zu anderen Landwirten eine unangemessene Last zumutet. Der Gesetzgeber ist bei der inhaltlichen Festlegung von Eigentümerbefugnissen und -pflichten nach Art. 14 Abs. 1 GG auch an den Gleichheitssatz des Art. 3 Abs. 1 GG gebunden. Dem wird die Regelung nach der Gesetzesänderung nicht mehr gerecht. Die Neuregelung hat die Hofabgabe unter Ehegatten erleichtert. Zwar erhält auch derjenige Ehegatte, der von dem anderen Ehegatten das landwirtschaftliche Unternehmen übernommen hat, weiterhin nur eine Rente, wenn er den Hof abgibt. Die entscheidende Änderung seit dem 1. Januar 2016 ist aber, dass eine Nichtabgabe des Unternehmens nur noch den Rentenanspruch desjenigen Ehegattens, der das landwirtschaftliche Unternehmen übernommen hat, entfallen lässt; auf die Rente des abgebenden Ehegattens hingegen keinen Einfluss mehr hat. Damit ist der Gesetzgeber zwar einer nach Art. 6 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 3 Abs. 2 GG unzulässigen Benachteiligung des einen Ehegatten entgegengetreten, hat jedoch ein neues verfassungsrechtliches Problem geschaffen. Denn die Abgabe unter Ehegatten ist vor allem dann von Vorteil, wenn der übernehmende Ehegatte von der Versicherungspflicht in der Landwirtschaftlichen Alterskasse befreit ist. Das landwirtschaftliche Unternehmen kann dann weiter bewirtschaftet werden, ohne dass die sanktionierende Wirkung der Hofabgaberegelung eintritt. Nach der Gesetzesänderung sind somit nur noch 21 % der Landwirte völlig, nämlich alleinstehende Landwirte, und 15 % der Landwirte teilweise, vor allem im Fall von Betriebsleiterehepaaren, die beide versicherungspflichtig sind, von der Hofabgabepflicht betroffen. Es ist nicht zumutbar, dass eine Minderheit von derzeit noch 36 % der Landwirte unter gewichtigen Eingriffen in das Eigentumsgrundrecht für agrarpolitische Ziele einer zukunftsfähigen Landwirtschaftsstruktur in Anspruch genommen werden, obwohl sie diesen Zielen nicht näherstehen als andere. Dies wird der Gesetzgeber bei einer eventuellen Neuregelung berücksichtigen müssen.
III. In dem Verfahren 1 BvR 97/14 gilt die Beschwerdeführerin als Ehegattin eines Landwirts selbst als Landwirtin nach § 1 Abs. 3 Satz 1 ALG. Ihr dadurch begründeter eigener Rentenanspruch ist nach § 21 Abs. 9 Satz 4 ALG davon abhängig, dass ihr Ehegatte seinerseits den Hof abgibt, sobald er selbst die Voraussetzungen für eine Rente erfüllt. Die Abhängigkeit des Rentenanspruchs von der Hofabgabe durch den anderen Ehegatten verletzt Art. 6 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 3 Abs. 2 GG. Nach Art. 6 Abs. 1 GG stehen Ehe und Familie unter dem besonderen Schutz der staatlichen Ordnung. Es ist deshalb dem Gesetzgeber jede an die Existenz der Ehe anknüpfende Benachteiligung untersagt. Verfassungsrechtlich geschützt ist nach Art. 6 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 3 Abs. 2 GG eine Ehe, in der die Eheleute in einer gleichberechtigten Partnerschaft zueinander stehen und in der die Ehegatten ihre persönliche und wirtschaftliche Lebensführung in gemeinsamer Verantwortung bestimmen. Das schließt eine einseitige Dominanz eines Ehepartners bei der Gestaltung von Rechtsverhältnissen aus. Der Gesetzgeber darf eine solche Dominanz nicht durch Gesetz begründen. Das gilt vor allem für die Ausgestaltung von Pflichtversicherungen, für die der mitversicherte, später rentenberechtigte Ehegatte die Beiträge selbst zu tragen hat. § 21 Abs. 9 Satz 4 ALG verlässt die von Art. 6 Abs. 1 GG geschützte Bestimmung der wirtschaftlichen Lebensführung in gemeinsamer Verantwortung beider Ehepartner und gibt sie in die einseitige Bestimmungsgewalt eines der Ehepartner. Eine besondere verfassungsrechtliche Rechtfertigung für die hier bewirkte Abhängigkeit von der Entscheidung des Ehegatten über die Abgabe des Hofes ist nicht ersichtlich.
IV. § 11 Abs. 1 Nr. 3 ALG in der Fassung des Art. 17 Nr. 6 RV-Altersgrenzenanpassungsgesetz vom 20. April 2007 ist in dem sich aus den Entscheidungsgründen ergebenden Umfang mit Art. 14 Abs. 1 GG und in Verbindung mit § 21 Abs. 9 Satz 4 ALG in der Fassung des Art. 7 Nr. 1a LSV-Neuordnungsgesetz vom 12. April 2012 mit Art. 6 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 3 Abs. 2 GG unvereinbar und damit unanwendbar. § 11 Abs. 1 Nr. 3 ALG wird insgesamt für unanwendbar erklärt, weil es dem Gesetzgeber obliegt, die Fälle einer Unzumutbarkeit der Hofabgabe näher zu bestimmen. § 11 Abs. 1 Nrn. 1 und 2 ALG bleiben hingegen weiter anwendbar. Von einer Nichtigerklärung wird abgesehen, weil der Gesetzgeber verschiedene Möglichkeiten hat, die Verfassungswidrigkeit zu beheben.
Erfolglose Verfassungsbeschwerde gegen Verurteilung wegen Leugnung des nationalsozialistischen Völkermords
Pressemitteilung Nr. 67/2018 vom 3. August 2018
Beschluss vom 22. Juni 2018
1 BvR 673/18
Eine Bestrafung wegen Leugnung des nationalsozialistischen Völkermords ist grundsätzlich mit Art. 5 Abs. 1 GG vereinbar. Dies hat die 3. Kammer des Ersten Senats mit heute veröffentlichtem Beschluss entschieden und eine Verfassungsbeschwerde nicht zur Entscheidung angenommen, die gegen eine Verurteilung wegen Volksverhetzung in der Tatbestandsvariante der Leugnung unter der Herrschaft des Nationalsozialismus begangener Verbrechen, namentlich der Morde im Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau, gerichtet war. Die Verbreitung erwiesen unwahrer und bewusst falscher Tatsachenbehauptungen kann nicht zur Meinungsbildung beitragen und ist als solche nicht von der Meinungsfreiheit gedeckt. Insoweit kann sich die Beschwerdeführerin nicht auf Art. 5 Abs. 1 GG berufen. Soweit sie die Leugnung des nationalsozialistischen Völkermords darüber hinaus auf vermeintlich eigene Schlussfolgerungen und Bewertungen stützt, kann sie sich zwar auf ihre Meinungsfreiheit berufen. Der in der Verurteilung wegen dieser Äußerungen liegende Eingriff ist jedoch verfassungsrechtlich grundsätzlich gerechtfertigt. Die Leugnung des nationalsozialistischen Völkermordes überschreitet die Grenzen der Friedlichkeit der öffentlichen Auseinandersetzung und indiziert eine Störung des öffentlichen Friedens.
Sachverhalt:
1. Die 89-jährige Beschwerdeführerin veröffentlichte verschiedene Artikel, die Darlegungen enthielten, nach denen sich die massenhafte Tötung von Menschen jüdischen Glaubens unter der Herrschaft des Nationalsozialismus nicht ereignet haben könne und insbesondere die Massenvergasungen in dem Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau nicht möglich gewesen seien. Zum Beleg dieser Behauptung, die in mehreren der Artikel als aufgrund neuer Erkenntnisse feststehende Tatsache präsentiert wird, verweisen die Texte unter anderem mehrfach auf veröffentlichte Befehle, aus denen hervorgehe, dass das Lager Auschwitz-Birkenau allein dazu bestimmt gewesen sei, die dort internierten Personen für die Rüstungsindustrie arbeitsfähig zu halten. Darüber hinaus stützen sich die Artikel unter anderem auf mehrere angebliche Verlautbarungen der Leitung der Gedenkstätte in Auschwitz-Birkenau, auf verschiedene Historiker, auf Zeitungsinterviews und auf Aussagen vermeintlich als Lügner entlarvter, namentlich benannter Zeugen und Zeitzeugen.
2. Wegen der Äußerungen verurteilte das Amtsgericht die Beschwerdeführerin wegen Volksverhetzung in sieben Fällen und versuchter Volksverhetzung in einem Fall zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von zwei Jahren und sechs Monaten. Auf die hiergegen gerichtete Berufung der Beschwerdeführerin setzte das Landgericht Verden die Gesamtfreiheitsstrafe ohne Aussetzung zur Bewährung auf zwei Jahre herab und verwarf die Berufung im Übrigen. Die Revision blieb erfolglos. Hiergegen richtet sich die Verfassungsbeschwerde.
Wesentliche Erwägungen der Kammer:
Die Verfassungsbeschwerde ist unbegründet, denn die angegriffenen Entscheidungen verletzen die Beschwerdeführerin nicht in ihren Grundrechten. Die Äußerungen der Beschwerdeführerin unterfallen weithin schon nicht dem Schutzbereich der Meinungsfreiheit. Auch im Übrigen sind die angegriffenen Entscheidungen von Verfassungs wegen nicht zu beanstanden.
1. Als erwiesen unwahre und nach den Feststellungen der Fachgerichte auch bewusst falsche Tatsachenbehauptungen können die Äußerungen der Beschwerdeführerin nicht zu der verfassungsrechtlich gewährleisteten Meinungsbildung beitragen und ist deren Verbreitung als solche nicht von der Meinungsfreiheit gedeckt. Das ändert sich auch nicht dadurch, dass an solche Tatsachenbehauptungen Meinungsäußerungen geknüpft werden.
2. Soweit die Beschwerdeführerin darüber hinaus die Leugnung der Verbrechen auf eigene Schlussfolgerungen und Bewertungen stützt und sich insoweit auf ihre Meinungsfreiheit berufen kann, verletzt die Verurteilung die Beschwerdeführerin nicht in ihren Grundrechten. Die Strafgerichte haben § 130 Abs. 3 StGB grundrechtskonform ausgelegt und angewendet. Insbesondere haben sie bei der Verurteilung beachtet, dass Eingriffe in die Meinungsfreiheit sich nicht gegen die rein geistigen Wirkungen einer Meinung richten dürfen, sondern anerkannte Rechtsgüter schützen müssen. Denn auf Grundlage der Feststellungen in den angegriffenen Entscheidungen durfte das Landgericht von einer Eignung zur Gefährdung des öffentlichen Friedens durch die Äußerungen der Beschwerdeführerin ausgehen.
a) Die Tatbestandsmerkmale der Billigung und Leugnung indizieren eine tatbestandsmäßige Eignung zur Störung des öffentlichen Friedens.
Für das Tatbestandsmerkmal der Billigung der nationalsozialistischen Gewalt- und Willkürherrschaft in § 130 Abs. 4 StGB hat das Bundesverfassungsgericht dies bereits ausdrücklich entschieden. Entsprechend überschreitet die öffentliche Billigung des nationalsozialistischen Völkermordes, wie sie § 130 Abs. 3 StGB unter Strafe stellt, die Grenzen der Friedlichkeit der öffentlichen Auseinandersetzung und indiziert eine Störung des öffentlichen Friedens.
Für die Tatbestandsvariante der Leugnung gilt nichts anderes. Die Überschreitung der Friedlichkeit liegt hier darin, dass die Leugnung als das Bestreiten des allgemein bekannten unter dem Nationalsozialismus verübten Völkermords vor dem Hintergrund der deutschen Geschichte nur so verstanden werden kann, dass damit diese Verbrechen durch Bemäntelung legitimiert und gebilligt werden. Die Leugnung wirkt damit ähnlich wie eine Billigung von Straftaten, die in § 140 StGB auch sonst unter Strafe gestellt ist und kommt der Verherrlichung der nationalsozialistischen Gewalt- und Willkürherrschaft nach § 130 Abs. 4 StGB gleich. Die Leugnung des nationalsozialistischen Völkermords ist vor dem Hintergrund der deutschen Geschichte geeignet, Zuhörer zur Aggression und zu einem Tätigwerden gegen diejenigen zu veranlassen, die als Urheber oder Verantwortliche der durch die Leugnung implizit behaupteten Verzerrung der angeblichen historischen Wahrheit angesehen werden. Sie trägt damit unmittelbar die Gefahr in sich, die politische Auseinandersetzung ins Feindselige und Unfriedliche umschlagen zu lassen. Dies auch deshalb, weil diese Verbrechen insbesondere gezielt gegenüber bestimmten Personen- oder Bevölkerungsgruppen verübt wurden und die Leugnung dieser Ereignisse offen oder unterschwellig zur gezielten Agitation gegen diese Personenkreise eingesetzt werden kann und wird. Insofern ist es folgerichtig, dass die Gesetzesbegründung § 130 Abs. 3 StGB als Spezialfall des klassischen Volksverhetzungsparagraphen begreift.
b) Hiervon ausgehend können die landgerichtlichen Feststellungen die Verurteilung der Beschwerdeführerin tragen. Danach hat die Beschwerdeführerin wiederholt die systematische Vernichtung von Menschen durch das nationalsozialistische Deutschland, insbesondere auch den Völkermord an den Juden, in Abrede gestellt. Aus den Feststellungen ist nichts dafür ersichtlich, dass die tatbestandsmäßige Leugnung trotz dieser Indizwirkung ausnahmsweise nicht dazu geeignet war, eine Gefährdung des öffentlichen Friedens herbeizuführen.
Vielmehr liefern die Artikel durch die Einbettung der Leugnung in die mehrfach an die Mitglieder des Zentralrats der Juden gerichtete Aufforderung, die gängigen Vorstellungen über die Ereignisse über Auschwitz richtigzustellen, ein Beispiel der vom Gesetzgeber gesehenen Gefahr einer gezielten Agitation gegen Bevölkerungsgruppen durch Leugnung eines an ihnen begangenen Völkermordes. Hierdurch wird gezielt und bewusst Stimmung gegen die jüdische Bevölkerung und deren Interessenvertretung gemacht.
c) Die Verurteilung der Beschwerdeführerin zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von zwei Jahren ohne Bewährung ist auch im Einzelfall verhältnismäßig. Sie hält sich hinsichtlich des Strafmaßes in dem den Strafgerichten zukommenden weiten Wertungsrahmen.
Erfolgreiche Verfassungsbeschwerde gegen Aufrechterhaltung der Untersuchungshaft wegen Überlastung des Gerichts
Pressemitteilung Nr. 52/2018 vom 26. Juni 2018
Beschluss vom 11. Juni 2018
2 BvR
819/18
Die Überlastung eines Gerichts fällt in den Verantwortungsbereich der staatlich verfassten Gemeinschaft. Einem Beschuldigten darf nicht zugemutet werden, eine unangemessen lange Aufrechterhaltung der Untersuchungshaft nur deshalb in Kauf zu nehmen, weil der Staat es versäumt, seiner Pflicht zur rechtzeitigen verfassungsgemäßen Ausstattung der Gerichte zu genügen. Mit dieser Begründung hat die 1. Kammer des Zweiten Senats des Bundesverfassungsgerichts mit heute veröffentlichtem Beschluss der Verfassungsbeschwerde eines Beschuldigten gegen eine Haftfortdauerentscheidung stattgegeben und die Sache zur erneuten Entscheidung an das Oberlandesgericht Dresden zurückverwiesen. Das Verfahren war nicht in der gebotenen Zügigkeit gefördert worden. Die Fachgerichte hatten bereits nicht schlüssig begründet, warum ein besonderer Ausnahmefall vorgelegen haben sollte, der es gerechtfertigt hätte, dass das Landgericht Dresden erst ein Jahr und einen Monat nach Beginn der Untersuchungshaft und sieben Monate nach der Anklageerhebung mit der Hauptverhandlung begonnen hat. Erst recht wird die bisherige Verhandlungsdichte mit weit weniger als einem Verhandlungstag pro Woche dem verfassungsrechtlichen Beschleunigungsgebot nicht gerecht.
Sachverhalt:
Der Beschwerdeführer befindet sich seit dem 3. November 2016 unter anderem wegen des Verdachts der schweren räuberischen Erpressung und der Bildung einer kriminellen Vereinigung ununterbrochen in Untersuchungshaft. Die unter dem 25. April 2017 verfasste Anklageschrift der Staatsanwaltschaft ging am 27. April 2017 beim Landgericht ein. Am selben Tag zeigte der Vorsitzende der zuständigen 3. Großen Strafkammer (Staatsschutzkammer) - wie bereits zwei Mal zuvor im Jahr 2017 - beim Präsidium des Landgerichts die Überlastung der Kammer an. Am 13. Juni 2017 erklärte der Präsident des Landgerichts, dass er von einer nunmehr dauerhaften Überlastung der 3. Großen Strafkammer ausgehe, und errichtete die 16. Große Strafkammer als weitere Staatsschutzkammer, die das Verfahren aufgrund Beschlusses des Präsidiums zum 1. Juli 2017 übernahm. Am 21. November 2017 ließ das Landgericht die Anklage zu und beschloss die Eröffnung des Hauptverfahrens. Die Hauptverhandlung begann am 6. Dezember 2017. Bis zum 23. Mai 2018 hatte die Kammer 21 Termine anberaumt. Im Zeitraum Juni bis August 2018 hat die Kammer einen bis zwei Termine pro Monat anberaumt, in der Zeit bis zum 9. Januar 2019 drei bis vier Termine pro Monat. Einen Haftprüfungsantrag des Beschwerdeführers vom 7. Februar 2018 wies das Landgericht zurück. Die hiergegen gerichtete Beschwerde verwarf das Oberlandesgericht Dresden mit Beschluss vom 27. März 2018 als unbegründet. Hiergegen richtet sich die Verfassungsbeschwerde.
Wesentliche Erwägungen der Kammer:
Der Beschluss des Oberlandesgerichts Dresden verletzt den Beschwerdeführer in seinem Grundrecht aus Art. 2 Abs. 2 Satz 2 des Grundgesetzes.
1. Bei der Anordnung und Aufrechterhaltung der Untersuchungshaft ist das Spannungsverhältnis zwischen dem Recht des Einzelnen auf persönliche Freiheit und den unabweisbaren Bedürfnissen einer wirksamen Strafverfolgung zu beachten. Grundsätzlich darf nur einem rechtskräftig Verurteilten die Freiheit entzogen werden. Der Entzug der Freiheit eines der Straftat lediglich Verdächtigen ist wegen der Unschuldsvermutung nur ausnahmsweise zulässig.
Die Strafverfolgungsbehörden und Strafgerichte müssen daher alle möglichen und zumutbaren Maßnahmen ergreifen, um die notwendigen Ermittlungen mit der gebotenen Schnelligkeit abzuschließen und eine gerichtliche Entscheidung über die einem Beschuldigten vorgeworfenen Taten herbeizuführen. So ist im Falle der Entscheidungsreife über die Zulassung der Anklage zur Hauptverhandlung zu beschließen und anschließend im Regelfall innerhalb von weiteren drei Monaten mit der Hauptverhandlung zu beginnen. Die Untersuchungshaft kann dann nicht mehr als notwendig anerkannt werden, wenn ihre Fortdauer durch Verfahrensverzögerungen verursacht ist, die ihre Ursache nicht in dem konkreten Strafverfahren haben und daher von dem Beschuldigten nicht zu vertreten, sondern vermeidbar und sachlich nicht gerechtfertigt sind. Entsprechend dem Gewicht der zu ahndenden Straftat können zwar kleinere Verfahrensverzögerungen die Fortdauer der Untersuchungshaft rechtfertigen. Allein die Schwere der Tat und die sich daraus ergebende Straferwartung vermögen aber bei erheblichen, vermeidbaren und dem Staat zuzurechnenden Verfahrensverzögerungen nicht zur Rechtfertigung einer ohnehin schon lang andauernden Untersuchungshaft zu dienen. Die nicht nur kurzfristige Überlastung eines Gerichts kann insofern niemals Grund für die Anordnung der Haftfortdauer sein. Die Überlastung eines Gerichts fällt in den Verantwortungsbereich der staatlich verfassten Gemeinschaft. Dem Beschuldigten darf nicht zugemutet werden, eine längere als die verfahrensangemessene Aufrechterhaltung des Haftbefehls nur deshalb in Kauf zu nehmen, weil der Staat es versäumt, seiner Pflicht zur verfassungsgemäßen Ausstattung der Gerichte nachzukommen.
2. Diesen Vorgaben genügt der angegriffene Beschluss des Oberlandesgerichts Dresden nicht. Er enthält keine verfassungsrechtlich tragfähige Begründung, die eine weitere Fortdauer der Untersuchungshaft rechtfertigen könnte. Das Verfahren ist nicht in der durch das Gewicht des Freiheitseingriffs gebotenen Zügigkeit gefördert worden. Der angegriffene Beschluss zeigt keine besonderen Umstände auf, die die Fortdauer der Untersuchungshaft verfassungsrechtlich hinnehmbar erscheinen lassen könnten. Er wird damit den verfassungsrechtlichen Anforderungen an die Begründung von Haftfortdauerentscheidungen nicht gerecht.
a) Das Oberlandesgericht hat bereits nicht schlüssig begründet, warum es sich um einen besonderen Ausnahmefall handeln soll, der es rechtfertigt, dass das Landgericht erst ein Jahr und einen Monat nach Beginn der Untersuchungshaft und sieben Monate nach der Anklageerhebung mit der Hauptverhandlung begonnen hat. Insbesondere ist nicht nachvollziehbar, warum es nach Anklageerhebung zwei Monate dauerte, bis das Landgericht eine weitere Strafkammer errichtet hatte, die das Verfahren übernehmen konnte. Die Belastungssituation der ursprünglich zuständigen Strafkammer war seit längerem bekannt, auch schon vor der Anklageerhebung im vorliegenden Verfahren. Diesen Zustand dauerhafter Überlastung hat nicht der Beschwerdeführer, sondern allein die Justizverwaltung zu vertreten, der es obliegt, die Gerichte rechtzeitig in einer Weise mit Personal auszustatten, die eine den rechtsstaatlichen Anforderungen genügende Verfahrensgestaltung erlaubt. Dieser verfassungsrechtlichen Pflicht ist sie nicht nachgekommen. Auch die Errichtung der zusätzlichen Kammer hat indes nicht dazu geführt, dass die vorliegende Haftsache innerhalb des durch das Beschleunigungsgebot gezogenen Rahmens bearbeitet und die bereits eingetretene Verfahrensverzögerung wirksam kompensiert worden ist.
b) Erst recht ist die bisherige Verhandlungsdichte nicht ausreichend, um den Anforderungen des Beschleunigungsgebots zu genügen. Seit Beginn der Hauptverhandlung am 6. Dezember 2017 hat die Strafkammer in dem unter anderem gegen den Beschwerdeführer gerichteten Verfahren im Schnitt weit weniger als einmal pro Woche verhandelt. Zweifelhaft ist auch, ob der Umstand, dass das vorliegende Verfahren in einem sachlichen Zusammenhang mit weiteren, bei derselben Strafkammer anhängigen Strafverfahren steht, die Verzögerungen bis zum Beginn der Hauptverhandlung und die seither ungenügende Verhandlungsdichte zu kompensieren vermag. Sind bei derselben Strafkammer mehrere Verfahren gleichzeitig anhängig, die zwar sachlich zusammenhängen, aber gerade nicht miteinander verbunden worden sind, kann dies nicht dazu führen, dass der Beschwerdeführer eine verzögerte Durchführung des gegen ihn gerichteten Verfahrens hinzunehmen hat. Überdies ist nicht erkennbar, inwiefern die getrennte Anklage und Verhandlung der im Zusammenhang stehenden Verfahren einer Verfahrensbeschleunigung dienen könnte oder bislang zu einer solchen Beschleunigung beigetragen hat.
Alleinige Erbringung und Abrechnung von MRT-Leistungen durch Radiologen in der gesetzlichen Krankenversicherung ist verfassungsrechtlich nicht zu beanstanden
Pressemitteilung Nr. 50/2018 vom 21. Juni 2018
Beschluss vom 02. Mai 2018
1 BvR 3042/14
Mit heute veröffentlichtem Beschluss hat die 1. Kammer des Ersten Senats des Bundesverfassungsgerichts die Verfassungsbeschwerde eines Kardiologen mit Zusatzweiterbildung „MRT - fachgebunden“ nicht zur Entscheidung angenommen, mit der er sich gegen die Versagung einer Genehmigung zur Erbringung und Abrechnung magnetresonanztomographischer Leistungen (MRT-Leistungen) auf dem Gebiet der Kardiologie für gesetzlich Krankenversicherte wendet. Die Kammer hat zur Begründung angeführt, dass eine etwaige Ungleichbehandlung jedenfalls aus Gründen der Sicherung von Wirtschaftlichkeit und Qualität der Leistungserbringung gerechtfertigt wäre.
Sachverhalt:
Der Beschwerdeführer ist Facharzt für Innere Medizin mit dem Schwerpunkt Kardiologie und verfügt über die Zusatzweiterbildung „MRT - fachgebunden -“. Er beantragte bei der kassenärztlichen Vereinigung Berlin die Abrechnungsgenehmigung für gesetzlich Versicherte für MRT-Leistungen. Dies wurde mit der Begründung abgelehnt, der Beschwerdeführer verfüge nicht über die erforderliche Facharztausbildung. Widerspruch und Klage blieben letztlich erfolglos, das Bundessozialgericht wies die vom Beschwerdeführer erhobene Revision zurück. Mit der hiergegen gerichteten Verfassungsbeschwerde macht der Beschwerdeführer eine Verletzung des Gleichheitssatzes geltend.
Wesentliche Erwägungen der Kammer:
Die Verfassungsbeschwerde ist unbegründet. Der Beschwerdeführer wird durch die angefochtenen Entscheidungen nicht in seinem Grundrecht aus Art. 3 Abs. 1 GG verletzt. Die der Entscheidung zugrunde liegenden Qualitätssicherungsvereinbarungen nach § 135 Abs. 2 Satz 4 SGB V sind von Verfassungs wegen nicht zu beanstanden.
Art. 3 Abs. 1 GG gebietet es, alle Menschen vor dem Gesetz gleich zu behandeln, wobei Differenzierungen möglich sind. Der Gleichheitsgrundsatz ist aber verletzt, wenn bei Regelungen, die eine Personengruppe betreffen, eine Gruppe von Normadressaten im Vergleich zu einer anderen Gruppe anders behandelt wird, obwohl zwischen beiden Gruppen keine Unterschiede von solcher Art und solchem Gewicht bestehen, dass sie die ungleiche Behandlung rechtfertigen könnten. Nach diesen Maßstäben kann offen bleiben, ob von einer Ungleichbehandlung vergleichbarer - nach tatsächlichen Kenntnissen und Fähigkeiten des jeweiligen Arztes oder aber unter Zugrundelegung des Facharztgebietes gebildeter - Arztgruppen auszugehen ist. Denn eine Ungleichbehandlung lässt sich jedenfalls auf den Rechtfertigungsgrund der „Sicherung der Wirtschaftlichkeit“ (§ 135 Abs. 2 Satz 4 SGB V) stützen.
Diese war für den Gesetzgeber ein wesentlicher Gesichtspunkt für die Einführung des § 135 Abs. 2 Satz 4 SGB V. Dadurch, dass die Erbringung und Abrechnung von MRT-Leistungen Radiologen vorbehalten bleibt, soll der Anreiz für Fachärzte der sogenannten Organfächer mit Zusatzweiterbildung „MRT - fachgebunden -“ unterbunden werden, sich selber Patienten für die eigene Erbringung und Abrechnung von MRT-Leistungen zu überweisen. Die Vorschrift dient zudem - ebenso wie die Qualitätssicherungsvereinbarungen - durch die Konzentration der MRT-Leistungen der Qualitätssicherung. Dabei ist es nicht entscheidend, ob im Einzelfall - wie vorliegend von dem Beschwerdeführer behauptet - eine noch bessere fachliche Qualifikation vorliegt. Von Verfassungs wegen genügt es, dass Radiologen aufgrund ihrer Ausbildung eine hinreichende Gewähr für eine qualitative Durchführung von MRT-Leistungen bieten. Durch die hinreichende Qualität der MRT-Leistungen sinkt zudem die finanzielle Belastung der Krankenkassen, da die Gefahr unzureichender, zu wiederholender oder die Behandlung in eine falsche Richtung lenkender Untersuchungen minimiert wird. Die in den Qualitätssicherungsvereinbarungen aufgegriffene Differenzierung nach Facharztgruppen lässt sich auf § 135 Abs. 2 Satz 4 SGB V zurückführen und knüpft an die diesbezügliche Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts an. Angesichts des Stellenwertes, der der Facharztausbildung für die Berufsausübung zukommt, ist an einer nach Facharztgruppen differenzierenden Regelung von Verfassungs wegen nichts zu erinnern.
Der Leistungsausschluss ist zudem verhältnismäßig. Eine Erweiterung der Untersuchungs- und Abrechnungsbefugnis von MRT-Leistungen auch auf Fachärzte mit der Zusatzweiterbildung „MRT - fachgebunden -“ liefe dem Mehraugenprinzip zuwider. Nur durch die Trennung von Diagnose und Therapie können wirtschaftliche Fehlanreize wirksam vermieden werden.
Darüber hinaus geht die Beschränkung der Behandlungsbefugnis auf Radiologen einher mit der Abrechnungsbefugnis. Denn die Qualitätssicherungsvereinbarungen gehen von einer Gesamtbefugnis aus. Die dafür erforderlichen umfassenden Kenntnisse weisen nach dem Ausbildungsrecht jedoch allein Radiologen auf. Die Erweiterung auf die genannten Fachärzte wäre deshalb zu weitgehend. Sie beträfe wegen der Vielzahl der Fachärzte, die nicht Radiologen sind, auch nicht nur eine untergeordnete Gruppe.
Streikverbot für Beamte verfassungsgemäß
Pressemitteilung Nr. 46/2018 vom 12. Juni 2018
Urteil vom 12. Juni 2018 - 2 BvR 1738/12, 2 BvR 1395/13, 2 BvR 1068/14, 2 BvR 646/15
Das Streikverbot für Beamtinnen und Beamte ist als eigenständiger hergebrachter Grundsatz des Berufsbeamtentums vom Gesetzgeber zu beachten. Es steht auch mit dem Grundsatz der Völkerrechtsfreundlichkeit des Grundgesetzes im Einklang und ist insbesondere mit den Gewährleistungen der Europäischen Menschenrechtskonvention vereinbar. Mit dieser Begründung hat der Zweite Senat des Bundesverfassungsgerichts mit Urteil vom heutigen Tage vier gegen das Streikverbot für Beamte gerichtete Verfassungsbeschwerden zurückgewiesen.
Sachverhalt:
Die Beschwerdeführenden sind oder waren als beamtete Lehrkräfte an Schulen in drei verschiedenen Bundesländern tätig. Sie nahmen in der Vergangenheit während der Dienstzeit an Protestveranstaltungen beziehungsweise Streikmaßnahmen einer Gewerkschaft teil. Diese Teilnahme wurde durch die zuständigen Disziplinarbehörden geahndet. Zur Begründung wurde ausgeführt, die Streikteilnahme stelle einen Verstoß gegen grundlegende beamtenrechtliche Pflichten dar. Insbesondere dürfe ein Beamter nicht ohne Genehmigung dem Dienst fernbleiben. In den fachgerichtlichen Ausgangsverfahren wandten sich die Beschwerdeführerinnen sowie der Beschwerdeführer letztlich erfolglos gegen die jeweils ergangenen Disziplinarverfügungen.
Wesentliche Erwägungen des Senats:
Die mit den Verfassungsbeschwerden angegriffenen Hoheitsakte sind von Verfassungs wegen nicht zu beanstanden. Sie sind jeweils im Ergebnis von dem Bestehen eines Streikverbots für deutsche Beamtinnen und Beamte ausgegangen. Hierin liegt keine Verkennung der maßgeblichen verfassungsrechtlichen Vorgaben.
1. Der sachliche Schutzbereich des Art. 9 Abs. 3 GG ist eröffnet. Zwar sind Beamte von der tariflichen Lohngestaltung ausgeschlossen. Entscheidend ist im konkreten Fall aber, dass die Disziplinarverfügungen die Teilnahme an gewerkschaftlich getragenen, auf – wenngleich nicht eigene – Tarifverhandlungen bezogene Aktionen sanktionieren. Ein solches umfassendes Verständnis von Art. 9 Abs. 3 GG greift im Sinne einer völkerrechtsfreundlichen Auslegung auch die Wertungen des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte zu Art. 11 EMRK auf, wonach auch der Unterstützungsstreik jedenfalls ein ergänzendes Element der Koalitionsfreiheit darstellt.
2. Die angegriffenen behördlichen und gerichtlichen Entscheidungen beeinträchtigen das Grundrecht aus Art. 9 Abs. 3 GG. Die Koalitionsfreiheit wird beschränkt durch alle Verkürzungen des grundrechtlich Gewährleisteten. Die disziplinarische Ahndung des Verhaltens der Beschwerdeführenden und deren disziplinargerichtliche Bestätigung durch die angegriffenen Gerichtsentscheidungen begrenzen die Möglichkeit zur Teilnahme an einem Arbeitskampf.
3. Die Beeinträchtigung der Koalitionsfreiheit ist jedoch durch hinreichend gewichtige, verfassungsrechtlich geschützte Belange gerechtfertigt.
a) Das Streikverbot für Beamte stellt einen eigenständigen hergebrachten Grundsatz des Berufsbeamtentums im Sinne des Art. 33 Abs. 5 GG dar. Es erfüllt die für eine Qualifikation als hergebrachter Grundsatz notwendige Voraussetzung der Traditionalität, da es auf eine jedenfalls in der Staatspraxis der Weimarer Republik begründete Traditionslinie zurück geht, und diejenige der Substanzialität, da es eine enge inhaltliche Verknüpfung mit den verfassungsrechtlichen Fundamenten des Berufsbeamtentums in Deutschland, namentlich der beamtenrechtlichen Treuepflicht sowie dem Alimentationsprinzip, aufweist.
b) Das Streikverbot ist Teil der institutionellen Garantie des Art. 33 Abs. 5 GG und vom Gesetzgeber zu beachten. Ein Streikrecht, auch nur für Teile der Beamtenschaft, griffe in den grundgesetzlich gewährleisteten Kernbestand von Strukturprinzipien ein und gestaltete das Verständnis vom und die Regelungen des Beamtenverhältnisses grundlegend um. Es hebelte die funktionswesentlichen Prinzipien der Alimentation, der Treuepflicht, der lebenszeitigen Anstellung sowie der Regelung der maßgeblichen Rechte und Pflichten einschließlich der Besoldung durch den Gesetzgeber aus, erforderte jedenfalls aber deren grundlegende Modifikation. Für eine Regelung etwa der Besoldung durch Gesetz bliebe im Falle der Zuerkennung eines Streikrechts kein Raum. Könnte die Besoldung von Beamten oder Teile hiervon erstritten werden, ließe sich die derzeit bestehende Möglichkeit des einzelnen Beamten, die verfassungsmäßige Alimentation gerichtlich durchzusetzen, nicht mehr rechtfertigen. Das Alimentationsprinzip dient aber zusammen mit dem Lebenszeitprinzip einer unabhängigen Amtsführung und sichert die Pflicht des Beamten zur vollen Hingabe für das Amt ab.
c) Eine ausdrückliche gesetzliche Normierung des Streikverbots für Beamte ist von Verfassungs wegen nicht gefordert. Die in den Landesbeamtengesetzen enthaltenen Regelungen zum Fernbleiben vom Dienst und die gesetzlich normierten beamtenrechtlichen Grundpflichten der uneigennützigen Amtsführung zum Wohl der Allgemeinheit sowie der Weisungsgebundenheit stellen jedenfalls in ihrer Gesamtheit eine hinreichende Konkretisierung des aus Art. 33 Abs. 5 GG folgenden Streikverbots dar.
d) Die Beschränkung der Koalitionsfreiheit ist insoweit, als die Führung von Arbeitskämpfen durch Beamtinnen und Beamte in Rede steht, verfassungsrechtlich nicht zu beanstanden. Das Streikverbot für Beamte trägt auch dem Grundsatz der praktischen Konkordanz Rechnung. Das Spannungsverhältnis zwischen Koalitionsfreiheit und Art. 33 Abs. 5 GG ist zugunsten eines für Beamtinnen und Beamte bestehenden Streikverbots aufzulösen. Der Eingriff in Art. 9 Abs. 3 GG trifft Beamtinnen und Beamte nicht unzumutbar schwer. Ein Streikverbot führt nicht zu einem vollständigen Zurücktreten der Koalitionsfreiheit und beraubt sie nicht gänzlich ihrer Wirksamkeit. Auch hat der Gesetzgeber Regelungen geschaffen, die zu einer Kompensation der Beschränkung von Art. 9 Abs. 3 GG bei Beamtinnen und Beamten beitragen sollen, namentlich Beteiligungsrechte der Spitzenorganisationen der Gewerkschaften bei der Vorbereitung gesetzlicher Regelungen der beamtenrechtlichen Verhältnisse. Ein weiteres Element der Kompensation ergibt sich aus dem beamtenrechtlichen Alimentationsprinzip, das dem einzelnen Beamten das grundrechtsgleiche Recht einräumt, die Erfüllung der dem Staat obliegenden Alimentationsverpflichtung erforderlichenfalls auf dem Rechtsweg durchzusetzen. Bei diesem wechselseitigen System von aufeinander bezogenen Rechten und Pflichten der Beamten zeitigen Ausweitungen oder Beschränkungen auf der einen in der Regel auch Veränderungen auf der anderen Seite des Beamtenverhältnisses. Ein „Rosinenpicken“ lässt das Beamtenverhältnis nicht zu. Ein Streikrecht (für bestimmte Beamtengruppen) würde eine Kettenreaktion in Bezug auf die Ausgestaltung des Beamtenverhältnisses auslösen und wesentliche beamtenrechtliche Grundsätze und damit zusammenhängende Institute in Mitleidenschaft ziehen.
Eine praktisch konkordante Zuordnung von Koalitionsfreiheit und hergebrachten Grundsätzen des Berufsbeamtentums verlangt auch nicht, das Streikverbot unter Heranziehung von Art. 33 Abs. 4 GG auf Beamte zu beschränken, die schwerpunktmäßig hoheitsrechtliche Befugnisse ausüben. Gegen eine solche funktionale Aufspaltung des Streikrechts sprechen die damit einher gehenden Abgrenzungsschwierigkeiten. Unabhängig hiervon verzichtete die Anerkennung eines Streikrechts für „Randbereichsbeamte“ auf die Gewährleistung einer stabilen Verwaltung und der staatlichen Aufgabenerfüllung jenseits hoheitlicher Tätigkeiten. Davon abgesehen schüfe ein solchermaßen eingeschränktes Streikrecht eine Sonderkategorie der „Beamten mit Streikrecht“ oder „Tarifbeamten“, die das klar konzipierte zweigeteilte öffentliche Dienstrecht in Deutschland durchbräche. Während im Kernbereich hoheitlichen Handelns das Alimentationsprinzip weitergälte, würde den sonstigen Beamten die Möglichkeit eröffnet, Forderungen zur Gestaltung ihrer Arbeitsbedingungen bei fortbestehendem Beamtenstatus gegebenenfalls mit Arbeitskampfmaßnahmen durchzusetzen.
4. Das Streikverbot für Beamtinnen und Beamte in Deutschland steht mit dem Grundsatz der Völkerrechtsfreundlichkeit des Grundgesetzes im Einklang und ist insbesondere auch mit den Gewährleistungen der Europäischen Menschenrechtskonvention vereinbar.
a) Art. 11 Abs. 1 EMRK gewährleistet jeder Person, sich frei und friedlich mit anderen zu versammeln und sich frei mit anderen zusammenzuschließen; dazu gehört auch das Recht, zum Schutz ihrer Interessen Gewerkschaften zu gründen und Gewerkschaften beizutreten. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat in der jüngeren Vergangenheit die Gewährleistungen des Art. 11 Abs. 1 EMRK wie auch die Eingriffsvoraussetzungen des Art. 11 Abs. 2 EMRK weiter präzisiert. Dieser Rechtsprechung kommt eine Leit- und Orientierungswirkung zu, wobei jenseits des Anwendungsbereiches des Art. 46 EMRK die konkreten Umstände des Falles im Sinne einer Kontextualisierung in besonderem Maße in den Blick zu nehmen sind. Vor diesem Hintergrund lassen sich eine Konventionswidrigkeit der gegenwärtigen Rechtslage in Deutschland und damit eine Kollision zwischen nationalem Recht und Europäischer Menschenrechtskonvention nicht feststellen. Art. 9 Abs. 3 GG sowie die hierzu ergangene Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, wonach auch deutsche Beamtinnen und Beamte ausnahmslos dem persönlichen Schutzbereich der Koalitionsfreiheit unterfallen, allerdings das Streikrecht als eine Einzelausprägung von Art. 9 Abs. 3 GG aufgrund kollidierenden Verfassungsrechts (Art. 33 Abs. 5 GG) von dieser Personengruppe nicht ausgeübt werden kann, stehen mit den konventionsrechtlichen Wertungen in Einklang.
b) Unabhängig davon, ob das Streikverbot für deutsche Beamte einen Eingriff in Art. 11 Abs. 1 EMRK darstellt, ist es wegen der Besonderheiten des deutschen Systems des Berufsbeamtentums jedenfalls nach Art. 11 Abs. 2 Satz 1 EMRK beziehungsweise Art. 11 Abs. 2 Satz 2 EMRK gerechtfertigt.
aa) Das Streikverbot ist in Deutschland im Sinne von Art. 11 Abs. 2 Satz 1 EMRK gesetzlich vorgesehen. Notwendig hierfür ist eine Grundlage im nationalen Recht. Eine solche Grundlage ist gegeben. Die Beamtengesetze des Bundes und der Länder enthalten für alle Beamtinnen und Beamten konkrete Regelungen zum unerlaubten Fernbleiben vom Dienst beziehungsweise zur Weisungsgebundenheit. Mit diesen Vorgaben ist eine nicht genehmigte Teilnahme an Streikmaßnahmen unvereinbar. Im Übrigen ist das Streikverbot für Beamte eine höchstrichterlich seit Jahrzehnten anerkannte Ausprägung des Art. 33 Abs. 5 GG.
Das Streikverbot erfüllt auch die Anforderungen aus der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte, soweit danach die Rechtfertigung eines Eingriffs in Art. 11 Abs. 1 EMRK ein dringendes soziales beziehungsweise gesellschaftliches Bedürfnis voraussetzt und die Einschränkung verhältnismäßig sein muss. Wenn eine Einschränkung den Kern gewerkschaftlicher Tätigkeit betrifft, ist danach dem nationalen Gesetzgeber ein geringerer Beurteilungsspielraum zuzugestehen und mehr zu verlangen, um den daraus folgenden Eingriff in die Gewerkschaftsfreiheit mit dem öffentlichen Interesse zu rechtfertigen. Wird aber umgekehrt nicht der Kern, sondern nur ein Nebenaspekt der Gewerkschaftstätigkeit berührt, ist der Beurteilungsspielraum weiter und der jeweilige Eingriff eher verhältnismäßig.
Vor diesem Hintergrund ist ein Streikverbot für deutsche Beamtinnen und Beamte und konkret für beamtete Lehrkräfte nach Art. 11 Abs. 2 Satz 1 EMRK gerechtfertigt. Die Beschwerdeführenden nahmen als beamtete Lehrkräfte an Streikmaßnahmen teil, zu denen die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) aufgerufen hatte. In dieser sind sowohl beamtete als auch angestellte Lehrkräfte vertreten. Tarifverträge handelt die GEW mit der Tarifgemeinschaft der Länder aufgrund der Rechtslage aber nur in Bezug auf die angestellten Lehrkräfte aus. Der für die Festlegung der Beschäftigungsbedingungen der Beamtinnen und Beamten allein zuständige Gesetzgeber in Bund und Ländern entscheidet darüber, ob und in welchem Umfang die in Tarifverhandlungen für Angestellte im öffentlichen Dienst erzielten Ergebnisse auf Beamtinnen und Beamte übertragen werden. Teilweise wollten die Beschwerdeführenden mit ihrer Streikteilnahme eine solche Übertragung erreichen. Dieses Verhalten fällt nicht in den Kernbereich der Gewährleistungen des Art. 11 Abs. 1 EMRK. Der der Bundesrepublik Deutschland daher im Grundsatz zukommende weitere Beurteilungsspielraum ist vorliegend auch nicht überschritten. Maßgeblich ist, dass im System des deutschen Beamtenrechts mit dem Beamtenstatus aufeinander abgestimmte Rechte und Pflichten einhergehen und Ausweitungen oder Beschränkungen auf der einen Seite in der Regel auch Veränderungen auf der anderen Seite des Beamtenverhältnisses zeitigen. Insbesondere die Zuerkennung eines Streikrechts für Beamte wäre unvereinbar mit der Beibehaltung grundlegender beamtenrechtlicher Prinzipien. Dies beträfe vor allem die Treuepflicht des Beamten, das Lebenszeitprinzip sowie das Alimentationsprinzip, zu dessen Ausprägungen die Regelung der Besoldung durch Gesetz zählt. Die Zuerkennung eines Streikrechts für Beamte würde das System des deutschen Beamtenrechts, eine nationale Besonderheit der Bundesrepublik Deutschland, im Grundsatz verändern und damit in Frage stellen.
In die nach Art. 11 Abs. 2 Satz 1 EMRK vorzunehmende Interessenabwägung mit den Rechten und Freiheiten anderer ist zudem einzustellen, dass im Falle der Beschwerdeführenden das Streikverbot dem Recht auf Bildung und damit dem Schutz eines in Art. 2 ZP 1 EMRK und anderen völkerrechtlichen Verträgen verankerten Menschenrechts dient. Weitere Gesichtspunkte sind die vorerwähnten Kompensationen für das Streikrecht, namentlich die Beteiligung von Gewerkschaften im Gesetzgebungsverfahren und die Möglichkeit der gerichtlichen Überprüfung der Alimentation.
bb) Im Übrigen sind die Beschwerdeführenden als beamtete Lehrkräfte dem Bereich der Staatsverwaltung im Sinne von Art. 11 Abs. 2 Satz 2 EMRK zuzuordnen. Nach Art. 11 Abs. 2 Satz 2 EMRK kann die Ausübung der Gewährleistungen des Art. 11 Abs. 1 EMRK für Angehörige der Streitkräfte, der Polizei oder der Staatsverwaltung - hierzu zählen nach Auffassung des Senats auch beamtete Lehrkräfte - beschränkt werden. Die Einschränkungen, die den genannten Personengruppen auferlegt werden können, sind dabei eng auszulegen. Für den im vorliegenden Verfahren maßgeblichen Bereich der Lehrkräfte an öffentlichen Schulen ergibt sich aber ein besonderes Interesse des Staates an der Aufgabenerfüllung durch Beamtinnen und Beamte, das solche Einschränkungen rechtfertigt. Schulwesen und staatlicher Erziehungs- und Bildungsauftrag nehmen im Grundgesetz (Art. 7 GG) und den Verfassungen der Länder einen hohen Stellenwert ein.
Anspruch auf Gegendarstellung trotz unterlassener Stellungnahme im Vorfeld einer Berichterstattung
Pressemitteilung Nr. 41/2018 vom 25. Mai 2018
Beschluss vom 09. April 2018
1 BvR 840/15
Der Anspruch auf Abdruck einer Gegendarstellung besteht auch dann, wenn die betroffene Person zuvor keine Stellungnahme zu einer geplanten Berichterstattung abgegeben hat, obwohl der Redakteur ihr eine solche Möglichkeit eingeräumt hat. Eine unterlassene Erklärung begründet grundsätzlich keine Obliegenheitsverletzung, welche einen Gegendarstellungsanspruch entfallen ließe. Mit heute veröffentlichtem Beschluss hat die 3. Kammer des Ersten Senats des Bundesverfassungsgerichts die Verfassungsbeschwerde eines Nachrichtenmagazins nicht zur Entscheidung angenommen, in der dieses die Verletzung der Presse- und Meinungsfreiheit rügt, nachdem es zum Abdruck einer Gegendarstellung verurteilt wurde.
Sachverhalt:
Die Beschwerdeführerin ist Verlegerin eines Nachrichtenmagazins und veröffentlichte im Februar 2013 einen Bericht über Schleichwerbungsvorwürfe gegen einen bekannten Fernsehmoderator (Antragsteller des Ausgangsverfahrens), welcher in Fernsehsendungen versteckt Werbung für Produkte verschiedener Firmen gemacht habe. Vor der Veröffentlichung konfrontierte der Redakteur den Prozessbevollmächtigten des Antragstellers mit der geplanten Berichterstattung und forderte zur Stellungnahme auf. Der Prozessbevollmächtigte wies die Vorwürfe telefonisch zurück, äußerte, dass keine Erklärung abgegeben werde, und teilte mit, dass der Inhalt des Gesprächs für die geplante Berichterstattung nicht verwendet werden dürfe. Nach der Veröffentlichung des Berichts forderte der Antragsteller die Beschwerdeführerin zum Abdruck einer Gegendarstellung auf, was diese zurückwies. Das Landgericht erließ daraufhin eine einstweilige Anordnung, wonach die Beschwerdeführerin zum Abdruck der beantragten Gegendarstellung verurteilt wurde. Der dagegen gerichtete Widerspruch blieb ebenso erfolglos wie die vor dem Oberlandesgericht erhobene Berufung. Mit ihrer Verfassungsbeschwerde rügt die Beschwerdeführerin eine Verletzung ihrer Meinungs- und Pressefreiheit aus Art. 5 Abs. 1 GG, da sie zu Unrecht zu einer Gegendarstellung verpflichtet worden sei. Sie begründet dies damit, dass der Antragsteller durch die unterlassene vorherige Stellungnahme seinen Anspruch auf Abdruck einer Gegendarstellung verloren habe.
Wesentliche Erwägungen der Kammer:
Die angegriffenen Entscheidungen sind verfassungsrechtlich nicht zu beanstanden und stellen keine Verletzung der Meinungs- und Pressefreiheit der Beschwerdeführerin dar.
Die Zivilgerichte haben bei der Auslegung und Anwendung der Normen zum Gegendarstellungsrecht eine Interessenabwägung zwischen dem Persönlichkeitsschutz des Betroffenen und der Pressefreiheit vorzunehmen und dabei unverhältnismäßige Grundrechtsbeschränkungen zu vermeiden. Gemessen an diesen Grundsätzen sind die Entscheidungen der Fachgerichte in verfassungskonformer Art und Weise ergangen.
Es besteht keine Obliegenheit, sich im Vorfeld einer geplanten Berichterstattung zu dieser zu äußern und Stellung zu beziehen. Die Gründe, von einer Stellungnahme abzusehen, können vielfältig sein. Die Annahme einer Obliegenheit zur Stellungnahme würde zu einer Verpflichtung erwachsen, auch an einer gegen den eigenen Willen geplanten Berichterstattung mitzuwirken, nur um den Anspruch auf Gegendarstellung zu behalten. Im Übrigen hätte sie zur Folge, dass sich Medienunternehmen Gegendarstellungsansprüchen entziehen könnten, indem sie den Betroffenen vorab um Stellungnahme bitten. Dies würde das Gegendarstellungsrecht entwerten.
Die Fachgerichte haben die unterschiedliche publizistische Wirkung einer vom Betroffenen selbst verfassten Gegendarstellung und einer unter Umständen nur kurzen Erwähnung des eigenen Standpunkts im ursprünglichen Artikel in der Abwägung der widerstreitenden Grundrechte in verfassungskonformer Weise berücksichtigt. Das Gegendarstellungsrecht soll Betroffenen die Möglichkeit einräumen, Tatsachenbehauptungen entgegen zu treten und damit deren Wahrheitsgehalt in Frage zu stellen. Der Schutzzweck reichte weiter als lediglich die nachträgliche Möglichkeit zu Wort zu kommen, falls dies in der Erstberichterstattung nicht ausreichend geschehen ist. Wird der vom Betroffenen geäußerte Standpunkt neutral dargestellt, entfällt zwar in der Regel der spätere Gegendarstellungsanspruch. Ein grundsätzlicher Verlust des Gegendarstellungsanspruchs bei unterlassener Stellungnahme würde dem Schutzzweck jedoch nicht gerecht.
Es ist nicht erforderlich, zur Entscheidung über einen Gegendarstellungsanspruch eine einzelfallbezogene Grundrechtsabwägung zu treffen. Vielmehr tragen die Pressegesetze der Länder sowie der Rundfunkstaatsvertrag dem Spannungsverhältnis zwischen den Grundrechten aus Art. 5 Abs. 1 GG und Art. 2 Abs. 1 i. V. m. Art. 1 Abs. 1 GG ausreichend Rechnung. Eine Einzelfallabwägung würde dazu führen, dass die generellen Voraussetzungen des Gegendarstellungsanspruchs aus § 11 Hamburgisches Pressegesetz, die den verfassungsgemäßen Ausgleich der betroffenen Grundrechtspositionen gewährleisten, unterlaufen würden. Besonderheiten des Einzelfalls können über das Kriterium des „berechtigten Interesses“ des § 11 HbgPrG auf ausreichend berücksichtigt werden. Zudem ermöglicht § 11 Abs. 3 HbgPrG es dem Medienunternehmen, eine Anmerkung zu der Gegendarstellung zu veröffentlichen und damit faktisch das „letzte Wort“ zu haben. Der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz ist dadurch in der Regel gewahrt.
Erfolglose Verfassungsbeschwerde gegen Ausweisung nach Tunesien
Pressemitteilung Nr. 34/2018 vom 7. Mai 2018
Beschluss vom 04. Mai 2018
2 BvR 632/18
Die Abschiebung eines Gefährders in ein Zielland, in dem ihm die Verhängung der Todesstrafe droht, verstößt nicht gegen das Grundgesetz, wenn eine Vollstreckung der Todesstrafe ausgeschlossen ist. Zusätzlich muss gewährleistet sein, dass der Betroffene die rechtliche und faktische Möglichkeit hat, die sich aus dem Verzicht auf die Vollstreckung einer Todesstrafe ergebende faktische lebenslange Freiheitsstrafe überprüfen zu lassen, so dass jedenfalls eine Chance auf Wiedererlangung der Freiheit besteht. Mit dieser Begründung hat die 1. Kammer des Zweiten Senats des Bundesverfassungsgerichts mit heute veröffentlichtem Beschluss die Verfassungsbeschwerde eines tunesischen Staatsangehörigen nicht zur Entscheidung angenommen und dessen Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung zur Untersagung der Abschiebung für erledigt erklärt.
Sachverhalt:
Der Beschwerdeführer ist tunesischer Staatsangehöriger. Er war erstmals 2003 zu Studienzwecken nach Deutschland eingereist. 2015 kam er unter falschem Namen als angeblich syrischer Flüchtling erneut nach Deutschland. Im August 2016 ordnete das Oberlandesgericht Frankfurt am Main die Auslieferungshaft gegen ihn an, weil ein Auslieferungsersuchen der tunesischen Strafverfolgungsbehörden gegen ihn vorlag. Ihm wurde vorgeworfen, als Angehöriger einer terroristischen Organisation in Tunesien an der Planung und Umsetzung von terroristischen Anschlägen mit zahlreichen Todesopfern beteiligt gewesen zu sein. Auch in Deutschland wurde unter anderem wegen des dringenden Tatverdachts der Unterstützung einer terroristischen Vereinigung gegen ihn ermittelt. Mit Bescheid vom 9. März 2017 wies ihn die zuständige Ausländerbehörde aus Deutschland aus und drohte ihm die Abschiebung nach Tunesien an. Gerichtlicher Eilrechtsschutz hiergegen blieb erfolglos. Ein Asylantrag wurde als offensichtlich unbegründet abgelehnt. Seinen Antrag auf Gewährung vorläufigen Rechtsschutzes gegen die drohende Abschiebung lehnte das Verwaltungsgericht zunächst mit der Maßgabe ab, dass die tunesische Regierung unter anderem zusichere, dass gegen ihn nicht die Todesstrafe verhängt werde und dass seine Behandlung und Unterbringung den Anforderungen der Europäischen Menschenrechtskonvention entsprechen werde. Durch Beschluss vom 26. Juli 2017 untersagte das Verwaltungsgericht dann allerdings die Abschiebung des Beschwerdeführers, weil es Zweifel daran hatte, ob die inzwischen aus Tunesien eingeholte Zusicherung diesen Anforderungen entsprach.
Daraufhin ordnete das Hessische Ministerium des Innern und für Sport mit Verfügung vom 1. August 2017 die Abschiebung des Beschwerdeführers nach Tunesien wegen seiner terroristischen Aktivitäten zugunsten des „Islamischen Staates“ auf der Grundlage des § 58a AufenthG an. Der Beschwerdeführer befindet sich in Abschiebehaft, die derzeit bis zum 25. Mai 2018 befristet ist. Über anhängige Rechtsbeschwerden gegen die Abschiebehaft hat der Bundesgerichtshof bislang nicht entschieden. Gegen die Abschiebungsanordnung des Ministeriums rief der Beschwerdeführer erfolglos das Bundesverwaltungsgericht an. Dieses lehnte seinen Antrag auf Gewährung vorläufigen Rechtsschutzes am 19. September 2017 zunächst mit der Maßgabe ab, die Abschiebung sei nur zulässig, wenn eine tunesische Regierungsstelle zusichere, „dass im Falle der Verhängung einer lebenslangen Freiheitsstrafe die Möglichkeit der Überprüfung der Strafe mit der Aussicht auf Umwandlung oder Herabsetzung der Haftdauer gewährt“ werde. Nach umfangreichen Maßnahmen der Sachverhaltsaufklärung änderte das Bundesverwaltungsgericht diesen Beschluss am 26. März 2017 und lehnte den Antrag des Beschwerdeführers auf Gewährung vorläufigen Rechtsschutzes ohne Beifügung einer Maßgabe ab. Hiergegen hat der Beschwerdeführer Verfassungsbeschwerde erhoben und beantragt, die Abschiebung im Wege der einstweiligen Anordnung zu untersagen.
Das Bundesverfassungsgericht hat die Abschiebung des Beschwerdeführers bis zum 7. Mai 2018 untersagt, um eine gründliche Prüfung seiner Verfassungsbeschwerde zu ermöglichen.
Wesentliche Erwägungen der Kammer:
1. Der angegriffene Beschluss verletzt nicht das Recht des Beschwerdeführers auf effektiven Rechtsschutz. Das Bundesverwaltungsgericht ist seiner verfassungsrechtlich gebotenen Sachaufklärungspflicht nachgekommen. Es hat eine umfassende Aufklärung zu den rechtlichen und tatsächlichen Umständen einer in Tunesien verhängten Todesstrafe vorgenommen. Dabei hat es in Erfahrung gebracht, welche Straftaten dem Beschwerdeführer in Tunesien im Einzelnen zur Last gelegt werden, in welchem Stadium sich das Verfahren der Strafverfolgung befindet und welche Strafrahmen die entsprechenden Straftatbestände vorsehen. Es hat dem Auswärtigen Amt ausführliche und differenzierte Fragen zur Umwandlung einer dem Beschwerdeführer in Tunesien mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit drohenden, nach dem dort seit 1991 ausnahmslos praktizierten Moratorium aber nicht vollstreckbaren Todesstrafe in eine lebenslange beziehungsweise zeitige Freiheitsstrafe und den sich daran anschließenden rechtlichen und tatsächlichen Möglichkeiten einer Strafrestaussetzung zur Bewährung gestellt. Auch die Behandlung der nach dem 2015 in Kraft getretenen Antiterrorismusgesetz zum Tode Verurteilten hat das Bundesverwaltungsgericht hinreichend aufgeklärt. Die Antworten auf diese Fragen samt den jeweils relevanten Dokumenten musste es nicht zum Anlass nehmen, über die bereits vorliegenden Auskünfte hinaus weitere Informationen einzuholen.
2. Der angegriffene Beschluss verletzt den Beschwerdeführer nicht in seinem Recht auf Leben aus Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG. Das Bundesverwaltungsgericht durfte davon ausgehen, dass eine dem Beschwerdeführer drohende Todesstrafe nicht vollstreckt wird. Für diese Annahme bestehen hinreichende tatsächliche Grundlagen. Aus dem Lagebericht des Auswärtigen Amtes und einer in das Verfahren eingeführten Verbalnote des tunesischen Außenministeriums folgt, dass in Tunesien die Todesstrafe aufgrund eines Moratoriums seit 1991 nicht mehr vollstreckt wird. Zudem ist die weitere Einhaltung des Moratoriums durch tunesische Behörden im Zuge der Sachverhaltsaufklärung durch das Bundesverwaltungsgericht und bezogen auf den konkreten Fall des Beschwerdeführers aktualisiert worden.
3. Die durch das Bundesverwaltungsgericht bestätigte Abschiebungsanordnung verstößt nicht gegen das Recht des Beschwerdeführers auf Freiheit aus Art. 2 Abs. 2 Satz 2 GG in Verbindung mit der Menschenwürdegarantie aus Art. 1 Abs. 1 GG.
Die faktische lebenslange Freiheitsstrafe, die aus dem Verzicht auf die Vollstreckung einer Todesstrafe resultiert, begründet im vorliegenden Fall keinen Verstoß gegen Art. 2 Abs. 2 Satz 2 GG in Verbindung mit Art. 1 Abs. 1 GG. Allerdings gehört es nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zu den Voraussetzungen eines menschenwürdigen Strafvollzugs, dass dem zu lebenslanger Freiheitsstrafe Verurteilten grundsätzlich eine konkrete und realisierbare Chance verbleibt, die Freiheit wiedergewinnen zu können. Dies gilt auch für den Fall, dass der Betroffene in einen anderen Staat überstellt wird. Dann muss das dortige Rechtssystem eine realisierbare Möglichkeit auf Wiedererlangung der Freiheit bereithalten. Diese Vorgaben durch das Grundgesetz werden durch Art. 3 EMRK konkretisiert. Ein Verstoß gegen diese Gewährleistung liegt nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte vor, wenn die lebenslange Freiheitsstrafe de jure oder de facto nicht herabsetzbar ist. Für einen zu lebenslanger Freiheitsstrafe Verurteilten muss bereits im Zeitpunkt der Verhängung der Strafe sowohl eine Aussicht auf Freilassung als auch eine Möglichkeit der Überprüfung der Haftfortdauer bestehen. Ein Verurteilter hat das Recht, bereits bei Verhängung der Strafe zu wissen, was er tun muss, um für eine Freilassung in Betracht zu kommen und unter welchen Bedingungen eine Überprüfung seiner Strafe erfolgen wird.
Die Einschätzung des Bundesverwaltungsgerichts, die Lage in Tunesien genüge diesen Anforderungen, ist verfassungsrechtlich nicht zu beanstanden. Das Gericht hat ermittelt, dass die Möglichkeit einer Haftentlassung bei zum Tode verurteilten Personen in Tunesien von zwei Schritten abhängt. In einem ersten Schritt bedarf es einer Umwandlung der Todesstrafe in eine lebenslange Freiheitsstrafe durch einen Gnadenakt des Staatspräsidenten. In einem zweiten Schritt kann eine Strafrestaussetzung nach der Verbüßung von wenigstens 15 Jahren Haft entweder über ein Verfahren nach der tunesischen Strafprozessordnung oder durch eine ebenfalls in der Strafprozessordnung vorgesehene weitere Begnadigung durch den Staatspräsidenten erreicht werden. Diesen Auskünften durfte das Bundesverwaltungsgericht entnehmen, dass dieser Überprüfungsmechanismus auch bei nach dem tunesischen Antiterrorismusgesetz zum Tode verurteilten Personen Anwendung finden wird.
Ablehnungsgesuche gegen Vizepräsident Kirchhof zurückgewiesen
Pressemitteilung Nr. 30/2018 vom 3. Mai 2018
Beschluss vom 24. April
2018
1 BvR
745/17, 1 BvR 981/17
Mit heute veröffentlichtem Beschluss hat der Erste Senat entschieden, dass Vizepräsident Prof. Dr. Ferdinand Kirchhof nicht von der Ausübung seines Richteramtes in den Verfahren über die Verfassungsbeschwerden zur Erhebung des Rundfunkbeitrages ausgeschlossen ist und zudem die Ablehnungsgesuche zweier Beschwerdeführer als unbegründet zurückgewiesen. Zur Begründung hat der Senat ausgeführt, dass ein durch den Bruder des Vizepräsidenten erstattetes Gutachten zur Verfassungsmäßigkeit des Rundfunkbeitrages nicht zu einer engen, konkreten Beziehung des Bruders zum Gegenstand des Verfahrens führt, die den Ausschluss begründen könnte und dessen Gutachtertätigkeit auch keinen Anlass dafür bietet, an der Unvoreingenommenheit von Vizepräsident Kirchhof zu zweifeln.
Sachverhalt
Der Einführung des Rundfunkbeitrags gingen mehrjährige Reformüberlegungen voraus. Hierbei wurden mehrere Modelle zur Reform der früheren Rundfunkgebühr erörtert. Zur Frage der Verfassungsmäßigkeit eines dieser Modelle erstattete unter anderem der Finanzverfassungsrechtler und ehemalige Richter im Zweiten Senat des Bundesverfassungsgerichts Prof. Dr. Dres. h. c. Paul Kirchhof 2010 im Auftrag von ARD, ZDF und Deutschlandradio ein Gutachten. In dem Gutachten wird die Verfassungsmäßigkeit einer geräteunabhängigen Wohnungs- und Betriebsstättenabgabe bejaht. In der Gesetzesbegründung zu den Umsetzungsgesetzen des Rundfunkbeitragstaatsvertrags verwiesen die Gesetzgeber unter anderem auch auf dieses Gutachten. Beim Ersten Senat sind derzeit mehrere Verfassungsbeschwerden gegen die Erhebung des Rundfunkbeitrags anhängig, eine mündliche Verhandlung ist auf den 16. und 17. Mai 2018 anberaumt. Zwei der Beschwerdeführer haben angeregt, den Vizepräsidenten Ferdinand Kirchhof wegen Verwandtschaft mit einem an der Sache Beteiligten von der Ausübung des Richteramts auszuschließen und ersatzweise beantragt, ihn wegen Besorgnis der Befangenheit abzulehnen.
Wesentliche Erwägungen des Senats:
1. Vizepräsident Kirchhof ist nicht von der Ausübung des Richteramts nach § 18 Abs. 1 Nr. 1 BVerfGG ausgeschlossen. Zwar ist Paul Kirchhof mit dem Vizepräsidenten Ferdinand Kirchhof als dessen Bruder in der Seitenlinie im zweiten Grade verwandt. Er ist jedoch kein Beteiligter des Verfahrens im Sinne von § 18 Abs. 1 Nr. 1 BVerfGG, da es an der vom Bundesverfassungsgerichtsgesetz für den Ausschluss vorausgesetzten engen, konkreten Beziehung Paul Kirchhofs zum Gegenstand des Verfahrens fehlt. Eine solche folgt nicht aus dem Umstand, dass Paul Kirchhof in einem Rechtsgutachten einen wohnungs- und betriebsstättenbezogenen Rundfunkbeitrag verfassungsrechtlich befürwortet und damit einen Anstoß für die Einführung der gegenwärtigen Regelung geschaffen hat. Es sind keinerlei relevante unmittelbare Vorteile oder Nachteile erkennbar, die Paul Kirchhof aus einer Entscheidung des Senats erwachsen könnten.
2. Die Ablehnungsgesuche sind unbegründet. Die Ablehnung eines Richters nach § 19 BVerfGG setzt voraus, dass ein Grund vorliegt, der geeignet ist, Misstrauen gegen seine Unparteilichkeit zu rechtfertigen. Es kommt mithin nicht darauf an, ob der Richter tatsächlich „parteilich“ oder „befangen“ ist oder ob er sich selbst für befangen hält. Entscheidend ist ausschließlich, ob ein am Verfahren Beteiligter bei vernünftiger Würdigung aller Umstände Anlass hat, an der Unvoreingenommenheit des Richters zu zweifeln. Allerdings kann eine Besorgnis der Befangenheit im Sinne des § 19 BVerfGG nicht aus den allgemeinen Gründen hergeleitet werden, die nach der ausdrücklichen Regelung des § 18 Abs. 2 und Abs. 3 BVerfGG einen Ausschluss von der Ausübung des Richteramts nicht rechtfertigen. Es wäre ein Wertungswider-spruch, könnte gerade wegen dieser Gründe dennoch ein Richter über eine Befangenheitsablehnung von der Mitwirkung ausgeschlossen werden. Daher muss stets etwas Zusätzliches gegeben sein, damit eine Besorgnis der Befangenheit als begründet erscheinen kann.
Solche zusätzlichen Umstände liegen in der Person des Vizepräsidenten Ferdinand Kirchhof nicht vor. Darauf, ob Paul Kirchhof nach den Ausführungen der Antragsteller über die Erstattung des Gutachtens hinaus in besonderem Maße mit den Regelungen des Rundfunkbeitragstaatsvertrags in Verbindung gebracht werden kann, als deren „Urheber“ anzusehen ist und eine besondere Gewähr für die Verfassungsmäßigkeit der Neuregelung übernommen hat, kommt es für sich genommen nicht an. Denn im Rahmen des § 19 BVerfGG müssen die zusätzlichen Umstände, die geeignet sein sollen, Misstrauen gegen die Unparteilichkeit zu rechtfertigen, in der Person des abgelehnten Richters vorliegen. Allein Verwandtschaft begründet keine Besorgnis der Befangenheit. Etwaige Umstände, die eine besondere Verbindung Paul Kirchhofs zur streitgegenständlichen Regelung belegen sollen, könnten die Besorgnis der Befangenheit nach § 19 BVerfGG daher nur dann begründen, wenn dadurch auch die Unparteilichkeit des Vizepräsidenten Ferdinand Kirchhof berührt wäre. Wenn die Antragsteller insoweit darauf abheben, Vizepräsident Kirchhof könne der streitbefangenen Rechtsfrage nicht mehr mit der Unbefangenheit gegenübertreten, wie wenn sein Bruder Paul Kirchhof ohne Gutachtenauftrag lediglich seine wissenschaftliche Meinung geäußert hätte, stellt dies – unabhängig von der Überzeugungskraft dieser Differenzierung – keinen besonderen Umstand dar, der die Unparteilichkeit von Vizepräsident Kirchhof in Zweifel ziehen könnte.
Erfolglose Verfassungsbeschwerde gegen die Stationierung US-amerikanischer Atomwaffen auf dem Fliegerhorst Büchel
Pressemitteilung Nr. 28/2018 vom 27. April 2018
Beschluss vom 15. März 2018
2 BvR
1371/13
Mit heute veröffentlichtem Beschluss hat die 2. Kammer des Zweiten Senats des Bundesverfassungsgerichts eine Verfassungsbeschwerde nicht zur Entscheidung angenommen, die die Stationierung US-amerikanischer Atomwaffen auf dem Fliegerhorst Büchel zum Gegenstand hatte. Die Verfassungsbeschwerde ist bereits unzulässig, weil die Beschwerdeführerin einen Eingriff in Grundrechte ebenso wenig dargelegt hat wie eine Verletzung grundrechtlicher Schutzpflichten.
Sachverhalt:
Der Fliegerhorst Büchel ist ein Luftwaffenstandort im Landkreis Cochem-Zell in Rheinland-Pfalz. Auf dem Stützpunkt sind deutsche und amerikanische Luftstreitkräfte stationiert. Zu deren Aufgaben gehören vor allem die Verwahrung, Bewachung, Wartung und Freigabe der dort im Rahmen der innerhalb der NATO vereinbarten nuklearen Teilhabe gelagerten Atomwaffen. Die Beschwerdeführerin wohnt circa 3,5 Kilometer vom Fliegerhorst Büchel entfernt.
Mit einem Schreiben an den Bundesminister der Verteidigung schilderte die Beschwerdeführerin ihre Befürchtung, terroristischen Angriffen auf den Fliegerhorst in besonderer Weise ausgesetzt zu sein. Die Nuklearwaffen verstießen gegen Prinzipien des humanitären Völkerrechts. Eine rechtswidrige Kriegsführung von deutschem Boden aus verletze den NATO-Vertrag und die deutsche Verfassung. Aus Art. 25 und 26 GG folge, dass jeder Bürger vom Staat verlangen könne, dass eine von deutschem Boden ausgehende rechtswidrige Kriegsführung unterbunden werden müsse. Der Bundesminister der Verteidigung verwies in seinem Antwortschreiben darauf, dass durch infrastrukturelle, technische und organisatorische Maßnahmen ein Höchstmaß an Schutz und Sicherheit für die Einwohner Deutschlands gewährleistet werde.
Mit ihrer Klage vor dem Verwaltungsgericht Köln beantragte die Beschwerdeführerin, die Bundesrepublik Deutschland zu verurteilen, gegenüber den USA darauf hinzuwirken, die auf dem Fliegerhorst Büchel gelagerten amerikanischen Atomwaffen abzuziehen.
Das Verwaltungsgericht Köln wies die Klage unter anderem mangels Klagebefugnis als unzulässig ab.
Der vor dem Oberverwaltungsgericht Nordrhein-Westfalen gestellte Antrag auf Zulassung der Berufung blieb erfolglos. Dabei führte das Oberverwaltungsgericht aus, dass Verstöße gegen allgemeine Regeln des Völkerrechts nicht vorlägen. Unabhängig davon seien die von der Beschwerdeführerin angeführten möglichen terroristischen Handlungen der Bundesrepublik Deutschland nicht zurechenbar und auch nur begrenzt vorherzusehen und zu verhindern.
Mit Ihrer Verfassungsbeschwerde wendet sich die Beschwerdeführerin gegen die gerichtlichen Entscheidungen und rügt die Stationierung der Atomwaffen, die keine Rechtfertigung in der verfassungsmäßigen Ordnung habe. Sie sieht sich hierdurch in ihrem Grundrecht auf Leben und körperliche Unversehrtheit (Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG), der Eigentumsgarantie (Art. 14 Abs. 1 GG) und in der Rechtsschutzgarantie des Art. 19 Abs. 4 GG verletzt.
Wesentliche Erwägungen der Kammer:
Die Verfassungsbeschwerde wird nicht zur Entscheidung angenommen, weil sie mangels hinreichender Substantiierung unzulässig ist.
1. Die von der Beschwerdeführerin geltend gemachten Gefahren, die nach ihrer Auffassung von den in Büchel stationierten Atomwaffen ausgehen, vermögen einen Grundrechtseingriff nicht zu begründen.
a) Eine Verletzung von Art. 2 Abs. 2 Satz 1 oder Art. 14 Abs. 1 GG setzt einen der Bundesrepublik Deutschland zurechenbaren Eingriff oder zumindest eine eingriffsgleiche Gefährdung voraus. Der Grundrechtsschutz ist nicht auf imperative Eingriffe beschränkt, die unmittelbar und gezielt durch ein vom Staat verfügtes, erforderlichenfalls zwangsweise durchzusetzendes Ge- oder Verbot zu einer Verkürzung grundrechtlich geschützter Interessen führen. Grundrechte können vielmehr auch bei mittelbaren und faktischen Beeinträchtigungen betroffen sein, wenn diese in Zielsetzung und Wirkung imperativen Eingriffen gleichkommen. Dies setzt jedoch voraus, dass der Staat diese als für ihn vorhersehbare Folge zumindest in Kauf nimmt. Ist er aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen gehindert, auf den Geschehensablauf Einfluss zu nehmen, kann ihm dieser verfassungsrechtlich nicht als Folge eigenen Verhaltens zugerechnet werden. Die Verantwortlichkeit der an das Grundgesetz gebundenen öffentlichen Gewalt, und damit auch der Schutzbereich der Grundrechte, enden daher grundsätzlich dort, wo ein Vorgang in seinem wesentlichen Verlauf von einer fremden Macht nach ihrem, von der Bundesrepublik Deutschland unabhängigen Willen gestaltet wird. Das Risiko terroristischer Anschläge ist der deutschen Staatsgewalt daher nicht zuzurechnen, weil die Bedrohung der geschützten Rechtsgüter Leben und Eigentum von Dritten ausgeht, insbesondere von terroristischen Vereinigungen.
b) Auf eine Verletzung von Schutzpflichten des Staates gegenüber seinen Bürgern kann sich die Beschwerdeführerin ebenfalls nicht berufen. Sie hat nicht dargelegt, dass allein der Abzug der Atomwaffen geeignet wäre, die Gefahren terroristischer Angriffe oder Unglücksfälle abzuwenden. Sie trägt selbst vor, dass die Bundesrepublik Deutschland Schutzvorkehrungen getroffen habe. Aus ihrem Vortrag ergibt sich nicht, dass diese gänzlich ungeeignet oder völlig unzulänglich wären.
c) Die Beschwerdeführerin konnte auch die für eine Verfassungsbeschwerde erforderliche unmittelbare Betroffenheit nicht darlegen. Sie wohnt zwar nur 3,5 km von dem Flugplatz entfernt. Die Beschwerdeführerin unterscheidet sich insoweit aber nicht von der unüberschaubar großen Zahl von Anwohnern und Nutzern vieler im Bundesgebiet vorhandener gefährdeter sowie gefährlicher Einrichtungen, die mit ähnlichen existenzbedrohenden oder -vernichtenden Folgen zum Ziel terroristischer Angriffe werden könnten.
2. Soweit sich die Beschwerdeführerin auf eine Verletzung von Art. 2 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 25 GG beruft, sind die angegriffenen Entscheidungen ebenfalls nicht zu beanstanden.
Die allgemeinen Regeln des Völkerrechts sind Teil der verfassungsmäßigen Ordnung im Sinne von Art. 2 Abs. 1 GG und gehen den einfachen Gesetze vor. Rechte und Pflichten für die Bewohner des Bundesgebietes erzeugen sie nach Art. 25 Satz 2 Halbsatz 2 GG unmittelbar allerdings nur, soweit sie einen hinreichenden Individualbezug aufweisen. Art. 25 GG eröffnet keine Popularklage abweichend von Art. 19 Abs. 4 GG. Voraussetzung für die Berufung auf eine aus Art. 25 Satz 2 Halbsatz 2 GG subjektivierte allgemeine Regel des Völkerrechts ist vielmehr, dass der Betroffene Träger der individuellen hochrangigen Rechtsgüter ist, zu denen die Norm einen engen Bezug hat, und dass er in deren Schutzbereich einbezogen ist. Zudem muss er geltend machen, gerade durch das mutmaßlich völkerrechtswidrige Verhalten deutscher Staatsorgane unmittelbar in diesen Rechtsgütern betroffen zu sein. Dies ist vorliegend nicht ersichtlich. Die von der Beschwerdeführerin benannten Normen des humanitären Völkerrechts, etwa das Gebot, zwischen Soldaten und Zivilbevölkerung zu unterscheiden, und das Gebot, keine unnötigen Leiden zu verursachen, schützen Personen, die unmittelbar mit Kampfhandlungen konfrontiert sind. Das ist bei der Beschwerdeführerin offenkundig nicht der Fall.
3. Eine Verletzung des Rechts auf effektiven Rechtsschutz hat die Beschwerdeführerin ebenfalls nicht hinreichend dargelegt. Art. 19 Abs. 4 GG garantiert keine allgemeine Rechtmäßigkeitskontrolle der öffentlichen Hand, sondern trifft eine Systementscheidung für den Individualrechtsschutz. Die Verwaltungsgerichte und das Oberverwaltungsgericht haben deshalb die Zulässigkeit der verfahrensgegenständlichen allgemeinen Leistungsklage zu Recht von einer Klagebefugnis abhängig gemacht und deren Vorliegen zutreffend verneint.
Erfolglose Verfassungsbeschwerde gegen die Stationierung US-amerikanischer Atomwaffen auf dem Fliegerhorst Büchel
Pressemitteilung Nr. 28/2018 vom 27. April 2018
Beschluss vom 15. März 2018
2 BvR
1371/13
Mit heute veröffentlichtem Beschluss hat die 2. Kammer des Zweiten Senats des Bundesverfassungsgerichts eine Verfassungsbeschwerde nicht zur Entscheidung angenommen, die die Stationierung US-amerikanischer Atomwaffen auf dem Fliegerhorst Büchel zum Gegenstand hatte. Die Verfassungsbeschwerde ist bereits unzulässig, weil die Beschwerdeführerin einen Eingriff in Grundrechte ebenso wenig dargelegt hat wie eine Verletzung grundrechtlicher Schutzpflichten.
Sachverhalt:
Der Fliegerhorst Büchel ist ein Luftwaffenstandort im Landkreis Cochem-Zell in Rheinland-Pfalz. Auf dem Stützpunkt sind deutsche und amerikanische Luftstreitkräfte stationiert. Zu deren Aufgaben gehören vor allem die Verwahrung, Bewachung, Wartung und Freigabe der dort im Rahmen der innerhalb der NATO vereinbarten nuklearen Teilhabe gelagerten Atomwaffen. Die Beschwerdeführerin wohnt circa 3,5 Kilometer vom Fliegerhorst Büchel entfernt.
Mit einem Schreiben an den Bundesminister der Verteidigung schilderte die Beschwerdeführerin ihre Befürchtung, terroristischen Angriffen auf den Fliegerhorst in besonderer Weise ausgesetzt zu sein. Die Nuklearwaffen verstießen gegen Prinzipien des humanitären Völkerrechts. Eine rechtswidrige Kriegsführung von deutschem Boden aus verletze den NATO-Vertrag und die deutsche Verfassung. Aus Art. 25 und 26 GG folge, dass jeder Bürger vom Staat verlangen könne, dass eine von deutschem Boden ausgehende rechtswidrige Kriegsführung unterbunden werden müsse. Der Bundesminister der Verteidigung verwies in seinem Antwortschreiben darauf, dass durch infrastrukturelle, technische und organisatorische Maßnahmen ein Höchstmaß an Schutz und Sicherheit für die Einwohner Deutschlands gewährleistet werde.
Mit ihrer Klage vor dem Verwaltungsgericht Köln beantragte die Beschwerdeführerin, die Bundesrepublik Deutschland zu verurteilen, gegenüber den USA darauf hinzuwirken, die auf dem Fliegerhorst Büchel gelagerten amerikanischen Atomwaffen abzuziehen.
Das Verwaltungsgericht Köln wies die Klage unter anderem mangels Klagebefugnis als unzulässig ab.
Der vor dem Oberverwaltungsgericht Nordrhein-Westfalen gestellte Antrag auf Zulassung der Berufung blieb erfolglos. Dabei führte das Oberverwaltungsgericht aus, dass Verstöße gegen allgemeine Regeln des Völkerrechts nicht vorlägen. Unabhängig davon seien die von der Beschwerdeführerin angeführten möglichen terroristischen Handlungen der Bundesrepublik Deutschland nicht zurechenbar und auch nur begrenzt vorherzusehen und zu verhindern.
Mit Ihrer Verfassungsbeschwerde wendet sich die Beschwerdeführerin gegen die gerichtlichen Entscheidungen und rügt die Stationierung der Atomwaffen, die keine Rechtfertigung in der verfassungsmäßigen Ordnung habe. Sie sieht sich hierdurch in ihrem Grundrecht auf Leben und körperliche Unversehrtheit (Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG), der Eigentumsgarantie (Art. 14 Abs. 1 GG) und in der Rechtsschutzgarantie des Art. 19 Abs. 4 GG verletzt.
Wesentliche Erwägungen der Kammer:
Die Verfassungsbeschwerde wird nicht zur Entscheidung angenommen, weil sie mangels hinreichender Substantiierung unzulässig ist.
1. Die von der Beschwerdeführerin geltend gemachten Gefahren, die nach ihrer Auffassung von den in Büchel stationierten Atomwaffen ausgehen, vermögen einen Grundrechtseingriff nicht zu begründen.
a) Eine Verletzung von Art. 2 Abs. 2 Satz 1 oder Art. 14 Abs. 1 GG setzt einen der Bundesrepublik Deutschland zurechenbaren Eingriff oder zumindest eine eingriffsgleiche Gefährdung voraus. Der Grundrechtsschutz ist nicht auf imperative Eingriffe beschränkt, die unmittelbar und gezielt durch ein vom Staat verfügtes, erforderlichenfalls zwangsweise durchzusetzendes Ge- oder Verbot zu einer Verkürzung grundrechtlich geschützter Interessen führen. Grundrechte können vielmehr auch bei mittelbaren und faktischen Beeinträchtigungen betroffen sein, wenn diese in Zielsetzung und Wirkung imperativen Eingriffen gleichkommen. Dies setzt jedoch voraus, dass der Staat diese als für ihn vorhersehbare Folge zumindest in Kauf nimmt. Ist er aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen gehindert, auf den Geschehensablauf Einfluss zu nehmen, kann ihm dieser verfassungsrechtlich nicht als Folge eigenen Verhaltens zugerechnet werden. Die Verantwortlichkeit der an das Grundgesetz gebundenen öffentlichen Gewalt, und damit auch der Schutzbereich der Grundrechte, enden daher grundsätzlich dort, wo ein Vorgang in seinem wesentlichen Verlauf von einer fremden Macht nach ihrem, von der Bundesrepublik Deutschland unabhängigen Willen gestaltet wird. Das Risiko terroristischer Anschläge ist der deutschen Staatsgewalt daher nicht zuzurechnen, weil die Bedrohung der geschützten Rechtsgüter Leben und Eigentum von Dritten ausgeht, insbesondere von terroristischen Vereinigungen.
b) Auf eine Verletzung von Schutzpflichten des Staates gegenüber seinen Bürgern kann sich die Beschwerdeführerin ebenfalls nicht berufen. Sie hat nicht dargelegt, dass allein der Abzug der Atomwaffen geeignet wäre, die Gefahren terroristischer Angriffe oder Unglücksfälle abzuwenden. Sie trägt selbst vor, dass die Bundesrepublik Deutschland Schutzvorkehrungen getroffen habe. Aus ihrem Vortrag ergibt sich nicht, dass diese gänzlich ungeeignet oder völlig unzulänglich wären.
c) Die Beschwerdeführerin konnte auch die für eine Verfassungsbeschwerde erforderliche unmittelbare Betroffenheit nicht darlegen. Sie wohnt zwar nur 3,5 km von dem Flugplatz entfernt. Die Beschwerdeführerin unterscheidet sich insoweit aber nicht von der unüberschaubar großen Zahl von Anwohnern und Nutzern vieler im Bundesgebiet vorhandener gefährdeter sowie gefährlicher Einrichtungen, die mit ähnlichen existenzbedrohenden oder -vernichtenden Folgen zum Ziel terroristischer Angriffe werden könnten.
2. Soweit sich die Beschwerdeführerin auf eine Verletzung von Art. 2 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 25 GG beruft, sind die angegriffenen Entscheidungen ebenfalls nicht zu beanstanden.
Die allgemeinen Regeln des Völkerrechts sind Teil der verfassungsmäßigen Ordnung im Sinne von Art. 2 Abs. 1 GG und gehen den einfachen Gesetze vor. Rechte und Pflichten für die Bewohner des Bundesgebietes erzeugen sie nach Art. 25 Satz 2 Halbsatz 2 GG unmittelbar allerdings nur, soweit sie einen hinreichenden Individualbezug aufweisen. Art. 25 GG eröffnet keine Popularklage abweichend von Art. 19 Abs. 4 GG. Voraussetzung für die Berufung auf eine aus Art. 25 Satz 2 Halbsatz 2 GG subjektivierte allgemeine Regel des Völkerrechts ist vielmehr, dass der Betroffene Träger der individuellen hochrangigen Rechtsgüter ist, zu denen die Norm einen engen Bezug hat, und dass er in deren Schutzbereich einbezogen ist. Zudem muss er geltend machen, gerade durch das mutmaßlich völkerrechtswidrige Verhalten deutscher Staatsorgane unmittelbar in diesen Rechtsgütern betroffen zu sein. Dies ist vorliegend nicht ersichtlich. Die von der Beschwerdeführerin benannten Normen des humanitären Völkerrechts, etwa das Gebot, zwischen Soldaten und Zivilbevölkerung zu unterscheiden, und das Gebot, keine unnötigen Leiden zu verursachen, schützen Personen, die unmittelbar mit Kampfhandlungen konfrontiert sind. Das ist bei der Beschwerdeführerin offenkundig nicht der Fall.
3. Eine Verletzung des Rechts auf effektiven Rechtsschutz hat die Beschwerdeführerin ebenfalls nicht hinreichend dargelegt. Art. 19 Abs. 4 GG garantiert keine allgemeine Rechtmäßigkeitskontrolle der öffentlichen Hand, sondern trifft eine Systementscheidung für den Individualrechtsschutz. Die Verwaltungsgerichte und das Oberverwaltungsgericht haben deshalb die Zulässigkeit der verfahrensgegenständlichen allgemeinen Leistungsklage zu Recht von einer Klagebefugnis abhängig gemacht und deren Vorliegen zutreffend verneint.
Zur Ausstrahlungswirkung des allgemeinen Gleichheitssatzes in das Zivilrecht
Pressemitteilung Nr. 29/2018 vom 27. April 2018
Beschluss vom 11. April 2018
1 BvR
3080/09
Der Erste Senat des Bundesverfassungsgerichts hat sich mit einem heute veröffentlichten Beschluss zu einem Stadionverbot mit der Ausstrahlungswirkung des allgemeinen Gleichbehandlungsgebots des Art. 3 Abs. 1 GG in das Zivilrecht befasst. Der Senat hat die Verfassungsbeschwerde eines mit einem bundesweiten Stadionverbot belegten Fußballanhängers als unbegründet zurückgewiesen. Dabei hat er festgestellt, dass dieses Verbot am Gleichbehandlungsgebot des Art. 3 Abs. 1 GG zu messen ist. Zur Begründung hierfür hat er angeführt, dass sich zwar auch nach den Grundsätzen der mittelbaren Drittwirkung kein objektives Verfassungsprinzip entnehmen lässt, wonach die Rechtsbeziehungen zwischen Privaten von diesen prinzipiell gleichheitsgerecht zu gestalten wären. Mittelbare Drittwirkung entfaltet der allgemeine Gleichheitssatz aber dann, wenn einzelne Personen mittels des privatrechtlichen Hausrechts von Veranstaltungen ausgeschlossen werden, die von Privaten aufgrund eigener Entscheidung einem großen Publikum ohne Ansehen der Person geöffnet werden und wenn der Ausschluss für die Betroffenen in erheblichem Umfang über die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben entscheidet. Die Veranstalter dürfen hier ihre Entscheidungsmacht nicht dazu nutzen, bestimmte Personen ohne sachlichen Grund von einem solchen Ereignis auszuschließen. Ein Stadionverbot kann allerdings auch ohne Nachweis einer Straftat auf eine auf Tatsachen gründende Besorgnis gestützt werden, dass die Betroffenen künftig Störungen verursachen werden. Die Betroffenen sind grundsätzlich zuvor anzuhören und ihnen ist auf Verlangen vorprozessual eine Begründung mitzuteilen.
Sachverhalt:
Der Beschwerdeführer besuchte 2006 als Anhänger des FC Bayern München als Sechzehnjähriger ein Spiel gegen den MSV Duisburg im dortigen Stadion. Nach dem Ende des Spiels kam es aus einer Gruppe von Anhängern des FC Bayern München, in der sich auch der Beschwerdeführer befand, zu verbalen und körperlichen Auseinandersetzungen mit Anhängern des MSV Duisburg, wobei Personen- und Sachschäden entstanden. In der Folge wurden etwa 50 Personen, darunter der Beschwerdeführer, zur Feststellung der Personalien in polizeilichen Gewahrsam genommen. Gegen den Beschwerdeführer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Landfriedensbruchs eingeleitet. Daraufhin sprach der MSV Duisburg auf Anregung des örtlichen Polizeipräsidiums ein bundesweites Stadionverbot bis Juni 2008 aus. Er handelte insoweit im Namen des Deutschen Fußballbundes e. V., des Ligaverbandes sowie sämtlicher Vereine der Fußball-Bundesliga, die sich für die Festsetzung solcher Verbote sowie zur Inhaberschaft des Hausrechts und Ausübung eines Hausverbots über ihre jeweiligen Spielstätten wechselseitig bevollmächtigt hatten. Gestützt wurde dies auf das Hausrecht und die „Stadionverbots-Richtlinien“ des Deutschen Fußball-Bundes in der damals gültigen Fassung. Das Ermittlungsverfahren gegen den Beschwerdeführer wurde wegen Geringfügigkeit gemäß § 153 Abs. 1 StPOeingestellt. Dennoch entschied der Verein ohne Anhörung des Beschwerdeführers, das festgesetzte Stadionverbot aufrechtzuerhalten. Der FC Bayern München schloss den Beschwerdeführer in der Folgezeit aus dem Verein aus und kündigte dessen Jahreskartenabonnement.
Der Beschwerdeführer klagte auf Aufhebung des bundesweiten Stadionverbots und stellte nach Erledigung des ursprünglichen Klagebegehrens seinen Klageantrag im Berufungsverfahren auf einen Antrag auf Feststellung der Rechtswidrigkeit des Verbots um. Klage und Berufung sowie die Revision zum Bundesgerichtshof blieben erfolglos. Mit seiner Verfassungsbeschwerde rügt der Beschwerdeführer eine Verletzung seiner Grundrechte dadurch, dass er ohne tragfähige Erklärung und Begründung allein aufgrund eines bloßen Verdachts vom Stadionbesuch ausgeschlossen worden sei.
Wesentliche Erwägungen des Senats:
Die angegriffenen Entscheidungen tragen der Ausstrahlungswirkung der Grundrechte in das Zivilrecht hinreichend Rechnung.
1. Die verfassungsrechtliche Beurteilung der angegriffenen Entscheidungen richtet sich nach den Grundsätzen der mittelbaren Drittwirkung der Grundrechte. Die angegriffenen Entscheidungen betreffen einen Rechtsstreit zwischen Privaten über die Reichweite der zivilrechtlichen Befugnisse aus Eigentum und Besitz gegenüber Dritten. Nach ständiger Rechtsprechung können die Grundrechte in solchen Streitigkeiten im Wege der mittelbaren Drittwirkung Wirksamkeit entfalten. Danach verpflichten die Grundrechte die Privaten grundsätzlich nicht unmittelbar untereinander selbst. Sie entfalten jedoch auch auf die privatrechtlichen Rechtsbeziehungen Ausstrahlungswirkung und sind von den Fachgerichten, insbesondere über zivilrechtliche Generalklauseln und unbestimmte Rechtsbegriffe, bei der Auslegung des Fachrechts zur Geltung zu bringen. Die Grundrechte strahlen so als verfassungsrechtliche Wertentscheidungen in das Zivilrecht ein.
Die Reichweite der mittelbaren Grundrechtswirkung hängt dabei von den jeweiligen Umständen des Einzelfalls ab. Maßgeblich ist, dass die Freiheitssphären der Grundrechtsinhaber in einen Ausgleich gebracht werden müssen, der die in den Grundrechten liegenden Wertentscheidungen hinreichend zur Geltung bringt.
2. Die angegriffenen Entscheidungen stützen sich auf die §§ 862, 1004 BGB und leiten die Reichweite des privatrechtlichen Hausrechts der Stadionbetreiber gegenüber Zugang begehrenden Fußballfans aus Eigentums- und Besitzrechten her. Aus verfassungsrechtlicher Sicht sind hierbei die Eigentumsgarantien des Art. 14 Abs. 1 GG sowie ein Schutz vor willkürlicher Ungleichbehandlung nach Art. 3 Abs. 1 GG zu beachten.
Allerdings enthält Art. 3 Abs. 1 GG kein objektives Verfassungsprinzip, wonach die Rechtsbeziehungen zwischen Privaten von diesen prinzipiell gleichheitsgerecht zu gestalten wären. Dahingehende Anforderungen ergeben sich auch nicht aus den Grundsätzen der mittelbaren Drittwirkung. Grundsätzlich gehört es zur Freiheit jeder Person, nach eigenen Präferenzen darüber zu bestimmen, mit wem sie wann unter welchen Bedingungen welche Verträge abschließen und wie sie hierbei auch von ihrem Eigentum Gebrauch machen will.
Gleichheitsrechtliche Anforderungen für das Verhältnis zwischen Privaten können sich aus Art. 3 Abs. 1 GG jedoch für spezifische Konstellationen ergeben. Eine solche Konstellation liegt dem hier in Frage stehenden bundesweit gültigen Stadionverbot zugrunde. Maßgeblich für die mittelbare Drittwirkung des Gleichbehandlungsgebots ist dessen Charakter als einseitiger, auf das Hausrecht gestützter Ausschluss von Veranstaltungen, die aufgrund eigener Entscheidung der Veranstalter einem großen Publikum ohne Ansehen der Person geöffnet werden und der für die Betroffenen in erheblichem Umfang über die Teilnahme am gesellschaftlichen Leben entscheidet. Indem ein Privater eine solche Veranstaltung ins Werk setzt, erwächst ihm von Verfassungs wegen auch eine besondere rechtliche Verantwortung. Er darf seine hier aus dem Hausrecht - so wie in anderen Fällen möglicherweise aus einem Monopol oder aus struktureller Überlegenheit - resultierende Entscheidungsmacht nicht dazu nutzen, bestimmte Personen ohne sachlichen Grund von einem solchen Ereignis auszuschließen. Die verfassungsrechtliche Anerkennung des Eigentums als absolutes Recht und die daraus folgende einseitige Bestimmungsmacht des Hausrechtsinhabers ist hier, anknüpfend an die Sozialbindung des Eigentums, mit der auch von den Gerichten zu beachtenden Ausstrahlungswirkung des Gleichbehandlungsgebots in Ausgleich zu bringen.
3. Die Auflösung des Spannungsverhältnisses zwischen Eigentümerbefugnissen und Gleichbehandlungsgebot bei der Beurteilung eines auf das privatrechtliche Hausrecht gestützten Stadionverbots ist in erster Linie Sache der Zivilgerichte. Diese haben hierbei einen weiten Spielraum. Das Bundesverfassungsgericht greift nur ein, wenn Auslegungsfehler erkennbar werden, die auf einer grundsätzlich unrichtigen Auffassung von der Bedeutung eines Grundrechts beruhen. Maßgeblich ist insoweit nicht, ob die Zivilgerichte sich für ihre Wertungen unmittelbar auf die Grundrechte berufen. Entscheidend ist allein, dass den grundrechtlichen Wertungen im Ergebnis hinreichend Rechnung getragen wird.
a) Danach haben die Zivilgerichte in Blick auf das Gebot der Gleichbehandlung sicherzustellen, dass Stadionverbote nicht willkürlich festgesetzt werden, sondern auf einem sachlichen Grund beruhen müssen. Insbesondere obliegt es ihnen, den gebotenen Ausgleich mit den Eigentümerbefugnissen im Blick auf die tatsächlichen Umstände, unter denen Stadionverbote ergehen, die mit ihnen erstrebte Wirkung sowie die Verantwortung der Betroffenen näher zu konkretisieren. Verfassungsrechtlich ist nicht zu beanstanden, wenn die Gerichte einen sachlichen Grund zur Verhängung eines Stadionverbots schon in der begründeten Besorgnis sehen, dass von einer Person die Gefahr künftiger Störungen ausgeht. Angesichts des berechtigten Interesses der Stadionbetreiber an einem störungsfreien Verlauf der Fußballspiele und ihrer Verantwortung für die Sicherheit von Sportlern und Publikum bedarf es hierfür nicht der Erweislichkeit vorheriger Straftaten oder rechtswidrigen Handelns. Es reicht, dass sich die Besorgnis künftiger Störungen durch die Betroffenen auf konkrete und nachweisliche Tatsachen von hinreichendem Gewicht stützen lässt.
b) Mit dem Erfordernis eines sachlichen Grundes für die Verhängung eines Stadionverbots verbinden sich verfahrensrechtliche Anforderungen. Insbesondere müssen die Stadionbetreiber die ihnen zumutbaren Anstrengungen zur Aufklärung des Sachverhalts unternehmen. Dazu gehört jedenfalls grundsätzlich die vorherige Anhörung der Betroffenen. Auch ist die Entscheidung auf Verlangen zu begründen, um den Betroffenen die Durchsetzung ihrer Rechte zu ermöglichen.
Die Anerkennung solcher Verfahrensrechte steht nicht im Widerspruch zum Charakter des Rechtsstreits als Zivilrechtsstreit. Zwar hat sie im Zivilrecht dann keine Grundlage, wenn es um den Austausch von Leistungen geht, die im freien Belieben der Parteien liegen. Stehen privatrechtlichen Entscheidungen von vorneherein keine eigenen Rechtspositionen Dritter gegenüber und kann über sie ohne Rücksicht auf die Belange der Gegenseite entschieden werden, bedarf es jedenfalls in der Regel solcher Rechte nicht. Das liegt jedoch anders, soweit in das Rechtsverhältnis zwischen den Parteien das grundrechtliche Gleichbehandlungsgebot einstrahlt und die Ablehnung einer Leistung eines rechtfertigenden Grundes bedarf. Wenn hier auf dem Hausrecht beruhende, faktisch als Sanktion wirkende Entscheidungen getroffen werden, die den Betroffenen gegenüber eines tragfähigen Grundes bedürfen, müssen jedenfalls grundlegende Anforderungen beachtet werden, die es den Betroffenen ermöglichen, sich mit den Vorwürfen auseinanderzusetzen und ihre Rechte unter Darlegung ihrer Sichtweise rechtzeitig geltend zu machen. Dies schließt nicht aus, dass in begründeten Fällen die Entscheidung zunächst auch ohne Anhörung ergehen und diese nachgeholt werden kann.
Auch hier obliegt die nähere Konkretisierung der Anforderungen in erster Linie den Fachgerichten. Welche Anstrengungen den Stadionbetreibern zur Aufklärung des Sachverhalts zumutbar sind, ist von den Fachgerichten ebenso zu konkretisieren wie die Anforderungen an die vorherige Anhörung und gegebenenfalls die Begründung auf Verlangen. Hierbei wird dem Massencharakter von Großveranstaltungen des Sports ebenso Rechnung zu tragen sein wie den spezifischen Gefährdungen, die von gewaltbereiten Fangruppen ausgehen, und den Belangen der vom Stadionbesuch Ausgeschlossenen.
4. Hiervon ausgehend sind die fachgerichtlichen Entscheidungen nicht zu beanstanden.
a) Der Bundesgerichtshof bestätigt das gegenüber dem Beschwerdeführer festgesetzte Stadionverbot als rechtmäßig, weil es sich auf einen sachlichen Grund stützen könne. Seine Erwägungen dazu halten den verfassungsrechtlichen Anforderungen einer Drittwirkung des Art. 3 Abs. 1 GG Stand.
Nach der Begründung des Bundesgerichtshofs liegt ein Sachgrund in der Gefahr, dass von den Betroffenen künftig Störungen bei Sportveranstaltungen zu besorgen seien. Die Annahme einer solchen Gefahr dürfe sich dabei nicht auf subjektive Befürchtungen stützen, sondern müsse auf objektiven Tatsachen beruhen. Dieser Ausgangspunkt entspricht den dargelegten verfassungsrechtlichen Anforderungen. Der Bundesgerichtshof nimmt den in dieser Konstellation aus den Wertungen des Art. 3 Abs. 1 GG auch im Privatrechtsverhältnis zur Geltung zu bringenden Anspruch des Beschwerdeführers auf willkürfreie Entscheidung auf und bringt ihn in Ausgleich mit dem Recht der Stadionbetreiberin, die Fußballspiele in ihrem Stadion nach eigenen Vorstellungen und insbesondere nach den von ihr zu verantwortenden Sicherheitsvorkehrungen zu gestalten.
Die angegriffenen Entscheidungen sehen den sachlichen Grund für die ursprüngliche Festsetzung des Stadionverbots in der Einleitung eines staatsanwaltschaftlichen Ermittlungsverfahrens, über das zum damaligen Zeitpunkt noch nicht entschieden war. Hiergegen sind verfassungsrechtliche Einwände nicht zu erheben. Der Bundesgerichtshof enthebt die Veranstalter, wie er ausdrücklich ausführt, nicht einer Plausibilitätskontrolle, um Fälle auszuschließen, in denen ein Verfahren offensichtlich willkürlich oder aufgrund falscher Tatsachenannahmen eingeleitet wurde. Dass sich die Stadionbetreiber bei noch offenem Ausgang des Ermittlungsverfahrens aber im Übrigen zunächst der Einschätzung der Staatsanwaltschaft oder Polizei anschließen können, ist nicht sachwidrig. Wegen des berechtigten Interesses der Stadionbetreiber, zur Gewährleistung der Sicherheit möglichst rasch Maßnahmen zu ergreifen, muss ihnen auch nicht zugemutet werden, zunächst das Ergebnis der Ermittlungen abzuwarten.
Des Weiteren stellt der Bundesgerichtshof darauf ab, dass der sachliche Grund für das Stadionverbot durch die spätere Einstellung des Verfahrens nicht entfallen sei. Zwar könne nach Einstellung des Verfahrens nach § 153 StPO nicht angenommen werden, dass der Beschwerdeführer selbst Straftaten begangen habe. Mit der Einstellung des Verfahrens seien jedoch nicht die Umstände entfallen, die zunächst den Anfangsverdacht für die Einleitung des Verfahrens und auch die weitere Besorgnis künftiger Störungen seitens des Beschwerdeführers begründeten. Der Beschwerdeführer habe sich wissentlich in einem zu Gewalttätigkeiten neigenden Umfeld bewegt, aus dem heraus auch tatsächlich erhebliche Gewalttaten begangen worden seien. Hierin durfte der Bundesgerichtshof einen sachlichen Grund sehen, der das Stadionverbot zu tragen vermag. Er geht insoweit nicht unbesehen von einer fortwirkenden Rechtfertigung des Verbots durch die einmal eingeleiteten Ermittlungen auch nach deren Einstellung aus, sondern hält das Stadionverbot nun mit für sich stehenden Feststellungen zu einer auch nach Einstellung des Verfahrens gerechtfertigten Besorgnis aufrecht, dass der Beschwerdeführer künftig Störungen verursachen werde.
b) Im Hinblick auf die verfahrensrechtlichen Anforderungen konnte die Verfassungsbeschwerde gleichfalls keinen Erfolg haben. Jedenfalls für die Zukunft ist nämlich in den inzwischen geänderten Richtlinien ein in der Regel vor der Festsetzung des Stadionverbots zu gewährendes Anhörungsrecht ebenso vorgesehen wie bei verständiger Auslegung zumindest in den Fällen der Überprüfung des Stadionverbots eine Begründung solcher Entscheidungen. Für das konkret in Streit stehende, inzwischen erledigte Stadionverbot hatte der Beschwerdeführer im Übrigen im Rahmen des zivilrechtlichen Verfahrens wenigstens nachträglich die Möglichkeit, sich mit den Gründen für das Stadionverbot auseinanderzusetzen und sich hierzu Gehör zu verschaffen.
Unzulässige Normenkontrolle zu einer Personalüberleitungsbestimmung
Pressemitteilung Nr. 23/2018 vom 17. April 2018
Beschluss vom 21. März 2018
1 BvL 1/14
Wenn ein Gericht eine Normenkontrolle durch das Bundesverfassungsgericht - nach Art. 100 Abs. 1 GG - beantragt, muss es erläutern, warum die Unwirksamkeit der Norm für seine Entscheidung ausschlaggebend ist. Der Erste Senat hat mit heute veröffentlichtem Beschluss entschieden, dass die Vorlage des 8. Senats des Bundesarbeitsgerichts vom 26. September 2013 - 8 AZR 775/12 (A) - dieser Anforderung nicht hinreichend Rechnung trägt. Gegenstand der Vorlage war die Personalüberleitungsnorm des § 6c Abs. 1 Satz 1 SGB II in der Fassung vom 3. August 2010.
Sachverhalt:
Das Bundesarbeitsgericht hatte über einen Fall zu entscheiden, in dem sich die Klägerin des Ausgangsverfahrens gegen einen Personalübergang wendet. Sie war seit langem bei der Bundesagentur für Arbeit angestellt und in unterschiedlichen Aufgabenbereichen - SGB II (Grundsicherung für Arbeitsuchende) und SGB III (Arbeitsförderung) - leitend eingesetzt. Als der Landkreis im Zuge einer Verwaltungsreform die Aufgaben der Grundsicherung als kommunaler Träger übernahm, wurde ihr mitgeteilt, sie sei nun beim Landkreis beschäftigt. Dem widersprach die Klägerin; sie wollte weiterhin bei der Bundesagentur für Arbeit beschäftigt sein. Es kommt insofern darauf an, ob die Regelung des § 6c Abs. 1 Satz 1 SGB II auf sie Anwendung findet. Darin hat der Gesetzgeber bestimmt, dass Beamtinnen und Beamte sowie Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die zuvor mindestens 24 Monate die Aufgaben der Bundesagentur für Arbeit nach dem SGB II wahrgenommen haben, in den Dienst einer sogenannten Optionskommune übertreten, die dann alleinige Trägerschaft im SGB II übernimmt.
Das Arbeitsgericht und das Landesarbeitsgericht sind davon ausgegangen, dass die Klägerin gar nicht von der Regelung des § 6c Abs. 1 Satz 1 SGB II erfasst sei, da sie nicht ausschließlich Aufgaben nach dem SGB II wahrgenommen habe. Der 8. Senat des Bundesarbeitsgerichts war hingegen der Ansicht, dass die Klägerin unabhängig vom zeitlichen Umfang ihrer Tätigkeiten im Bereich des SGB II dem Geltungsbereich der Norm unterfalle. Die Norm beeinträchtige aber das grundrechtlich geschützte Interesse von Beschäftigten, den Arbeitgeber als Vertragspartner des Arbeitsvertrages selbst zu wählen. Das Bundesarbeitsgericht hat dem Bundesverfassungsgericht deshalb die Frage vorgelegt, ob § 6c Abs. 1 Satz 1 SGB II mit dem Grundrecht der Berufsfreiheit des Art. 12 Abs. 1 Satz 1 GG vereinbar ist.
Wesentliche Erwägungen des Senats:
Der Erste Senat des Bundesverfassungsgerichts hat die Vorlage für unzulässig befunden.
Wenn ein Gericht dem Bundesverfassungsgericht nach Art. 100 Abs. 1 GG die Frage vorlegt, ob eine Norm mit dem Grundgesetz vereinbar ist, muss es erläutern, warum die Unwirksamkeit der Norm für seine Entscheidung ausschlaggebend ist. Es muss insofern auch darlegen, ob und welche Auswirkungen die Norm für seine Entscheidung hat. Diesen Anforderungen entspricht der Vorlagebeschluss des 8. Senats des Bundesarbeitsgerichts nicht.
Im Streitfall ist der Umfang der für eine gesetzliche Personalüberleitung nach § 6c Abs. 1 SGB II notwendigen Tätigkeiten im Bereich des SGB II umstritten und ungeklärt. Die Annahme des Bundesarbeitsgerichts, es komme auf den zeitlichen Umfang der konkret wahrgenommenen Tätigkeiten nicht weiter an, kann die Entscheidung nicht tragen. Sie widerspricht offensichtlich dem Willen des Gesetzgebers. Dieser wollte durch den Übergang von eingearbeitetem und erfahrenem Personal die Qualität der Aufgabenerfüllung in der Grundsicherung für Arbeitsuchende gewahrt wissen. Für Personalüberleitungsbestimmungen im öffentlichen Dienst ist auch sonst regelmäßig maßgeblich, welche Aufgaben in welchem Umfang getätigt wurden. Es wurde nicht hinreichend dargelegt, warum dies hier anders sein sollte.
Fehlendes Bemühen um Terminsverlegung kann in Kostenentscheidung berücksichtigt werden
Pressemitteilung Nr. 22/2018 vom 13. April 2018
Beschluss vom 14. März 2018
1 BvR 300/18
Mit heute veröffentlichtem Beschluss hat die 1. Kammer des Ersten Senats des Bundesverfassungsgerichts eine Verfassungsbeschwerde gegen eine sozialgerichtliche Kostenentscheidung nach Erledigung nicht zur Entscheidung angenommen. Der Beschwerdeführer hat nicht substantiiert dargelegt, dass die zu seinen Lasten erfolgte Kostenentscheidung unter Verletzung des Willkürverbots aus Art. 3 Abs. 1 GG ergangen ist und ihn daher in seinen Grundrechten verletzt hat.
Sachverhalt:
Die Antragsgegnerin, die Bundesagentur für Arbeit, lud den Beschwerdeführer zu einem Meldetermin, an dem der Beschwerdeführer wegen seiner bis dahin noch bestehenden beruflichen Verpflichtung verhindert war. Ohne sich zuvor telefonisch bei der Antragsgegnerin um eine Verlegung zu bemühen, legte der Beschwerdeführer durch seinen Anwalt Widerspruch gegen den Termin ein und beantragte die gerichtliche Anordnung der aufschiebenden Wirkung seines Widerspruchs. Die Antragsgegnerin verlegte den Termin umgehend. Daraufhin erklärte der Beschwerdeführer seinen Antrag für erledigt und beantragte die Erstattung seiner Kosten.
Das Sozialgericht entschied, dass der Beschwerdeführer seine Kosten selbst zu tragen habe. Seine dagegen gerichtete Anhörungsrüge blieb erfolglos. Mit seiner Verfassungsbeschwerde rügt der Beschwerdeführer eine Verletzung des Willkürverbots aus Art. 3 Abs. 1 GG.
Wesentliche Erwägungen der Kammer:
Der Beschwerdeführer hat eine mögliche Verletzung von Art. 3 Abs. 1 GG nicht ausreichend dargelegt.
Die Kostenentscheidung des § 193 Abs. 1 Satz 3 SGG steht im richterlichen Ermessen. Die vorliegend getroffene richterliche Entscheidung - keine Kostenerstattung durch die Antragsgegnerin - ist weder von sachfremden Erwägungen getragen noch gänzlich unvertretbar. Dies wäre aber die Voraussetzung für eine Verletzung des Willkürverbots aus Art. 3 Abs. 1 GG. Unter dem Gesichtspunkt, dass die Antragsgegnerin durch ihre Terminsbestimmung den gerichtlichen Antrag erst veranlasst hat, käme zwar auch eine Kostenentscheidung nach dem Verursacherprinzip und damit zu Gunsten des Beschwerdeführers in Betracht.
In vertretbarer Weise hat das Sozialgericht seiner Entscheidung aber zugrunde gelegt, dass es nach den Umständen des Einzelfalls nahelag, dass auch ein einfaches außergerichtliches Bemühen um eine Terminsverlegung voraussichtlich erfolgreich gewesen wäre. Der Beschwerdeführer hat jedoch weder selbst noch durch seinen Anwalt den Versuch unternommen, formlos mit der Antragsgegnerin Kontakt aufzunehmen. So hätte geklärt werden können, ob der Behörde ein Versehen unterlaufen ist, etwa weil sie übersehen hat, dass er wegen seiner beruflichen Verpflichtungen am Meldetermin verhindert war. Vielmehr hat der Beschwerdeführer direkt einen gerichtlichen Antrag gestellt, wobei die damit verbundene Bindung von Ressourcen und Kostenfolge mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht notwendig gewesen wäre.
Dem Beschwerdeführer ist zwar zuzugestehen, dass vor einem gerichtlichen Antrag grundsätzlich keine förmliche Entscheidung der Ausgangsbehörde eingeholt werden muss. Aus der Begründung der Kostenentscheidung geht allerdings hervor, dass das Sozialgericht zwischen der Notwendigkeit einer solchen behördlichen Entscheidung und dem allgemeinen Rechtsschutzbedürfnis unterschieden hat. Letzteres kann fehlen, wenn es naheliegt, dass die Behörde zu einer unverzüglichen Korrektur bereit ist.
Vorschriften zur Einheitsbewertung für die Bemessung der Grundsteuer verfassungswidrig
Pressemitteilung Nr. 21/2018 vom 10. April 2018
Urteil vom 10. April 2018
1 BvL 11/14, 1 BvR 889/12, 1 BvR 639/11, 1 BvL 1/15, 1 BvL 12/14
Die Regelungen des Bewertungsgesetzes zur Einheitsbewertung von Grundvermögen in den „alten“ Bundesländern sind jedenfalls seit dem Beginn des Jahres 2002 mit dem allgemeinen Gleichheitssatz unvereinbar. Das Festhalten des Gesetzgebers an dem Hauptfeststellungszeitpunkt von 1964 führt zu gravierenden und umfassenden Ungleichbehandlungen bei der Bewertung von Grundvermögen, für die es keine ausreichende Rechtfertigung gibt. Mit dieser Begründung hat der Erste Senat des Bundesverfassungsgerichts die Vorschriften mit Urteil vom heutigen Tage für verfassungswidrig erklärt und bestimmt, dass der Gesetzgeber spätestens bis zum 31. Dezember 2019 eine Neuregelung zu treffen hat. Bis zu diesem Zeitpunkt dürfen die verfassungswidrigen Regeln weiter angewandt werden. Nach Verkündung einer Neuregelung dürfen sie für weitere fünf Jahre ab der Verkündung, längstens aber bis zum 31. Dezember 2024 angewandt werden.
Sachverhalt:
Einheitswerte für Grundbesitz werden nach den Vorschriften des Bewertungsgesetzes in den „alten“ Bundesländern noch heute auf der Grundlage der Wertverhältnisse zum 1. Januar 1964 ermittelt und bilden die Grundlage für die Bemessung der Grundsteuer. Der Entscheidung liegen fünf Verfahren, drei Richtervorlagen des Bundesfinanzhofs und zwei Verfassungsbeschwerden, zugrunde. Die Klägerinnen und Kläger der Ausgangsverfahren beziehungsweise Beschwerdeführerinnen und Beschwerdeführer sind Eigentümer von bebauten Grundstücken in verschiedenen „alten“ Bundesländern, die jeweils vor den Finanzgerichten gegen die Festsetzung des Einheitswertes ihrer Grundstücke vorgegangen sind. In drei Revisionsverfahren hat der Bundesfinanzhof die Verfahren ausgesetzt und dem Bundesverfassungsgericht die Frage vorgelegt, ob die einschlägigen Vorschriften des Bewertungsgesetzes wegen Verstoßes gegen den allgemeinen Gleichheitssatz verfassungswidrig sind. Mit den Verfassungsbeschwerden wird im Wesentlichen ebenfalls eine Verletzung des allgemeinen Gleichheitssatzes gerügt.
Wesentliche Erwägungen des Senats:
I. Die Regelungen des Bewertungsgesetzes zur Einheitsbewertung von Grundvermögen sind mit dem allgemeinen Gleichheitssatz unvereinbar. Art. 3 Abs. 1 GG lässt dem Gesetzgeber bei der Ausgestaltung von Bewertungsvorschriften für die steuerliche Bemessungsgrundlage einen weiten Spielraum, verlangt aber ein in der Relation der Wirtschaftsgüter zueinander realitätsgerechtes Bewertungssystem. Das Festhalten des Gesetzgebers an dem Hauptfeststellungszeitpunkt von 1964 führt zu gravierenden und umfassenden Ungleichbehandlungen bei der Bewertung von Grundvermögen, für die es keine ausreichende Rechtfertigung gibt.
1. Die in der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts entwickelten Grundsätze zur Anwendung des allgemeinen Gleichheitssatzes im Steuerrecht verlangen auch auf der Ebene der Ermittlung der Besteuerungsgrundlagen eine gleichheitsgerechte Ausgestaltung der Wertbemessung. Gleichheitsrechtlicher Ausgangspunkt im Steuerrecht ist der Grundsatz der Lastengleichheit. Die Steuerpflichtigen müssen dem Grundsatz nach durch ein Steuergesetz rechtlich und tatsächlich gleichmäßig belastet werden. Der Gleichheitssatz belässt dem Gesetzgeber einen weit reichenden Entscheidungsspielraum sowohl bei der Auswahl des Steuergegenstandes als auch bei der Bestimmung des Steuersatzes. Abweichungen von der mit der Wahl des Steuergegenstandes einmal getroffenen Belastungsentscheidung müssen sich indessen ihrerseits am Gleichheitssatz messen lassen. Demgemäß bedürfen sie eines besonderen sachlichen Grundes, der die Ungleichbehandlung zu rechtfertigen vermag. Dabei steigen die Anforderungen an den Rechtfertigungsgrund mit dem Ausmaß der Abweichung und ihrer Bedeutung für die Verteilung der Steuerlast insgesamt.
2. Die Aussetzung einer erneuten Hauptfeststellung der Einheitsbewertung über einen langen Zeitraum führt systembedingt in erheblichem Umfang zu Ungleichbehandlungen durch ungleiche Bewertungsergebnisse. Infolge der Anknüpfung an die Wertverhältnisse zum 1. Januar 1964 spiegeln sich die wertverzerrenden Auswirkungen des überlangen Hauptfeststellungszeitraums in den einzelnen Bewertungselementen sowohl des Ertragswert- als auch des Sachwertverfahrens wider.
Das System der Einheitsbewertung für Grundbesitz ist davon geprägt, dass in regelmäßigen Zeitabständen eine allgemeine Wertfeststellung (Hauptfeststellung) stattfindet. Diese Hauptfeststellung soll gemäß § 21 Abs. 1 BewG alle sechs Jahre für bebaute und unbebaute Grundstücke erfolgen. Ziel der Bewertungsregeln ist es, Einheitswerte zu ermitteln, die dem Verkehrswert der Grundstücke zumindest nahekommen. Der Verkehrswert ist in diesem System die Bezugsgröße, an der sich die Ergebnisse der Einheitsbewertung im Hinblick auf Art und Umfang etwaiger Abweichungen zur Beurteilung einer gleichheitsgerechten Besteuerung messen lassen müssen.
Der Gesetzgeber hat den Zyklus der periodischen Wiederholung von Hauptfeststellungen, nachdem er ihn erst 1965 wieder aufgenommen hatte, nach der darin auf den 1. Januar 1964 bezogenen Hauptfeststellung ausgesetzt und seither nicht mehr aufgenommen. 1970 wurde per Gesetz angeordnet, dass der Zeitpunkt der auf die Hauptfeststellung 1964 folgenden nächsten Hauptfeststellung der Einheitswerte des Grundbesitzes durch besonderes Gesetz bestimmt wird. Ein solches Gesetz ist bis heute nicht verabschiedet worden. Die seither andauernde Aussetzung der erforderlichen Hauptfeststellung führt in zunehmendem Maße zu Wertverzerrungen innerhalb des Grundvermögens. Das ergibt sich als zwangsläufige Folge aus dem geltenden Bewertungssystem.
Die im Gesetz vorgesehene periodische Wiederholung der Hauptfeststellung ist zentral für das vom Gesetzgeber selbst so gestaltete Bewertungssystem. Ihm liegt der Gedanke zugrunde, dass die den Verkehrswert der Grundstücke bestimmenden Verhältnisse einheitlich zum Zeitpunkt der Hauptfeststellung möglichst realitätsnah abgebildet werden. Da diese Verhältnisse während der folgenden Jahre eines Hauptfeststellungszeitraums typischerweise verkehrswertrelevanten Veränderungen unterliegen, bedarf es in regelmäßigen und nicht zu weit auseinanderliegenden Abständen einer neuen Hauptfeststellung.
Je länger ein Hauptfeststellungszeitraum über die ursprünglich vorgesehenen sechs Jahre hinaus andauert, desto größer im Einzelfall und umfangreicher in der Gesamtzahl werden zwangsläufig die Abweichungen zwischen dem tatsächlichen Verkehrswert und den auf den Hauptfeststellungszeitpunkt bezogenen Einheitswerten der Grundstücke.
Eine Auseinanderentwicklung zwischen Verkehrswert und festgestelltem Einheitswert ist für sich genommen allerdings verfassungsrechtlich nicht bedenklich. Würden die Einheitswerte in allen Fällen gleichmäßig hinter steigenden Verkehrswerten zurückbleiben, führte dies allein zu keiner verfassungsrechtlich relevanten Ungleichbehandlung, da das Niveau der Einheitswerte untereinander in Relation zum Verkehrswert gleich bliebe. Es gibt indes keine Anhaltspunkte dafür, dass die durch den Verzicht auf regelmäßige Hauptfeststellungen zwangsläufig in zunehmenden Maß auftretenden Wertverzerrungen sich in einer gleichmäßigen Relation zum Verkehrswert bewegten.
3. Die aus der Überdehnung des Hauptfeststellungszeitraums folgenden flächendeckenden, zahlreichen und erheblichen Wertverzerrungen bei der Einheitsbewertung des Grundvermögens führen zu entsprechenden Ungleichbehandlungen bei der Erhebung der Grundsteuer; die Vereinbarkeit dieser Ungleichbehandlungen mit Art. 3 Abs. 1 GG richtet sich aufgrund des Ausmaßes der Verzerrungen nach strengen Gleichheitsanforderungen. Eine ausreichende Rechtfertigung für diese Ungleichbehandlungen ergibt sich weder allgemein aus dem Ziel der Vermeidung allzu großen Verwaltungsaufwands, noch aus Gründen der Typisierung und Pauschalierung.
a) Der Verzicht auf neue Hauptfeststellungen dient der Vermeidung eines besonderen Verwaltungsaufwands. Hierfür steht dem Gesetzgeber zwar ein erheblicher Gestaltungsspielraum zur Verfügung. Dieser deckt aber nicht die Inkaufnahme eines dysfunktionalen Bewertungssystems.
Das Ziel der Verwaltungsvereinfachung rechtfertigt die durch die andauernde Aussetzung des Hauptfeststellungszeitpunkts verursachten Wertverzerrungen nicht, selbst wenn man die damit erzielte Entlastungswirkung als besonders hoch einschätzt. Der Verzicht auf regelmäßige Hauptfeststellungen in wiederkehrenden Abständen von sechs Jahren ist nicht das Ergebnis einer bewussten Vereinfachungsentscheidung des Gesetzgebers, die Elemente der Einheitsbewertung im Sinne einer Verschlankung korrigiert und dabei auch Einbußen an Detailgenauigkeit in Kauf nimmt. Mit diesem Verzicht bricht der Gesetzgeber vielmehr ein zentrales Element aus dem System der Einheitsbewertung heraus, das unverzichtbar zur Gewinnung in ihrer Relation realitätsnaher Bewertungen ist. Erweist sich eine gesetzliche Regelung als in substanziellem Umfang grundsätzlich gleichheitswidrig, können weder ein Höchstmaß an Verwaltungsvereinfachung noch die durch eine solche Vereinfachung weitaus bessere Kosten-/Nutzenrelation zwischen Erhebungsaufwand und Steueraufkommen dies auf Dauer rechtfertigen. Die Erkenntnis, eine in einem Steuergesetz strukturell angelegte Ungleichbehandlung könne nicht mit vertretbarem Verwaltungsaufwand beseitigt werden, darf nicht zur Tolerierung des verfassungswidrigen Zustands führen. Es ist unerheblich, ob der Gesetzgeber mit der Aussetzung der Hauptfeststellung dieses Defizit bewusst in Kauf genommen oder ob er es lediglich nicht erkannt hat. Entscheidend ist die objektive Dysfunktionalität der verbleibenden Regelung. Danach kommt es auch nicht darauf an, ob das Unterlassen der Bestimmung eines neuen Hauptfeststellungszeitpunkts lediglich als dauerhaftes Zuwarten innerhalb des Systems periodischer Hauptfeststellungen zu verstehen ist oder als konkludenter Ausdruck eines endgültigen Verzichts auf weitere Hauptfeststellungen überhaupt.
b) Gründe der Typisierung und Pauschalierung rechtfertigen ebenfalls nicht die Aussetzung der Hauptfeststellung und ihre Folgen. Zwar darf der Steuergesetzgeber aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung typisieren und dabei die Besonderheiten des einzelnen Falles vernachlässigen, wenn die daraus erwachsenden Vorteile im rechten Verhältnis zu der mit der Typisierung notwendig verbundenen Ungleichheit der steuerlichen Belastung stehen, er sich realitätsgerecht am typischen Fall orientiert und ein vernünftiger, einleuchtender Grund vorhanden ist. Diesen Voraussetzungen genügen im gegenwärtigen System der Einheitsbewertung entstehende Wertverzerrungen aber nicht. Es orientiert sich mit dem Verzicht auf weitere Hauptfeststellungen nicht realitätsgerecht am typischen Fall. Die Wertverzerrungen sind keineswegs auf atypische Sonderfälle oder vernachlässigbare Korrekturen in Randbereichen beschränkt. Sie betreffen vielmehr die Wertfeststellung im Kern, sind in weiten Bereichen zum Regelfall geworden und nehmen mit der fortschreitenden Dauer des Hauptfeststellungszeitraums an Zahl und Ausmaß zu.
c) Weder eine gemessen am Verkehrswert generelle Unterbewertung des Grundvermögens noch die vermeintlich absolut geringe Belastungswirkung der Grundsteuer vermögen die Wertverzerrungen zu rechtfertigen. Es ist für die verfassungsrechtliche Beurteilung von Gleichheitsverstößen in der Einheitsbewertung grundsätzlich auch ohne Belang, dass sie mittlerweile wegen ihrer weitgehenden Begrenzung auf das Recht der Grundsteuer wesentlich an allgemeiner Bedeutung verloren hat. Es handelt sich bei der Grundsteuer auch in der Sache nicht um eine Steuer im vernachlässigbaren Größenbereich. Dagegen spricht schon das Gesamtaufkommen der Grundsteuer, das in den letzten Jahren kontinuierlich von 12 auf zuletzt knapp 14 Milliarden Euro angestiegen ist, und ihre erhebliche Bedeutung für die Kommunen. Vor allem ist die Grundsteuer angesichts der heute üblichen Höhe der kommunalen Hebesätze für viele Steuerpflichtige vielfach keineswegs unbedeutend, zumal sie jährlich und zeitlich unbegrenzt anfällt. Die Wertverzerrungen können entgegen der Auffassung der Bundesregierung und einiger Ländervertreter schließlich auch nicht durch Nachfeststellungen oder Wertfortschreibungen und auch nicht durch Anpassungen der Grundsteuerhöhe über die Hebesätze verfassungsrechtlich kompensiert werden.
II. Der Senat hat die Fortgeltung der für verfassungswidrig befundenen Normen in zwei Schritten angeordnet. Zum einen gelten sie für die in der Vergangenheit festgestellten Einheitswerte und die darauf beruhende Erhebung von Grundsteuer und darüber hinaus in der Zukunft zunächst bis zum 31. Dezember 2019. Bis zu diesem Zeitpunkt hat der Gesetzgeber eine Neuregelung zu treffen. Ohne diese Fortgeltungsanordnung hätte ein enormer Verwaltungsaufwand gedroht, wenn noch nicht bestandskräftige Einheitswertbescheide – und in deren Folge auch die darauf beruhenden Grundsteuerbescheide - in einer angesichts der großen Zahl von Grundsteuerschuldnern aller Voraussicht nach erheblichen Größenordnung aufgehoben oder geändert und zumindest zum Teil rückabgewickelt werden müssten. Die Probleme wären dadurch verschärft worden, dass die Aufarbeitung dieser Fälle erst nach Inkrafttreten und Umsetzung der Neuregelung auf der Bewertungsebene und damit erst viele Jahre nach Verkündung dieses Urteils hätte erfolgen können. Für die Zukunft bestünde angesichts der erheblichen finanziellen Bedeutung der Grundsteuer für die Kommunen die ernsthafte Gefahr, dass viele Gemeinden ohne die Einnahmen aus der Grundsteuer in gravierende Haushaltsprobleme gerieten. Die Hinnahme des Vollzugs solcher Einheitswertbescheide ist den Betroffenen auch deshalb zumutbar, weil die Belastung mit einer Grundsteuer dem Grunde nach durch die Verfassung legitimiert, traditionell „schon immer“ vorgesehen und deshalb von den Grundbesitzern auch zu erwarten war und ist. Sobald der Gesetzgeber eine Neuregelung getroffen hat, gelten die beanstandeten Bewertungsregeln noch für weitere fünf Jahre fort, aber nicht länger als bis zum 31. Dezember 2024. Die ungewöhnliche Anordnung der Fortgeltung nach der Verkündung der Neuregelung ist durch die besonderen Sachgesetzlichkeiten der Grundsteuer geboten und von daher ausnahmsweise gerechtfertigt. Zur bundesweiten Neubewertung aller Grundstücke bedarf es eines außergewöhnlichen Umsetzungsaufwandes im Hinblick auf Zeit und Personal. Vor diesem Hintergrund hält der Senat die Fortgeltung der alten Rechtslage für weitere fünf Jahre geboten aber auch ausreichend, um im Falle einer Neuregelung die dadurch geschaffenen Bewertungsbestimmungen umzusetzen und so während dieser Zeit die ansonsten drohenden gravierenden Haushaltsprobleme zu vermeiden. Für Kalenderjahre ab 2025 hat der Senat Belastungen mit Grundsteuer allein auf der Basis bestandskräftiger Einheitswert- oder Grundsteuermessbescheide aus vorausgegangenen Jahren ausgeschlossen.
Erfolglose Verfassungsbeschwerde gegen Gewerbesteuerpflicht für Gewinne aus Veräußerung von Anteilen an einer Mitunternehmerschaft
Pressemitteilung Nr. 20/2018 vom 10. April 2018
Urteil vom 10. April 2018 - 1 BvR 1236/11
Die Einführung der Gewerbesteuerpflicht für Gewinne aus der Veräußerung von Anteilen an einer Mitunternehmerschaft durch § 7 Satz 2 Nr. 2 GewStG im Juli 2002 verstößt nicht gegen Art. 3 Abs. 1 GG. Dass die Personengesellschaft als Mitunternehmerschaft dabei die Gewerbesteuer schuldet, obwohl der Gewinn aus der Veräußerung des Mitunternehmeranteils beim veräußernden Gesellschafter verbleibt, verletzt das Leistungsfähigkeitsprinzip nicht. Auch das rückwirkende Inkraftsetzen der Vorschrift für den Erhebungszeitraum 2002 steht im Einklang mit der Verfassung. Dies hat der Erste Senat des Bundesverfassungsgerichts mit heute veröffentlichtem Urteil entschieden und die Verfassungsbeschwerde einer Kommanditgesellschaft zurückgewiesen, die für die bei den Veräußerern verbliebenen Gewinne aus dem Verkauf ihrer Kommanditanteile Gewerbesteuer zu entrichten hatte.
Sachverhalt:
1. Die Gewerbesteuer wird auf die objektive Ertragskraft eines Gewerbebetriebes erhoben. Anders als bei der Einkommensteuer können Schuldner der Gewerbesteuer neben natürlichen und juristischen Personen auch Personengesellschaften sein. Die Gewerbesteuer, die der Gewerbeertrag einer Kapitalgesellschaft auslöst, ist von der Kapitalgesellschaft geschuldet. Bei Personengesellschaften und Einzelunternehmern begann die Gewerbesteuerpflicht nach früherer gefestigter Rechtsprechung grundsätzlich erst mit Aufnahme der werbenden „aktiven“ Tätigkeit und endete mit deren Aufgabe. Aus diesem Grund unterlagen bei Personengesellschaften und Einzelunternehmern Gewinne aus der Veräußerung des Gewerbebetriebs oder eines Teilbetriebs oder von Anteilen an einer Mitunternehmerschaft bis zur Einführung des § 7 Satz 2 GewStG grundsätzlich nicht der Gewerbesteuer. Bei Kapitalgesellschaften unterlagen und unterliegen dagegen grundsätzlich sämtliche Gewinne der Gewerbesteuer. Allerdings ging die Rechtsprechung ungeachtet der gesetzlichen Fiktion des § 2 Abs. 2 Satz 1 GewStG davon aus, dass die Gewinne aus der Veräußerung von Anteilen an Personengesellschaften auch bei Kapitalgesellschaften, die ihre Anteile daran veräußern, nicht der Gewerbesteuer unterliegen. Durch die Einführung des § 7 Satz 2 GewStG hat der Gesetzgeber diese Rechtslage für Mitunternehmerschaften beendet und bei ihnen auch die Gewinne aus der Veräußerung ihres Betriebs, eines Teilbetriebs oder von Anteilen eines Gesellschafters weitgehend der Gewerbesteuer unterworfen. Die Einführung von § 7 Satz 2 GewStG sollte die Gefahr von Missbrauch beseitigen, die nach damaliger Rechtslage durch einkommen- und körperschaftsteuerliche Gestaltungsmöglichkeiten entstand.
2. Die Beschwerdeführerin ist ein weltweit agierendes Unternehmen im Braugewerbe. Sie ist eine Kommanditgesellschaft, deren Komplementärin in den entscheidungserheblichen Jahren 2001 und 2002 eine Offene Handelsgesellschaft war. Gesellschafterinnen der Offenen Handelsgesellschaft waren zwei Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbH). Kommanditisten der Beschwerdeführerin waren neben zwei weiteren GmbH eine Stiftung, vier Kommanditgesellschaften, und natürliche Personen. Mit Ausnahme einer GmbH veräußerten alle an der Beschwerdeführerin beteiligten Kommanditisten in den Jahren 2001 und 2002 ihre Kommanditanteile. Um dies vorzubereiten, schlossen die Gesellschafter im Juli 2001 eine Gesellschaftervereinbarung. Sie beauftragten einen Lenkungsausschuss mit dem Abschluss eines Anteilsverkaufsvertrags im Namen der Gesellschafter. Im August 2001 wurde zwischen dem Lenkungsausschuss im Namen der veräußernden Kommanditisten, der Beschwerdeführerin, der Käuferin und deren Konzernmuttergesellschaft ein Kauf- und Abtretungsvertrag geschlossen. Am 1. September 2001 genehmigte eine außerordentliche Gesellschafterversammlung der Beschwerdeführerin den Vertrag und stimmte der beabsichtigten Abtretung der Kommanditanteile zum Februar 2002 zu. In ihrer Gewerbesteuererklärung 2002 erklärte die Beschwerdeführerin einen laufenden Verlust für beide Rumpfwirtschaftsjahre und Veräußerungsgewinne nach § 7 Satz 2 GewStG in Höhe von circa 663 Millionen Euro. Das Finanzamt setzte den Gewerbesteuermessbetrag auf knapp 26 Millionen Euro und die Gewerbesteuer auf knapp 107 Millionen Euro fest. Der Einspruch der Beschwerdeführerin hatte keinen Erfolg.
3. Die von der Beschwerdeführerin zum Finanzgericht erhobene Klage war nur teilweise erfolgreich. Gemäß ihrem Hilfsantrag wurde der Veräußerungsgewinn nicht in voller Höhe der Besteuerung unterworfen. Dem Vortrag der Beschwerdeführerin, § 7 Satz 2 GewStG sei wegen unzulässiger Rückwirkung und Verletzung des Gleichheitssatzes verfassungswidrig und daher der Veräußerungsgewinn nicht zu besteuern, folgte das Finanzgericht hingegen nicht. Die Revision zum Bundesfinanzhof blieb erfolglos. Hiergegen richtet sich die Verfassungsbeschwerde.
Wesentliche Erwägungen des Senats:
Die Verfassungsbeschwerde ist unbegründet. § 7 Satz 2 Nr. 2 GewStG in der Fassung vom 23. Juli 2002 verstößt weder gegen Art. 3 Abs. 1 GG noch gegen das Verbot rückwirkend belastender Gesetze. Das Urteil des Bundesfinanzhofs verletzt die Beschwerdeführerin auch nicht in ihren prozessualen grundrechtsgleichen Rechten.
I. Die von der Beschwerdeführerin als gleichheitswidrig beanstandeten Regelungen durch den von ihr mittelbar angegriffenen § 7 Satz 2 Nr. 2 GewStG sind gemessen am allgemeinen Gleichheitssatz in seiner Ausprägung für das Steuerrecht verfassungsgemäß; der Gesetzgeber bewegt sich mit dieser Neuregelung des Jahres 2002 im Rahmen seiner Gestaltungsbefugnis.
1. Art. 3 Abs. 1 GG gebietet, alle Menschen vor dem Gesetz gleich zu behandeln. Dabei ist dem Gesetzgeber nicht jede Differenzierung verwehrt. Sie bedürfen jedoch der Rechtfertigung durch Sachgründe, die dem Ziel und dem Ausmaß der Ungleichbehandlung angemessen sind. Gleichheitsrechtlicher Ausgangspunkt im Steuerrecht ist der Grundsatz der Lastengleichheit. Die Steuerpflichtigen müssen durch ein Steuergesetz rechtlich und tatsächlich gleichmäßig belastet werden. Der Gleichheitssatz belässt dem Gesetzgeber einen weit reichenden Entscheidungsspielraum sowohl bei der Auswahl des Steuergegenstandes als auch bei der Bestimmung des Steuersatzes. Abweichungen von der mit der Wahl des Steuergegenstandes einmal getroffenen Belastungsentscheidung müssen sich indessen ihrerseits am Gleichheitssatz messen lassen. Demgemäß bedürfen sie eines besonderen sachlichen Grundes, der die Ungleichbehandlung zu rechtfertigen vermag. Dabei steigen die Anforderungen an den Rechtfertigungsgrund mit dem Ausmaß der Abweichung und ihrer Bedeutung für die Verteilung der Steuerlast insgesamt. Der Grundsatz der Besteuerung nach der finanziellen Leistungsfähigkeit der Gesellschaft gilt auch für die Gewerbesteuer, da diese die objektivierte Ertragskraft der Gewerbebetriebe erfasst.
2. Der Gesetzgeber durfte ohne Verstoß gegen den Grundsatz der Besteuerung nach der Leistungsfähigkeit auch nach Einführung des § 7 Satz 2 GewStG an seiner in § 5 Abs. 1 Satz 3 GewStG zum Ausdruck kommenden Entscheidung festhalten, die Steuerschuldnerschaft der Personengesellschaft zuzuweisen. Der Gesetzgeber kann es in den Fällen des § 7 Satz 2 Nr. 2 GewStG ebenfalls bei der Gewerbesteuerschuld der Personengesellschaft belassen, obwohl der Gewinn aus der Veräußerung des Anteils beim veräußernden Gesellschafter verbleibt. Dass die Personengesellschaft hier gleichwohl die Gewerbesteuer schuldet, verletzt das Leistungsfähigkeitsprinzip im Ergebnis nicht.
Ein durchgreifender Konflikt mit dem Leistungsfähigkeitsprinzip liegt jedenfalls deshalb nicht vor, weil die mit dem Mitunternehmeranteil veräußerten Anteile an den Vermögensgegenständen durch den in die Gesellschaft einrückenden Erwerber in der Mitunternehmerschaft verbleiben und die Leistungsfähigkeit der Gesellschaft im Grundsatz unverändert erhalten. Soweit der veräußernde Mitunternehmer einen Verkaufserlös durch Aufdeckung stiller Reserven erzielt hat, übernimmt der Erwerber den entsprechend erhöhten Bilanzwert in einer Ergänzungsbilanz in der Mitunternehmerschaft. Verkauft die Gesellschaft später diese Vermögensgegenstände, wird durch die Auflösung der Ergänzungsbilanz beim eingetretenen Gesellschafter eine Doppelbesteuerung der stillen Reserven vermieden.
Im Übrigen durfte der Gesetzgeber davon ausgehen, dass die Begründung der Gewerbesteuerschuld bei der Personengesellschaft durch § 5 Abs. 1 Satz 3 GewStG auch in den Fällen des § 7 Satz 2 GewStG zu keinen unüberwindbaren Schwierigkeiten bei einer interessengerechten Verteilung der Gewerbesteuer innerhalb der Mitunternehmerschaft führt. Es ist Sache der Gesellschaft, die interne Gewinn- und Verlustverteilung auch unter Berücksichtigung anfallender Steuerpflichten zu regeln. Durch Gesellschaftsvertrag können etwaige Freistellungspflichten des die Gesellschaft verlassenden Gesellschafters im Hinblick auf Steuern vereinbart werden, die dadurch bei der Gesellschaft anfallen.
Art. 3 Abs. 1 GG wird auch nicht dadurch verletzt, dass § 7 Satz 2 Nr. 2 Halbsatz 2 GewStG den Gewinn aus der Veräußerung oder Aufgabe des Betriebsanteils eines Mitunternehmers der Gewerbesteuer unterwirft, davon aber den Veräußerungsgewinn ausnimmt, der auf natürliche Personen entfällt, die unmittelbar an der Mitunternehmerschaft beteiligt sind. Diese Regelung benachteiligt zwar Mitunternehmerschaften, soweit an ihnen Personengesellschaften und Kapitalgesellschaften beteiligt sind, gegenüber solchen mit unmittelbar beteiligten natürlichen Personen. Der hierfür hinreichend gewichtige Rechtfertigungsgrund besteht in der Verhinderung von Umgehungsgestaltungen. Der Gesetzgeber durfte bei unmittelbar beteiligten natürlichen Personen ein von vornherein geringeres Umgehungspotential als bei Kapital- und Personengesellschaften annehmen. Daneben stützen auch Erwägungen der Vereinfachung des Verwaltungsvollzugs die Besserstellung.
II. Die Beschwerdeführerin wird nicht in ihrem verfassungsrechtlich durch Art. 2 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 20 Abs. 3 GG geschützten Vertrauen verletzt, nicht von in unzulässiger Weise rückwirkenden Gesetzen belastet zu werden. Das Verbot rückwirkend belastender Gesetze schützt das Vertrauen in die Verlässlichkeit und Berechenbarkeit der Rechtsordnung.
1. Der Gesetzgeber muss, soweit er für künftige Rechtsfolgen an zurückliegende Sachverhalte innerhalb des nicht abgeschlossenen Veranlagungs- oder Erhebungszeitraums anknüpft, dem verfassungsrechtlich gebotenen Vertrauensschutz in hinreichendem Maß Rechnung tragen. Die unechte Rückwirkung ist mit den Grundsätzen des Vertrauensschutzes nur vereinbar, wenn sie zur Förderung des Gesetzeszwecks geeignet und erforderlich ist und wenn bei einer Gesamtabwägung zwischen dem Gewicht des enttäuschten Vertrauens und dem Gewicht und der Dringlichkeit der die Rechtsänderung rechtfertigenden Gründe die Grenze der Zumutbarkeit gewahrt bleibt. Vertrauen ist dann besonders schutzwürdig, wenn die Betroffenen zum Zeitpunkt der Verkündung der Neuregelung nach der alten Rechtlage eine verfestigte Erwartung auf Vermögenszuwächse erlangt und realisiert hatten oder hätten realisieren können. Das gilt vor allem dann, wenn auf der Grundlage des geltenden Rechts vor Verkündung des rückwirkenden Gesetzes bereits Leistungen zugeflossen sind. Besonders schutzwürdig ist das Vertrauen der Betroffenen zudem dann, wenn diese vor der Einbringung des neuen Gesetzes in den Bundestag verbindliche Festlegungen getroffen haben.
2. Die Anwendung des im Juli 2002 in § 7 GewStG eingefügten Satzes 2 Nr. 2 auf Veräußerungsgewinn der Beschwerdeführerin ist verfassungsrechtlich nicht zu beanstanden. Es liegt ein Fall unechter Rückwirkung vor, da die Norm mit Wirkung zum 27. Juli 2002 in das Gewerbesteuergesetz eingefügt wurde und erstmals für den Erhebungszeitraum 2002 anzuwenden war. Die Norm wirkt auf den 1. Januar 2002 zurück, weil die Gewerbesteuer erst mit Ablauf des Erhebungszeitraums entsteht. Die Rückwirkung der angegriffenen Regelung auf den Erhebungszeitraum 2002 verletzt kein schützenswertes Vertrauen der Beschwerdeführerin in den Bestand der alten Rechtslage. Denn § 7 Satz 2 GewStG in der seit dem Gesetz vom 27. Juli 2002 und auch noch heute geltenden Fassung war durch das Unternehmenssteuerfortentwicklungsgesetz mit Wirkung zum 25. Dezember 2001 schon einmal in das Gewerbesteuergesetz eingefügt worden und sollte erstmals für den Erhebungszeitraum 2002 Anwendung finden. Durch das Solidarpaktfortführungsgesetz wurde die Norm jedoch schon zum 1. Januar 2002 versehentlich wieder außer Kraft gesetzt und konnte somit zunächst keine steuerrechtliche Wirkung entfalten.
3. Das Vertrauen der Beschwerdeführerin in den Bestand des zuvor geltenden Gewerbesteuerrechts war bereits mit der Zuleitung des Entwurfs des Unternehmenssteuerfortentwicklungsgesetzes zum Bundesrat nicht mehr schutzwürdig. Die ursprünglich geplante und schließlich erst durch das Fünfte Gesetz zur Änderung des Steuerbeamten-Ausbildungsgesetzes und zur Änderung von Steuergesetzen umgesetzte Neuregelung des § 7 Satz 2 GewStG betrifft dasselbe Gesetzgebungsziel mit demselben Inhalt durch denselben Gesetzgeber. Beide Gesetzgebungsverfahren sind als Einheit zu werten. Daher kann nicht nur die Einbringung eines Gesetzesvorhabens in den Bundestag, sondern bereits dessen Zuleitung zum Bundesrat vertrauenszerstörende Wirkung haben.
a) Das Bundesverfassungsgericht hat in jüngerer Zeit bereits mehrfach entschieden, dass die Einbringung eines Gesetzentwurfs in den Deutschen Bundestag das Vertrauen der Betroffenen zerstören kann und eine Neuregelung unechte Rückwirkung entfalten darf. Ab diesem Zeitpunkt sind mögliche zukünftige Gesetzesänderungen in konkreten Umrissen absehbar. Dann können Steuerpflichtige nicht mehr darauf vertrauen, das gegenwärtig geltende Recht werde unverändert fortbestehen; es ist ihnen auch möglich, ihre wirtschaftlichen Dispositionen auf zukünftige Änderungen einzustellen.
b) Diese Erwägungen gelten in gleicher Weise für die Zuleitung eines Gesetzentwurfs durch die Bundesregierung an den Bundesrat. Die Zuleitung einer ausformulierten Gesetzesvorlage an den Bundesrat zerstört Vertrauen ebenso. Mit ihrer Veröffentlichung erhalten Betroffene ebenfalls die Möglichkeit, sich auf die etwaige Gesetzesänderung einzustellen.
Die Beschwerdeführerin musste sich jedenfalls für das Erhebungsjahr 2002 auf eine nachteilige Änderung der Gewerbebesteuerung von Anteilsveräußerungen durch ihre Mitunternehmer einstellen. Nach Zuleitung des Entwurfs eines Unternehmenssteuerfortentwicklungsgesetzes am 17. August 2001 durch die Bundesregierung an den Bundesrat konnten Mitunternehmerschaften nicht mehr darauf vertrauen, dass eine Anteilsveräußerung durch ihre Gesellschafter auch künftig noch gewerbesteuerfrei sein würde.
c) Die verbindlichen Entscheidungen über die Anteilsveräußerungen fielen zeitlich nach der Zuleitung des Entwurfs an den Bundesrat.
aa) Der Entwurf zu einem Unternehmenssteuerfortentwicklungsgesetz wurde am 17. August 2001 dem Bundesrat zugeleitet. Die Gesellschafter der Beschwerdeführerin stimmten erst am 1. September 2001 dem Kauf- und Abtretungsvertrag zu. Zu diesem Zeitpunkt war der Gesetzentwurf in einer Bundesratsdrucksache bereits veröffentlicht.
bb) Die vertrauenszerstörende Wirkung der Zuleitung des Entwurfs eines Unternehmenssteuerfortentwicklungsgesetzes beschränkt sich nicht streng auf den durch den Wortlaut des Entwurfs von § 7 Satz 2 GewStG betroffenen Kreis von Mitunternehmern. Nach dem ursprünglichen Gesetzentwurf sollte künftig der Gewinn aus der Veräußerung des Anteils eines Gesellschafters, der als Unternehmer (Mitunternehmer) anzusehen ist, der Gewerbesteuer unterfallen, „soweit er nicht auf eine natürliche Person als Mitunternehmer entfällt“. Gesetz wurde dann jedoch eine Formulierung, die lediglich den auf „eine natürliche Person als unmittelbar beteiligter Mitunternehmer“ entfallenden Gewinn gewerbesteuerfrei ließ. Angesichts der Zielsetzung des Gesetzgebers, Gewinne aus der Veräußerung von Anteilen einer Mitunternehmerschaft der Gewerbesteuer zu unterwerfen, um Umgehungsgestaltungen zu vermeiden, durften sich Mitunternehmer auch schon nach Bekanntwerden der ursprünglichen Entwurfsfassung nicht darauf verlassen, dass Veräußerungsgewinne von mittelbar beteiligten Personen verschont bleiben würden.
cc) Das rückwirkende Inkraftsetzen des § 7 Satz 2 Nr. 2 GewStG zum Beginn des Erhebungszeitraums 2002 ist mit dem Grundsatz des Vertrauensschutzes auch insoweit vereinbar, als er Veräußerungsgewinne erfasst, die zwar vor Verkündung des Gesetzes im Juli 2002 den Verkäufern zugeflossen sind, aber auf Dispositionen beruhen, die erst nach der Zuleitung des Gesetzes an den Bundesrat verbindlich getroffen wurden. Eine besonders verfestigte Vermögensposition, die einem unecht rückwirkenden Zugriff des Steuergesetzgebers entzogen wäre, besteht nicht. Gewinne aus Dispositionen, die erst vorgenommen werden, nachdem ein ordnungsgemäß in das Gesetzgebungsverfahren eingebrachter Gesetzentwurf etwaiges Vertrauen zerstört hat, hindern den Gesetzgeber nicht an einer unecht rückwirkenden Steuerbelastung, selbst wenn die Erträge vor der Verkündung des Gesetzes zugeflossen sind.
III. Die gegen das Urteil des Bundesfinanzhofs und gegen dessen Beschluss über die Anhörungsrüge erhobenen Verfahrensrügen bleiben ohne Erfolg. Das Vorbringen der Beschwerdeführerin hierzu genügt insgesamt nicht den sich aus dem Bundesverfassungsgerichtsgesetz ergebenden Begründungsanforderungen. Im Übrigen liegt es im Spielraum des Gesetzgebers, aus Gründen der Praktikabilität die Anhörungsrüge so auszugestalten, dass der darüber befindende Spruchkörper nicht personenidentisch mit dem sein muss, der die Entscheidung in der Hauptsache getroffen hat.
Einstweilige Anordnung: Stadt muss ihre Stadthalle der NPD für Wahlkampfveranstaltung überlassen
Pressemitteilung Nr. 16/2018 vom 26. März 2018
Beschluss vom 24. März 2018
1 BvQ 18/18
Die 3. Kammer des Ersten Senates des Bundesverfassungsgerichts hatte in einer heute veröffentlichten einstweiligen Anordnung vom 24. März 2018 einer Stadt aufgegeben, einer entsprechenden verwaltungsgerichtlichen Entscheidung Folge zu leisten und ihre Stadthalle dem Stadtverband der Nationaldemokratischen Partei Deutschlands (NPD) am selben Tage für die Durchführung einer Wahlkampfveranstaltung zu überlassen. Die Stadt ist dieser Anordnung nicht nachgekommen. Das Bundesverfassungsgericht hat die zuständige Kommunalaufsichtsbehörde deswegen aufgefordert, den Vorfall aufzuklären, notwendige aufsichtsrechtliche Maßnahmen zu ergreifen und das Gericht unverzüglich davon zu unterrichten. Der Ministerpräsident, der Innen- und der Justizminister des Landes sowie der Oberbürgermeister der Stadt sind über das Schreiben informiert worden.
Sachverhalt:
Die Stadt verweigerte dem Antragsteller den Zugang zur Stadthalle, da der Antragsteller den Nachweis eines Versicherungsschutzes und eines Sanitätsdienstes nicht erbracht habe, obwohl das Verwaltungsgericht die Stadt zuvor im Wege einer einstweiligen Anordnung zur Überlassung der Stadthalle verpflichtet hatte. Die hiergegen gerichtete Beschwerde der Stadt wies der Verwaltungsgerichtshof zurück. Das Verwaltungsgericht drohte der Stadt ein Zwangsgeld an, soweit diese nicht bis um 11:00 Uhr am 23. März 2018 der Verpflichtung aus der einstweiligen Anordnung desselben Gerichts nachkomme. Nachdem die Frist ohne Befolgung der Anordnung des Verwaltungsgerichts verstrichen war, setzte das Verwaltungsgericht das angedrohte Zwangsgeld fest und drohte erneut ein Zwangsgeld an, falls die Stadt bis um 17:00 Uhr am 23. März 2018 der einstweiligen Anordnung nicht nachgekommen sei. Diese Frist verstrich, ohne dass dem Antragsteller die Stadthalle für die Durchführung einer Wahlkampfveranstaltung überlassen wurde. Hiergegen wandte sich die NPD mit dem Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung und rügt eine Verletzung ihrer Rechte aus Art. 5 Abs. 1 Satz 1 GG, Art. 8 Abs. 1 GG und Art. 21 Abs. 1 Satz 1 GG.
Wesentliche Erwägungen der Kammer:
Im Verfahren des einstweiligen Rechtsschutzes nach § 32 Abs. 1 BVerfGG sind die erkennbaren Erfolgsaussichten einer Verfassungsbeschwerde gegen die verwaltungsgerichtliche Eilentscheidung vom Bundesverfassungsgericht zu berücksichtigen, wenn ein Abwarten den Grundrechtsschutz vereitelte. Hier müsste eine Verfassungsbeschwerde voraussichtlich Erfolg haben. Der Antragsteller hat zur Durchführung einer Versammlung eine vollziehbare verwaltungsgerichtliche Entscheidung erwirkt, mit der die Antragsgegnerin des Ausgangsverfahrens zur Überlassung ihrer Stadthalle verpflichtet wurde. Wegen deren Nichtbefolgung wurde gegen die Antragsgegnerin des verwaltungsgerichtlichen Verfahrens überdies bereits ein Zwangsgeld verhängt. Die Antragsgegnerin verweigert die Befolgung dieser Entscheidung mit Gründen, die sie vor den Verwaltungsgerichten entweder nicht rechtzeitig geltend gemacht hat oder die von diesen als unerheblich beurteilt wurden. Es ist absehbar, dass dies in einem Hauptsacheverfahren als Verletzung von Art. 8 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 20 Abs. 3, 19 Abs. 4 GG zu beurteilen wäre. Zugleich würden durch ein Abwarten die Durchführung der Versammlung und damit die Wahrnehmung der Versammlungsfreiheit des Antragstellers endgültig vereitelt.
Erfolgreiche Verfassungsbeschwerde wegen Verletzung der Pflicht zur Anrufung des EuGH im Wege des Vorabentscheidungsverfahrens
Pressemitteilung Nr. 3/2018 vom 11. Januar 2018
Beschluss vom 19. Dezember 2017
2 BvR
424/17
Wenn Gerichte über die Zulässigkeit eines im unionsrechtlich determinierten Rechtshilfeverkehr gestellten Auslieferungsersuchens befinden, haben sie Zweifelsfragen über die Anwendung und Auslegung von Unionsrecht dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) als gesetzlichem Richter vorzulegen. Zwar ist nicht jeder Verstoß gegen die unionsrechtliche Vorlagepflicht ein Verstoß gegen die Gewährleistung des Art. 101 Abs. 1 Satz 2 GG, aber der gesetzliche Richter ist entzogen, wenn ein Gericht bei einer unvollständigen Rechtsprechung des EuGH den ihm notwendig zukommenden Beurteilungsrahmen bei der Anwendung und Auslegung von Unionsrecht in unvertretbarer Weise überschreitet. Der EuGH hat die Frage, welche Mindestanforderungen Art. 4 der Grundrechtecharta der Europäischen Union (GRCh) an Haftbedingungen konkret stellt und nach welchen Maßstäben Haftbedingungen unionsrechtlich zu bewerten sind, bislang nicht abschließend geklärt. Eine unvertretbare Überschreitung des fachgerichtlichen Beurteilungsrahmens liegt in einer solchen Konstellation jedenfalls vor, wenn das Gericht die mit Blick auf Art. 52 Abs. 3 GRCh einzubeziehende Rechtsprechung des EGMR lediglich selektiv auswertet, ihr weitere Gesichtspunkte hinzufügt und so das Unionsrecht eigenständig fortbildet. Mit dieser Begründung hat der Zweite Senat des Bundesverfassungsgerichts mit heute veröffentlichtem Beschluss einer Verfassungsbeschwerde gegen die Beschlüsse des Hanseatischen Oberlandesgerichts stattgegeben, mit denen dieses die Auslieferung des Beschwerdeführers nach Rumänien für zulässig erklärt hatte, und die Sache zurückverwiesen. Über die Frage, ob die Beschlüsse, wie durch den Beschwerdeführer gerügt, vor dem Hintergrund der Haftbedingungen in rumänischen Justizvollzugsanstalten einen Verstoß gegen die Garantie der Menschenwürde aus Artikel 1 Abs. 1 GG darstellen, war daher zum derzeitigen Verfahrensstand nicht zu entscheiden.
Sachverhalt:
Gegen den Beschwerdeführer besteht ein Europäischer Haftbefehl, dem ein nationaler Haftbefehl eines Gerichts in Rumänien wegen des Verdachts der Begehung von Vermögens- und Urkundsdelikten in drei Fällen zugrunde liegt. Der Beschwerdeführer verbüßte wegen in Deutschland begangener Straftaten bis zum 24. September 2017 eine Freiheitsstrafe in Hamburg. Seither befindet er sich in Auslieferungshaft. Mit den angegriffenen Beschlüssen vom 3. Januar 2017 und 19. Januar 2017 erklärte das Oberlandesgericht die Auslieferung des Beschwerdeführers nach Rumänien für zulässig. Zur Begründung führte es insbesondere aus, nach der Rechtsprechung des EuGH sei klargestellt, dass die Mitgliedstaaten zur Vollstreckung eines Europäischen Haftbefehls verpflichtet seien. Eine Ausnahme hiervon sei nur unter außergewöhnlichen Umständen anzunehmen. Im Rahmen der vom EuGH geforderten zweistufigen Prüfung erkenne der Senat zwar substantiierten Anhalt für das Vorliegen von systemischen Mängeln im rumänischen Strafvollzug. Die zweite Voraussetzung, eine „echte Gefahr“ unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung für den Beschwerdeführer, liege jedoch nicht vor. Insbesondere hätten die rumänischen Behörden zugesichert, dass dem Beschwerdeführer ein minimaler persönlicher Raum einschließlich der Möbel von 3 m² bei Vollstreckung in einem geschlossenen Regime und von 2 m² im halboffenen oder offenen Regime zur Verfügung stehen werde. Es sei mit Blick auf die Funktionsfähigkeit der Strafrechtspflege innerhalb der Europäischen Union zu bedenken, dass die in Rumänien begangenen Straftaten ungesühnt blieben, wenn die Bundesrepublik Deutschland die Auslieferung ablehne. Auch drohe die Schaffung eines „safe haven“ in Deutschland. Trotz der Verurteilungen Rumäniens durch den EGMR wegen Verstoßes gegen Art. 3 EMRK halte der Senat eine Gesamtbetrachtung der Haftsituation in Rumänien für angezeigt, bei der allerdings der Haftraumgröße wesentliche indizielle Bedeutung zukomme. Seit 2014 hätten sich die Haftbedingungen in Rumänien durchgreifend verbessert, auch wenn die Überbelegungsquote immer noch bedenklich hoch sei und die von den rumänischen Behörden zugesicherte individuelle Haftraumgröße bei alleiniger Betrachtung der Quadratmeterzahl bei einer Vollstreckung jedenfalls in einem der offenen Vollzugsregime hinter den Maßgaben des EGMR zurückzubleiben scheine. Es sei allerdings auch zu berücksichtigen, dass die zum Teil insuffizienten Platzverhältnisse in der Zelle durch sehr weitgehende Aufschlusszeiten erheblich abgemildert würden. Überdies seien die baulichen Voraussetzungen für Freigänge geschaffen worden; ferner seien - neben der Verbesserung der baulichen Anlagen im Hinblick auf Heizung, sanitäre Anlagen und Hygiene - die Möglichkeiten für Hafturlaube, den Empfang von Besuch, das Waschen privater Wäsche und den Einkauf persönlicher Dinge verbessert worden.
Wesentliche Erwägungen des Senats:
Die Verfassungsbeschwerde ist zulässig und begründet. Insbesondere hat der Beschwerdeführer unter Zugrundelegung der erhöhten Zulässigkeitsvoraussetzungen, die an eine auf eine Identitätskontrolle gerichtete Verfassungsbeschwerde zu stellen sind, substantiiert dargelegt, dass und warum eine Verletzung der Menschenwürdegarantie durch die im Zielstaat konkret in Aussicht stehenden Haftbedingungen möglich erscheint.
Die angegriffenen Entscheidungen verletzen das grundrechtsgleiche Recht des Beschwerdeführers auf den gesetzlichen Richter (Art. 101 Abs. 1 Satz 2 GG). Der Beschwerdeführer hat einen solchen Verfassungsverstoß zwar nicht ausdrücklich gerügt, dies hindert das Bundesverfassungsgericht jedoch nicht, im Rahmen einer zulässigen Verfassungsbeschwerde seine Prüfung hierauf zu erstrecken.
Bei Zweifelsfragen über die Anwendung und Auslegung von Unionsrecht haben die Fachgerichte diese nach Art. 267 Abs. 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) zunächst dem EuGH vorzulegen. Dieser ist gesetzlicher Richter. Jedoch stellt nicht jede Verletzung der unionsrechtlichen Vorlagepflicht zugleich einen Verstoß gegen Art. 101 Abs. 1 Satz 2 GG dar. Das Bundesverfassungsgericht überprüft nur, ob die Auslegung und Anwendung der Zuständigkeitsregel des Art. 267 Abs. 3 AEUV bei verständiger Würdigung der das Grundgesetz bestimmenden Gedanken nicht mehr verständlich erscheint und offensichtlich unhaltbar ist. Dies ist unter anderem der Fall, wenn ein letztinstanzliches Hauptsachegericht - wie hier - im Falle einer unvollständigen EuGH-Rechtsprechung den ihm in solchen Fällen notwendig zukommenden Beurteilungsrahmen in unvertretbarer Weise überschreitet. Dabei muss sich das Fachgericht hinsichtlich des materiellen Unionsrechts hinreichend kundig machen. Etwaige einschlägige Rechtsprechung des EuGH muss es auswerten und seine Entscheidung hieran orientieren. Auf dieser Grundlage muss das Fachgericht unter Anwendung und Auslegung des materiellen Unionsrechts die vertretbare Überzeugung bilden, dass die Rechtslage entweder von vornherein eindeutig („acte clair“) oder durch Rechtsprechung in einer Weise geklärt ist, die keinen vernünftigen Zweifel offenlässt („acte éclairé“).
Das Oberlandesgericht hat angesichts einer unvollständigen Rechtsprechung des EuGH mit der Nichtvorlage seinen Beurteilungsspielraum in unvertretbarer Weise überschritten. Zwar hat der EuGH in den Rechtssachen Aranyosi und Căldăraru mit Urteil vom 5. April 2016 klargestellt, dass die Vollstreckung eines Europäischen Haftbefehls nicht zu einer unmenschlichen oder erniedrigenden Behandlung der betroffenen Person im Zielstaat führen dürfe. Daher bestehe eine Verpflichtung der vollstreckenden Justizbehörden, bei Vorliegen von Anhaltspunkten für systemische Mängel im Strafvollzug des Zielstaats zu prüfen, ob es unter den konkreten Umständen ernsthafte und durch Tatsachen bestätigte Gründe für die Annahme gebe, die betroffene Person werde im Anschluss an ihre Übergabe der echten Gefahr unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung in diesem Mitgliedstaat ausgesetzt sein. Der Gerichtshof hat jedoch die hier entscheidungserhebliche Frage, welche Mindestanforderungen an Haftbedingungen aus Art. 4 GRCh konkret erwachsen und nach welchen Maßstäben Haftbedingungen unionsgrundrechtlich zu bewerten sind, bisher nicht abschließend geklärt.
Das Oberlandesgericht hat den ihm zukommenden Beurteilungsrahmen im Hinblick auf seine Vorlagepflicht in unvertretbarer Weise überschritten und dadurch den Beschwerdeführer in seinem Recht auf den gesetzlichen Richter verletzt. Es stellt in den angegriffenen Entscheidungen grundrechtliche, unionsrechtliche und konventionsrechtliche Prüfungsmaßstäbe nebeneinander, ohne einen Zusammenhang mit den spezifischen Anforderungen von Art. 4 GRCh herzustellen. Ob und warum die sich aus Art. 4 GRCh ergebenden Mindestanforderungen an Haftbedingungen durch den EuGH abschließend geklärt oder so eindeutig sind, dass es einer Klärung durch den EuGH nicht bedarf, wird nicht begründet. Das Oberlandesgericht hat sich zwar an die vom EuGH vorgegebene Struktur einer zweistufigen Prüfung gehalten. Hinsichtlich der vorliegend auf der zweiten Stufe zu prüfenden echten Gefahr einer unmenschlichen oder erniedrigenden Behandlung des Beschwerdeführers im Sinne von Art. 4 GRCh hat es auch erkannt, dass die von Rumänien im Fall des Beschwerdeführers abgegebenen Zusicherungen hinter den räumlichen Anforderungen, die der EGMR an einen gemäß Art. 3 EMRK konventionsrechtskonformen Strafvollzug stellt, zurückbleiben. Es hat eine unionsrechtlich relevante Gefahr unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung durch die mangelhaften Haftbedingungen dennoch verneint. Dabei hat das Oberlandesgericht die Rechtsprechung des EGMR lediglich selektiv zugrunde gelegt und ihr im Rahmen einer „Gesamtbetrachtung“ weitere Gesichtspunkte hinzugefügt, die seiner Ansicht nach geeignet sind, die Gefahr einer unmenschlichen oder erniedrigenden Behandlung des Beschwerdeführers zu widerlegen. Nach der Rechtsprechung des EGMR folgt aus einer Unterschreitung des persönlichen Raums von 3 m² pro Gefangenem in einem Gemeinschaftshaftraum die starke Vermutung einer Verletzung von Art. 3 EMRK. Diese kann normalerweise nur widerlegt werden, wenn es sich lediglich um eine kurze, gelegentliche und unerhebliche Reduzierung des persönlichen Raums handelt, ausreichende Bewegungsfreiheit und Aktivitäten außerhalb des Haftraums gewährleistet sind und die Strafe in einer geeigneten Haftanstalt vollzogen wird, wobei es keine die Haft erschwerenden Bedingungen geben darf. Es deutet vieles darauf hin, dass die drei genannten Faktoren kumulativ vorliegen müssen, um das Unterschreiten eines persönlichen Raums von 3 m² aufzuwiegen. Das Oberlandesgericht problematisiert in den angegriffenen Beschlüssen schon nicht, ob die durch Rumänien zugesicherten 2 m² persönlicher Raum, die im offenen und halboffenen Regime in einem mehrfachbelegten Haftraum auf den Beschwerdeführer entfallen würden, angesichts der deutlichen Unterschreitung der 3 m² noch eine unerhebliche (sowie kurze und gelegentliche) Reduzierung des persönlichen Raums darstellen würden. Darüber hinaus zieht das Oberlandesgericht im Rahmen einer Gesamtbetrachtung mit dem Verweis auf verbesserte Heizungsanlagen, sanitäre Anlagen und Hygienebedingungen Umstände heran, die vom EGMR zwar als kompensatorische Faktoren angesehen werden, von denen aber unklar ist, inwieweit sie nach seiner neueren Rechtsprechung die starke Vermutung eines Konventionsverstoßes durch räumliche Beengtheit entkräften können, zumal Mängel der sanitären und Heizungsanlagen sowie der Hygienebedingungen selbst dann zu einer Verletzung von Art. 3 EMRK führen können, wenn mehr als 3 m² persönlicher Raum auf einen Gefangenen entfallen.
Indem das Oberlandesgericht ausführt, es gebe im rumänischen Strafvollzug verbesserte Möglichkeiten für Hafturlaube, den Empfang von Besuch, das Waschen privater Wäsche und den Einkauf persönlicher Dinge, stellt es zudem auf Umstände ab, die in der Rechtsprechung des EGMR für das Entkräften einer indizierten Verletzung des Art. 3 EMRK aufgrund zu beengter räumlicher Verhältnisse bisher nicht explizit herangezogen worden sind. Über die Rechtsprechung des EGMR hinaus bezieht das Oberlandesgericht in den angegriffenen Entscheidungen schließlich auch Gesichtspunkte wie die Aufrechterhaltung des zwischenstaatlichen Rechtshilfeverkehrs, die Funktionsfähigkeit der Strafrechtspflege innerhalb der Europäischen Union sowie die Grundsätze der gegenseitigen Anerkennung und des gegenseitigen Vertrauens, die potentielle Straflosigkeit mutmaßlicher Straftäter bei Nichtauslieferung und die Schaffung eines „safe haven“ als entscheidungserhebliche Belange in die Prüfung ein. Einige dieser Gesichtspunkte sind in der Rechtsprechung des EuGH zwar im Rahmen der Auslegung der mitgliedstaatlichen Pflichten, die aus dem Rahmenbeschluss über den Europäischen Haftbefehl folgen, herangezogen worden. Die Frage, ob sie für die Bestimmung des Gewährleistungsumfangs von Art. 4 GRCh beziehungsweise Art. 3 EMRK angesichts deren absoluten Charakters überhaupt eine Rolle spielen können, ist bisher aber weder in der Rechtsprechung des EuGH noch des EGMR beantwortet worden.
Gerichtliche Sachaufklärungspflicht bei Hinweisen auf Foltergefahr in Abschiebungsfällen
Pressemitteilung Nr. 1/2018 vom 9. Januar 2018
Beschluss vom 18. Dezember 2017
2 BvR
2259/17
Gerichte verletzen das in Art. 19 Abs. 4 Satz 1 GG gewährleistete Grundrecht auf effektiven Rechtsschutz, wenn sie trotz gewichtiger Anhaltspunkte nicht aufklären, ob einem Betroffenen im Falle der Abschiebung Folter oder unmenschliche Haftbedingungen drohen. Es ist verfassungsrechtlich geboten, dass sich die zuständigen Behörden und Gerichte vor einer Rückführung in den Zielstaat über die dortigen Verhältnisse informieren und vor einer Abschiebung gegebenenfalls geeignete Zusicherungen der zuständigen Behörden einholen, die Folter und unmenschliche Behandlung wirksam ausschließen. Dies hat die 1. Kammer des Zweiten Senats des Bundesverfassungsgerichts mit heute veröffentlichtem Beschluss unter teilweiser Stattgabe der Verfassungsbeschwerde eines wegen Unterstützung einer terroristischen Vereinigung verurteilten türkischen Staatsangehörigen entschieden und den Rechtsstreit zur weiteren Sachaufklärung an das Verwaltungsgericht zurückverwiesen.
Sachverhalt:
Der in Deutschland geborene und aufgewachsene Beschwerdeführer ist türkischer Staatsangehöriger. Er wurde durch das Kammergericht Berlin im Jahr 2015 unter anderem wegen Unterstützung einer terroristischen Vereinigung im Ausland zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von drei Jahren und sechs Monaten verurteilt, weil er sich salafistischen Kreisen angeschlossen und in Syrien der terroristischen Vereinigung Junud al-Sham erhebliche Geld- und Sachleistungen überlassen hatte. Die Ausländerbehörde wies den Beschwerdeführer im Juni 2016 aus der Bundesrepublik aus, drohte die Abschiebung in die Türkei an. Den Eilantrag des Beschwerdeführers lehnte das Verwaltungsgericht ab; die Beschwerde zum Verwaltungsgerichtshof blieb erfolglos. Zusätzlich stellte der Beschwerdeführer im August 2017 einen Asylantrag, der als offensichtlich unbegründet abgelehnt wurde. Hiergegen begehrte der Beschwerdeführer Eilrechtsschutz und trug vor, gegen ihn sei in der Türkei ein Strafverfahren wegen Unterstützung des islamistischen Terrorismus anhängig, und es drohe ihm Folter. Er legte zur Begründung seines Antrags ein Schreiben von amnesty international vor, wonach die deutsche Sektion Ende Juli 2017 von dem Vater eines in der Türkei als Terrorverdächtiger inhaftierten türkischen Staatsangehörigen Hinweise darauf erhalten habe, dass sein Sohn seit einiger Zeit zusammen mit den Mitgefangenen schwer geschlagen und gefoltert werde; jede ärztliche Versorgung werde den Gefangenen verweigert, die in Zellen voller menschlicher Fäkalien untergebracht seien. Das Verwaltungsgericht lehnte den Eilantrag mit Beschluss vom 21. September 2017 ab. Wie der Verwaltungsgerichtshof im ausweisungsrechtlichen Verfahren zu Recht festgestellt habe, drohe lediglich Angehörigen der kurdischen PKK oder der Gülen-Bewegung Folter. An Anhaltspunkten für eine beachtliche Gefahr von Folter oder menschenrechtswidriger Behandlung im Falle des Beschwerdeführers fehle es jedoch.
Wesentliche Erwägungen der Kammer:
Die mit der Verfassungsbeschwerde angegriffene Entscheidung vom 21. September 2017 verletzt den Beschwerdeführer in seinem Grundrecht aus Artikel 19 Absatz 4 Satz 1 in Verbindung mit Artikel 2 Absatz 2 Satz 1 GG.
1. Das Gebot effektiven Rechtsschutzes des Art. 19 Abs. 4 Satz 1 GG verlangt nicht nur, dass jeder potenziell rechtsverletzende Akt der Exekutive in tatsächlicher und rechtlicher Hinsicht der gerichtlichen Prüfung unterstellt werden kann; vielmehr müssen die Gerichte den betroffenen Rechten auch tatsächliche Wirksamkeit verschaffen. Das Maß dessen, was wirkungsvoller Rechtsschutz ist, bestimmt sich auch nach dem sachlichen Gehalt des als verletzt behaupteten Rechts, hier der Menschenwürde sowie des Rechts auf Leben und körperliche Unversehrtheit in Verbindung mit der Gewährleistung des Art. 3 EMRK im Lichte der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte. Die verfahrensrechtlichen Anforderungen an die Sachverhaltsaufklärung haben dem hohen Wert dieser Rechte Rechnung zu tragen. In Fällen, in denen die Gefahr von Folter oder unmenschlichen Haftbedingungen in Rede steht, kommt der verfahrensrechtlichen Sachaufklärungspflicht (§ 86 Abs. 1 Verwaltungsgerichtsordnung) verfassungsrechtliches Gewicht zu. Liegen ernsthafte Anhaltspunkte für eine Foltergefahr vor, ist es verfassungsrechtlich und konventionsrechtlich geboten, dass sich die zuständigen Behörden und Gerichte vor einer Rückführung in den Zielstaat über die dortigen Verhältnisse informieren und gegebenenfalls Zusicherungen der zuständigen Behörden einholen, die die Gefahr einer Art. 3 EMRK verletzenden Behandlung wirksam ausschließen.
2. Diesen Maßgaben wird die angegriffene Entscheidung nicht gerecht. Mit der Begründung, es bestünden keine Anhaltspunkte dafür, dass dem Beschwerdeführer im Falle seiner Abschiebung in die Türkei mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit Folter oder menschenrechtswidrige Haftbedingungen drohten, da nur kurdische Aktivisten und Anhänger der Gülen-Bewegung, nicht aber Unterstützer des islamistischen Terrorismus mit menschenrechtswidriger Behandlung rechnen müssten, verfehlt das Verwaltungsgericht die verfassungsrechtlichen Vorgaben. Es bestand im Hinblick auf das vom Beschwerdeführer überreichte Schreiben von amnesty international und insbesondere vor dem Hintergrund der als gerichtsbekannt einzustufenden allgemeinen Erkenntnisse zur politischen Situation in der Türkei von Verfassungs wegen Anlass zu weiterer Sachaufklärung oder zur Einholung von Zusicherungen der türkischen Behörden zur Behandlung des Beschwerdeführers. Denn es gab ernsthafte Anhaltspunkte für das Bestehen einer Foltergefahr auch im Zusammenhang mit dem Vorwurf der Unterstützung des islamistischen Terrorismus und damit auch in Bezug auf den Beschwerdeführer. Diese Anhaltspunkte hätten einer Überprüfung bedurft. Auch in Anbetracht der obergerichtlichen Rechtsprechung zu den Haftbedingungen in der Türkei konnte das Verwaltungsgericht nicht ohne Weiteres davon ausgehen, dass dem Beschwerdeführer nach der Abschiebung keine menschenrechtswidrige Behandlung drohte. Im Hinblick auf den festgestellten Verstoß gegen die aus Art. 19 Abs. 4 Satz 1 GG folgende Aufklärungspflicht bedarf die weitere Frage, ob Personen, die islamistischen terroristischen Organisationen zuzurechnen sind, in der Türkei generell mit Folter zu rechnen haben, im vorliegenden Verfassungsbeschwerdeverfahren keiner Entscheidung.
Bundes- und landesgesetzliche Vorschriften über die Studienplatzvergabe für das Fach Humanmedizin teilweise mit dem Grundgesetz unvereinbar
Pressemitteilung Nr. 112/2017 vom 19. Dezember 2017
Urteil vom 19. Dezember 2017 - 1 BvL 3/14, 1 BvL 4/14
Die bundes- und landesgesetzlichen Vorschriften über das Verfahren zur Vergabe von Studienplätzen an staatlichen Hochschulen sind, soweit sie die Zulassung zum Studium der Humanmedizin betreffen, teilweise mit dem Grundgesetz unvereinbar. Dies hat der Erste Senat des Bundesverfassungsgerichts mit heute verkündetem Urteil entschieden. Die beanstandeten bundesgesetzlichen Rahmenvorschriften und gesetzlichen Regelungen der Länder über die Studienplatzvergabe für das Fach Humanmedizin verletzen den grundrechtlichen Anspruch der Studienplatzbewerberinnen und -bewerber auf gleiche Teilhabe am staatlichen Studienangebot. Außerdem verfehlen die landesgesetzlichen Bestimmungen zum Auswahlverfahren der Hochschulen teilweise die Anforderungen, die sich aus dem Vorbehalt des Gesetzes ergeben. Eine Neuregelung ist bis zum 31. Dezember 2019 zu treffen.
Sachverhalt:
Das Verwaltungsgericht Gelsenkirchen hat die Frage, ob die für die Studienplatzvergabe für das Fach Humanmedizin im Hochschulrahmengesetz (HRG) und in den Vorschriften der Länder zur Ratifizierung und Umsetzung des Staatsvertrages über die Errichtung einer gemeinsamen Einrichtung für Hochschulzulassung vorgesehenen Regelungen mit dem Grundgesetz vereinbar sind, dem Bundesverfassungsgericht zur Entscheidung vorgelegt. Über Einzelheiten informiert die Pressemitteilung Nr. 69/2017 vom 8. August 2017.
Wesentliche Erwägungen des Senats:
1. Die bundes- und landesgesetzlichen Vorschriften zur Studienplatzvergabe in dem bundesweit zulassungsbeschränkten Studiengang der Humanmedizin sind mit Art. 12 Abs. 1 Satz 1 in Verbindung mit Art. 3 Abs. 1 GG unvereinbar, soweit sie die Angabe von Ortswünschen in der Abiturbestenquote beschränken und diese bei der Vergabe vorrangig vor der Abiturnote berücksichtigen, soweit sie die Hochschulen im eigenen Auswahlverfahren zur unbegrenzten Berücksichtigung eines von ihnen zu bestimmenden Grades der Ortspräferenz berechtigen, soweit sie im Auswahlverfahren der Hochschulen auf einen Ausgleichsmechanismus zur Herstellung einer hinreichenden Vergleichbarkeit der Abiturnoten über die Landesgrenzen hinweg verzichten, soweit sie gegenüber den Hochschulen neben der Abiturnote nicht die verpflichtende Anwendung mindestens eines ergänzenden, nicht schulnotenbasierten Auswahlkriteriums zur Bestimmung der Eignung sicherstellen und soweit sie die Wartedauer in der Wartezeitquote nicht zeitlich begrenzen. Die Gestaltung des Auswahlverfahrens der Hochschulen wird den Anforderungen des Vorbehalts des Gesetzes nicht gerecht, soweit nicht durch Gesetz sichergestellt ist, dass die hochschuleigenen Eignungsprüfungsverfahren oder die Auswahl nach vorausgegangener Berufsausbildung oder -tätigkeit auf standardisierte und strukturierte Weise erfolgt. Nicht mit dem Vorbehalt des Gesetzes vereinbar ist auch, dass den Hochschulen im bayerischen und hamburgischen Landesrecht die Möglichkeit gegeben ist, eigenständig weitere Auswahlkriterien festzulegen.
2. a) Aus der Ausbildungs- und Berufswahlfreiheit (Art. 12 Abs. 1 Satz 1 GG) in Verbindung mit dem allgemeinen Gleichheitssatz (Art. 3 Abs. 1 GG) ergibt sich ein Recht auf Teilhabe an den vorhandenen Studienangeboten, die der Staat mit öffentlichen Mitteln geschaffen hat. Diejenigen, die dafür die subjektiven Zulassungsvoraussetzungen erfüllen, haben ein Recht auf gleiche Teilhabe am staatlichen Studienangebot und damit einen Anspruch auf gleichheitsgerechte Zulassung zum Studium ihrer Wahl. Da die Frage der Bemessung der Anzahl verfügbarer Ausbildungsplätze aber der Entscheidung des demokratisch legitimierten Gesetzgebers obliegt, besteht das Recht auf chancengleichen Zugang zum Hochschulstudium nur im Rahmen der tatsächlich bestehenden Ausbildungskapazitäten.
b) Aus dem Gebot der Gleichheitsgerechtigkeit folgt, dass sich die Regeln über die Vergabe von Studienplätzen grundsätzlich am Kriterium der Eignung orientieren müssen. Dabei bemisst sich die für die Verteilung relevante Eignung an den Erfordernissen des konkreten Studienfachs und den typischerweise anschließenden beruflichen Tätigkeiten. Der Gesetzgeber ist nicht von Verfassungs wegen auf die Verwendung eines bestimmten Eignungskriteriums oder einer bestimmten Kriterienkombination verwiesen. Die Kriterien müssen aber in ihrer Gesamtheit Gewähr für eine hinreichende Vorhersagekraft bieten.
c) Bei der Vergabe von Studienplätzen handelt es sich um eine wesentliche Regelungsmaterie, die den Kern des Zulassungswesens ausmacht und damit dem Parlamentsvorbehalt unterliegt. Insofern müssen die Auswahlkriterien ihrer Art nach durch den demokratisch legitimierten Gesetzgeber selbst bestimmt werden. Allerdings darf er den Universitäten gewisse Spielräume für die Konkretisierung der gesetzlich festgelegten Kriterien lassen, anhand derer die Eignung von Studienbewerberinnen und -bewerbern beurteilt werden soll. Solche Spielräume rechtfertigen sich durch den direkten Erfahrungsbezug der Hochschulen und die grundrechtlich geschützte Freiheit von Forschung und Lehre. Eine solche Konkretisierungsbefugnis der Hochschulen schlägt sich insbesondere in den Ausgestaltungsmöglichkeiten hochschuleigener Eignungsprüfungen nieder. Allerdings verlangt der Vorbehalt des Gesetzes gesetzliche Sicherungen dafür, dass die Hochschulen Eignungsprüfungen in standardisierten und strukturierten Verfahren durchführen.
3. a) Das Abstellen auf die Durchschnittsnote der Hochschulzugangsberechtigung für einen Anteil von 20 % der in den Hauptquoten zu vergebenden Studienplätze (Abiturbestenquote) unterliegt keinen verfassungsrechtlichen Bedenken. Insoweit knüpft der Gesetzgeber an eine Beurteilung der Leistungen der Studienbewerber an, die von der Schule am Ende einer allgemeinbildenden Ausbildung vorgenommen wurde. An der Sachgerechtigkeit der Abiturnote als Eignungskriterium auch für die Vergabe von Studienplätzen der Humanmedizin bestehen auf Grundlage der vorliegenden Erkenntnisse keine verfassungsrechtlichen Bedenken. Insbesondere hat der Gesetzgeber im Hinblick auf föderale Unterschiede der Schulausbildung und Benotung Vorkehrungen getroffen, indem er für die zentrale Studienplatzvergabe in der Abiturbestenquote durch die Bildung von Landesquoten einen Ausgleich schafft.
b) Demgegenüber ist im Rahmen der Abiturbestenquote die vorrangige Berücksichtigung von obligatorisch anzugebenden Ortswünschen mit den verfassungsrechtlichen Anforderungen an die gleiche Teilhabe nicht vereinbar. Denn das Kriterium der Abiturdurchschnittsnote wird als Maßstab für die Eignung durch den Rang des Ortswunsches überlagert und entwertet. Die Chancen der Abiturienten auf einen Studienplatz hängen danach in erster Linie davon ab, welchen Ortswunsch sie angegeben haben und nur in zweiter Linie von ihrer Eignung für das Studium. Dies ist im Rahmen einer zentralen Vergabe von Studienplätzen nach dem Kriterium der Abiturdurchschnittsnote verfassungsrechtlich nicht zu rechtfertigen. Bezüglich eines Studienfachs, das über den Zugang zu einem breiten Berufsfeld entscheidet, muss die Frage, ob überhaupt ein Studienplatz vergeben wird, der Ortspräferenz vorgehen. Ortswunschangaben dürfen aus verfassungsrechtlicher Sicht grundsätzlich nur als Sekundärkriterium für die Verteilung der vorhandenen Studienplätze unter den ausgewählten Bewerbern herangezogen werden. Entsprechend ist auch die Begrenzung des Zulassungsantrags auf sechs Studienorte in der Abiturbestenquote verfassungsrechtlich nicht gerechtfertigt. Diese lässt sich insbesondere nicht mit verfahrensökonomischen Notwendigkeiten begründen.
4. Der Gesetzgeber sieht für weitere 60 % der in den Hauptquoten zu vergebenden Studienplätze ein Auswahlverfahren der Hochschulen vor. Die Regelung dieses Verfahrens wird den Anforderungen des Vorbehalts des Gesetzes nicht gerecht. Sie genügt in verschiedener Hinsicht auch nicht den inhaltlichen Anforderungen des Rechts auf gleiche Teilhabe an den staatlichen Studienangeboten.
a) Die bundesrechtliche Rahmenregelung und die landesrechtlichen Regelungen, die diese durch die Vorgabe abschließender Kriterienkataloge weiter ausgestalten, sind im Grundsatz nicht zu beanstanden. Mit dem Vorbehalt des Gesetzes nicht vereinbar ist jedoch, dass den Hochschulen im bayerischen und im hamburgischen Landesrecht die Möglichkeit gegeben ist, eigenständig weitere Auswahlkriterien festzulegen, die sich nicht im gesetzlichen Kriterienkatalog finden. Ein eigenes Kriterienerfindungsrecht der Hochschulen ist verfassungsrechtlich grundsätzlich unzulässig.
b) Der Gesetzgeber muss zudem sicherstellen, dass die Hochschulen, sofern sie von der gesetzlich eingeräumten Möglichkeit Gebrauch machen, eigene Eignungsprüfungsverfahren durchzuführen oder Berufsausbildungen oder -tätigkeiten zu berücksichtigen, dies in standardisierter und strukturierter Weise tun. Er muss dabei auch festlegen, dass in den hochschuleigenen Studierfähigkeitstests und Auswahlgesprächen nur die Eignung der Bewerberinnen und Bewerber geprüft wird. Die den Hochschulen eingeräumte Konkretisierungsbefugnis darf sich ausschließlich auf die fachliche Ausgestaltung und Schwerpunktsetzung unter Einbeziehung auch hochschulspezifischer Profilbildungen beziehen. Diesen Anforderungen werden die vorgelegten Vorschriften nicht uneingeschränkt gerecht. An den erforderlichen gesetzlichen Maßgaben zur Standardisierung und Strukturierung von Eignungsprüfungsverfahren und Auswahlkriterien fehlt es sowohl auf der Ebene des Hochschulrahmengesetzes als auch in den Landesgesetzen.
c) Grundsätzlich nicht zu beanstanden ist, dass der Gesetzgeber den Hochschulen die Durchführung eines Vorauswahlverfahrens eröffnet, mit dem sie die Zahl der Bewerbungen begrenzen können, die in das eigentliche Auswahlverfahren einbezogen werden. Mit der Verfassung nicht vereinbar ist dabei jedoch, dass er den Hochschulen die Möglichkeit einräumt, der Vorauswahl voraussetzungslos und uneingeschränkt den Grad der von den Bewerberinnen und Bewerbern angegebenen Ortspräferenz zugrunde zu legen. Beim Grad der Ortspräferenz handelt es sich um ein Kriterium, das nicht an die Eignung für Studium und Beruf anknüpft und dessen Verwendung sich erheblich chancenverringernd auswirken kann.
Gerechtfertigt ist das Kriterium des Grades der Ortspräferenz nur dann, wenn es für Studienplätze herangezogen wird, die tatsächlich im Rahmen eines aufwendigen individualisierten Auswahlverfahrens vergeben werden. Denn die Durchführung solcher Auswahlverfahren darf der Gesetzgeber als einen wichtigen Bestandteil im Gesamtsystem der Studienplatzvergabe ansehen. Das kann aber nur gelingen, wenn dieser Aufwand auf solche Personen beschränkt wird, bei denen die Wahrscheinlichkeit hinreichend hoch ist, dass sie den Studienplatz auch annehmen. Daher rechtfertigt das Ziel der Ermöglichung komplexer, eignungsorientierter Auswahlverfahren für diese Fälle, das Ortspräferenzkriterium trotz seines fehlenden Eignungsbezugs ausnahmsweise bei der Vorauswahl anzuwenden. Dies gilt jedoch nur, wenn anschließend auch entsprechend aufwendige Auswahlverfahren durchgeführt werden, wie es vor allem bei den im Kriterienkatalog vorgesehenen qualifizierten Gesprächen der Fall sein kann. Für Fallgestaltungen ohne aufwendig gestaltete Auswahlprozeduren erweist sich das Vorauswahlkriterium des Grades der Ortspräferenz als nicht sachgerecht und unangemessen. Verfassungsrechtlich geboten ist außerdem, dass nur ein hinreichend begrenzter Anteil der Studienplätze jeder Universität von einem hohen Grad der Ortspräferenz abhängt. Es ist daher auszuschließen, dass die Universitäten das Ortspräferenzkriterium für alle in ihrem Auswahlverfahren zu vergebenden Studienplätze anwenden.
d) Sowohl für das Vorauswahlverfahren als auch für das Auswahlverfahren selbst eröffnet der Gesetzgeber den Hochschulen als Auswahlkriterium unter anderem den Rückgriff auf die Abiturdurchschnittsnote. Anders als für die Studienplatzvergabe in der Abiturbestenquote verzichtet der Gesetzgeber dabei auf Mechanismen, die die nicht in dem erforderlichen Maße gegebene länderübergreifende Vergleichbarkeit der Abiturdurchschnittsnoten ausgleichen. Das Außerachtlassen dieser Unterschiede führt zu einer gewichtigen Ungleichbehandlung. Es nimmt in Kauf, dass eine große Zahl von Bewerberinnen und Bewerbern abhängig davon, in welchem Land sie ihre allgemeine Hochschulreife erworben haben, erhebliche Nachteile erleiden. Dies gilt insbesondere vor dem Hintergrund, dass es auch im Auswahlverfahren der Hochschulen maßgeblich auf Grenzbereiche der Benotung ankommt und die Dezimalstellen der Durchschnittsnoten häufig über den Erfolg einer Bewerbung entscheiden. Für diese Ungleichbehandlung fehlt es an einem einleuchtenden, belastbaren Sachgrund.
e) Für das Auswahlverfahren der Hochschulen bestimmen das HRG und der Staatsvertrag 2008 verschiedene Kriterien, die von den Hochschulen für die Auswahl der Bewerberinnen und Bewerber herangezogen werden können. Diese Kriterien sind je für sich als Indikatoren für eine an Eignung orientierte Auswahl von Verfassungs wegen nicht zu beanstanden. Jedoch muss mit Blick auf die Studierfähigkeitstests und von den Hochschulen durchzuführende qualifizierte Gespräche sichergestellt werden, dass sie hinreichend strukturiert sind, auf die Ermittlung der Eignung zielen und einer diskriminierenden Anwendung vorgebeugt wird. Entsprechendes gilt für das Kriterium der Berücksichtigung fachnaher Berufsausbildungen oder -tätigkeiten. Auch hiermit lassen sich Anhaltspunkte für die Eignung zum Studium der Humanmedizin erfassen. Angesichts seiner Offenheit muss die Konkretisierung dieses Kriteriums jedoch in transparente Regeln eingebunden werden.
f) Verfassungswidrig ist schließlich, dass der Gesetzgeber für die Auswahl der Bewerberinnen und Bewerber im Auswahlverfahren der Hochschulen keine hinreichend breit angelegten Eignungskriterien vorgibt. Die Öffnung des Auswahlverfahrens für eine Einbeziehung weiterer Kriterien liegt nicht allein in der freien Entscheidung des Gesetzgebers, sondern ist zur Gewährleistung einer gleichheitsgerechten Zulassung zum Studium in gewissem Umfang auch verfassungsrechtlich geboten. Soweit der Gesetzgeber – wie nach derzeitiger Regelung – für die Berücksichtigung anderer Eignungskriterien als der Abiturdurchschnittsnote allein das Auswahlverfahren der Hochschulen vorsieht, richten sich entsprechende Anforderungen an dessen Ausgestaltung. Geboten ist insoweit, dass der Gesetzgeber die Hochschulen dazu verpflichtet, die Studienplätze nicht allein und auch nicht ganz überwiegend nach dem Kriterium der Abiturnoten zu vergeben, sondern zumindest ergänzend ein nicht schulnotenbasiertes, anderes eignungsrelevantes Kriterium einzubeziehen. Diesen Anforderungen genügt die derzeitige Rechtslage nicht. Weder das HRG noch der Staatsvertrag 2008 verpflichten die Hochschulen, bei der Auswahlentscheidung neben dem Abitur auch ein weiteres, nicht schulnotenbasiertes Kriterium in der verfassungsrechtlich gebotenen Weise zu berücksichtigen. Auch die den Staatsvertrag in einigen Ländern ergänzenden Vorschriften stellen dies nicht hinreichend sicher.
5. Schließlich sieht der Gesetzgeber für einen Anteil von 20 % der in den Hauptquoten zu vergebenden Studienplätze die Vergabe nach Wartezeit vor (Wartezeitquote). Die Bildung einer solchen Wartezeitquote ist verfassungsrechtlich nicht unzulässig, aber nur unter bestimmten Voraussetzungen mit Art. 12 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 3 Abs. 1 GG vereinbar. Die jetzige Bemessung der Quote ist noch verfassungsgemäß. Über den Anteil von 20 % der in den Hauptquoten zu vergebenden Studienplätze hinaus darf der Gesetzgeber die Wartezeitquote jedoch nicht erhöhen. Als verfassungswidrig erweist es sich, dass der Gesetzgeber die Wartezeit in ihrer Dauer nicht angemessen begrenzt hat. Denn ein zu langes Warten beeinträchtigt erheblich die Erfolgschancen im Studium und damit die Möglichkeit zur Verwirklichung der Berufswahl. Sieht der Gesetzgeber demnach zu einem kleineren Teil auch eine Studierendenauswahl nach Wartezeit vor, ist er von Verfassungs wegen gehalten, die Wartedauer auf ein mit Blick auf ihre negativen Folgen noch angemessenes Maß zu begrenzen. Dies gilt ungeachtet dessen, dass die verfassungsrechtlich gebotene Beschränkung der Wartedauer dazu führen mag, dass viele Bewerber am Ende keinen Studienplatz über die Wartezeitquote erhalten können. Ferner ist für die Wartezeitquote - ebenso wie für die Abiturbestenquote - eine verfahrensökonomische Notwendigkeit, die eine zahlenmäßige Beschränkung der Ortswahlangaben erfordern könnte, nicht erkennbar; auch hier hat der Gesetzgeber zudem dem Grad der Ortspräferenz eine zu große Bedeutung beigemessen.
6. Mit Ausnahme der gemäß Art. 31 GG zur Nichtigkeit führenden Abweichung in § 8a BerlHZG von den Regelungen des Hochschulrahmengesetzes verbleibt es bei der bloßen Feststellung der Unvereinbarkeit der beanstandeten Vorschriften mit dem Grundgesetz. Zugleich wird deren begrenzte Fortgeltung angeordnet; den zuständigen Landesgesetzgebern wird aufgegeben, bis zum 31. Dezember 2019 eine Neuregelung zu treffen, wenn und soweit der Bund bis dahin nicht von seiner konkurrierenden Gesetzgebungskompetenz Gebrauch gemacht hat.
Erfolglose Verfassungsbeschwerden gegen die Planfeststellung über den Ausbau des Flughafens Berlin-Schönefeld vor dem Hintergrund geänderter Flugrouten
Pressemitteilung Nr. 109/2017 vom 12. Dezember 2017
Beschlüsse vom 24. Oktober 2017
Die 2. Kammer des Ersten Senats des Bundesverfassungsgerichts hat mit heute veröffentlichten Beschlüssen vier Verfassungsbeschwerden gegen Entscheidungen des Bundesverwaltungsgerichts zum Flughafen Berlin-Schönefeld nicht zur Entscheidung angenommen. In den zugrundeliegenden Verfahren hatten die Kläger vor dem Hintergrund des Abweichens der angekündigten von den ursprünglich prognostizierten Flugrouten auf verschiedene Weise versucht, die Aufhebung des durch Urteile des Bundesverwaltungsgerichts vom 16. März 2006 im Wesentlichen rechtskräftig bestätigten Planfeststellungsbeschlusses zu erreichen. Nach diesen Beschlüssen ist die Trennung zwischen dem Verfahren der Planfeststellung über den Ausbau des Flughafens Berlin-Schönefeld und der Festlegung der Flugverfahren verfassungsrechtlich nicht zu beanstanden. Auch die Feststellung des Bundesverwaltungsgerichts, dass die auf der Annahme von parallelen Abflugrouten für zeitversetzt durchgeführte Flüge basierende Grobplanung der Flugverfahren ausreichend gewesen sei, um die Lärmbetroffenheiten auch bei gleichzeitiger unabhängiger Durchführung bestimmter Abflüge von beiden Bahnen abzuschätzen, hat Bestand.
Sachverhalt:
Der Planfeststellungsbeschluss vom 13. August 2004 sieht den Ausbau des Verkehrsflughafens Berlin-Schönefeld zum Großflughafen Berlin Brandenburg mit zwei parallelen Start- und Landebahnen vor. Die Planfeststellungsbehörde legte darin dar, dass die Herstellung eines unabhängig benutzbaren Parallelbahnsystems ein wesentlicher Grund für den Ausbau des Flughafens sei und wies darauf hin, dass die Flugrouten in einem separaten Verfahren festgesetzt würden.
In einer von der Planfeststellungsbehörde eingerichteten Arbeitsgruppe, an der die Deutsche Flugsicherung (DFS) und die Projektplanungsgesellschaft (PPS) beteiligt waren, sollten zur Ermittlung der Auswirkungen des Flugbetriebs die erst kurz vor der Inbetriebnahme des Flugplatzes erfolgende Festlegung der An- und Abflugverfahren mit den der Flughafenplanung zugrunde zu legenden Prognosen der An- und Abflugrouten in Einklang gebracht werden. Nach deren Ergebnis sollten die Abflugrouten in beide Betriebsrichtungen zunächst mehrere Kilometer parallel in gerader Verlängerung der jeweiligen Bahnen verlaufen. Die DFS ging bei dieser Grobplanung, ohne hierauf ausdrücklich hinzuweisen, davon aus, dass die beiden Bahnen des Flugplatzes nicht unabhängig voneinander genutzt werden sollten. Die PPS berechnete auf dieser Grundlage die Streckengeometrie für das Datenerfassungssystem (DES). Im weiteren Verlauf teilte die DFS der Arbeitsgruppe mit, dass die gleichzeitige unabhängige Durchführung von Instrumentenflug-Abflügen (Instrument Flight Rules - IFR-Abflügen) von beiden Pisten unmittelbar nach dem Start eine Divergenz des Abflugkurses von mindestens 15° erfordere. Ebenso müssten die Abflugrouten um mindestens 30° von den Fehlanflugkursen der jeweils anderen Piste abweichen. Gleichwohl erstellte die PPS die Planunterlagen auf der Grundlage paralleler Abflugrouten.
Im Anhörungsverfahren wies die DFS darauf hin, dass zur Gewährleistung gleichzeitiger Abflüge von beiden Pisten generell eine Divergenz der Abflugwege von 15° erforderlich wäre. Weiter wies sie darauf hin, dass die Flugverfahren nicht Gegenstand einer Planfeststellung seien, sondern jederzeit optimiert werden könnten. Die Festlegung der für die Inbetriebnahme des neuen Bahnsystems notwendigen Flugverfahren werde erst kurz vor Betriebsaufnahme erfolgen.
Die Planfeststellungsbehörde bestimmte die Schutz- und Entschädigungsgebiete und die Gebiete, in denen die Planunterlagen ausgelegt wurden, auf der Grundlage von parallelen Abflugrouten. Sie behielt sich vor, bei geänderten An- und Abflugverfahren die festgelegten Schutz- und Entschädigungsgebiete neu auszuweisen, wenn sich der Dauerschallpegel an der äußersten Grenze des Schutzgebietes an den Schnittpunkten mit den An- und Abflugstrecken um mehr als 2 dB(A) ändere.
Die dem Datenerfassungssystem zugrunde gelegten Flugrouten im Planfeststellungsbeschluss wurde dort von der Planfeststellungsbehörde als „durchaus plausible und auch hinreichend konkrete Grundlage“ für die Ermittlung der Auswirkungen des Ausbauvorhabens bezeichnet. Gegen den Planfeststellungsbeschluss erhobene Klagen Betroffener hatten lediglich im Hinblick auf die Regelungen zum Nachtflugverbot Erfolg.
Die Beschwerdeführerinnen und Beschwerdeführer sind Eigentümer von Wohngrundstücken, die nach der dem Planfeststellungsbeschluss zugrunde gelegten Abflugroutenprognose außerhalb der entsprechenden Schutz- und Entschädigungsgebiete lagen. Nach einer im Jahr 2010 von der DFS neu vorgestellten Flugroutenplanung mit abgeknickten Flugrouten sollen ihre Grundstücke nunmehr überflogen werden.
Im Verfahren 1 BvR 1026/13 beantragten sie bei der Planfeststellungsbehörde erfolglos die Rücknahme des Planfeststellungsbeschlusses und erhoben gegen die Ablehnung des Antrages Klage zum Bundesverwaltungsgericht. Dieses wies die Klage mit der Begründung ab, dass der Planfeststellungsbeschluss keinen Rechtsfehler aufweise, der zu einem Anspruch auf Rücknahme oder auf ermessensfehlerfreie Entscheidung der Behörde führe. In den Verfahren 1 BvR 2762/12 und 1 BvR 2763/12 beantragten Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer vor dem Bundesverwaltungsgericht erfolglos eine Restitutionsklage mit dem Ziel, den Planfeststellungsbeschlusses selbst und ältere Urteile, die ihn bestätigt haben, aufzuheben. Im Verfahren 1 BvR 877/13 verfolgten die Beschwerdeführer die Wiedereinsetzung in die Klagefrist einer ursprünglich gegen den Planfeststellungsbeschluss gerichteten, aber erfolglos gebliebenen Klage.
Wesentliche Erwägungen der Kammer:
1. Die im Fachrecht vorgesehene Trennung von Planung des Flughafenstandorts und Festlegung der Flugverfahren verletzt die Beschwerdeführer nicht in ihrem Eigentumsgrundrecht und der darin eingeschlossenen Garantie auf effektiven Rechtsschutz. Für die vom Gesetzgeber gewählte Aufteilung sprechen verfassungsrechtlich nicht zu beanstandende Zweckmäßigkeitserwägungen, die den Besonderheiten von Flugrouten Rechnung tragen. Flugrouten sind - anders als Straßen oder Schienenwege - nicht statisch, sondern aktualisieren sich bei jedem Überflug neu, indem das Luftfahrzeug den vorgegebenen Routenpunkt mit der vorgegebenen Höhe überfliegt. Dabei bestehen größere Abweichungen, da die konkret geflogene Route von einer Vielzahl von Gegebenheiten abhängt, wie zum Beispiel der konkreten Verkehrszusammensetzung, dem Gewicht des Luftfahrzeugs und den Wetterverhältnissen. Die Flugroute ist ein dreidimensionaler Raum, der mehrere hundert Meter ober- und unterhalb sowie links und rechts der Ideallinie umfasst. Auch müssen die Flugverfahren aufgrund technischer Neuerungen und europäischer Vorgaben häufig angepasst und geändert werden. Die Flugroutenfestlegung dient zudem der geordneten, flüssigen und vor allem sicheren Abwicklung des Luftverkehrs.
Durch die Verfahrensteilung wird der Rechtsschutz nicht in unzumutbarer Weise erschwert. Sowohl der Planfeststellungsbeschluss als auch die Flugverfahrensverordnung können von einem Betroffenen unabhängig voneinander gerichtlicher Kontrolle zugeführt werden, ohne dass unzumutbare Rechtsschutznachteile entstünden. Eine unzumutbare Erschwerung des Rechtsschutzes ergibt sich dabei auch nicht aus dem Umstand, dass die Betroffenen sich im Rahmen eines einheitlich erscheinenden Lebenssachverhaltes gegen zwei Entscheidungen wenden müssen, um ihre Rechtsschutzmöglichkeiten auszuschöpfen. Auch sonst ist der Rechtsschutz nicht unzumutbar erschwert. Betroffene können im Rahmen des zeitlich in der Regel vorgelagerten Rechtsschutzes gegen den Planfeststellungsbeschluss zwar nur auf Grundlage einer Prognose über die zu erwartenden Flugrouten ermitteln, ob und in welchem Ausmaß sie das Vorhaben in abwägungserheblichen Belangen betrifft, weil die endgültige (insbesondere Lärm-) Belastung erst aus der zeitlich später vorgenommenen Festlegung der Flugverfahren folgt. Das Bundesverwaltungsgericht geht aber von einer Klagebefugnis aus, wenn eine Betroffenheit nicht ausgeschlossen werden kann, so dass Klägern auch nicht das Risiko der Unzulässigkeit der Klage aufgebürdet wird.
2. Das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts begegnet am Maßstab des Eigentumsgrundrechts und der Garantie effektiven Rechtsschutzes (Art. 14 Abs. 1 Satz 1 in Verbindung mit Art. 19 Abs. 4 GG) auch keinen durchgreifenden Bedenken, soweit es die Vorschrift des § 46 Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) zur Unbeachtlichkeit von Fehlern im Verwaltungsverfahren zur Anwendung bringt. Das Bundesverwaltungsgericht hat Verfahrensfehler des Planfeststellungsverfahrens bei der Abgrenzung des Auslegungsgebiets der Planunterlagen und bei der Abgrenzung des Untersuchungsraums Mensch im Rahmen der Umweltverträglichkeitsprüfung festgestellt. Unter Hinweis auf das Abwägungskonzept, das dem Landesentwicklungsplan und der Zulassung des Vorhabens im Planfeststellungsbeschluss zugrunde liegt, hat es jedoch dargelegt, dass weder die Standortwahl noch die Bahnkonfiguration ohne die Verfahrensfehler anders ausgefallen wären. Dies begegnet keinen verfassungsrechtlichen Bedenken. Der Gesetzgeber kann insoweit regeln, dass dem öffentlichen Interesse an der Planerhaltung und zügigen Umsetzung eines Vorhabens in begrenztem Umfang durch Fehlerunbeachtlichkeitsklauseln Rechnung getragen wird. Das gilt zumindest dann, wenn letztlich für das Ergebnis ohne Einfluss gebliebene Abwägungsfehler für unbeachtlich erklärt werden. Eine entsprechende Auslegung des Fachrechts durch die in erster Linie dazu berufenen Fachgerichte ist daher verfassungsrechtlich nicht zu beanstanden. Grenzen finden sich erst dort, wo Rechtsstaatlichkeit und Grundrechte nicht nur die Wahrung von Verfahrensstandards selbst, sondern zusätzlich auch zwingend die Sanktionierung von deren Verletzung verlangen. Vor diesem Hintergrund stellt die Auslegung des § 46 VwVfG durch das Bundesverwaltungsgericht, der zufolge ein Verfahrensfehler erst dann beachtlich ist, wenn die konkrete Möglichkeit besteht, dass ohne den Verfahrensfehler eine andere Entscheidung getroffen worden wäre, eine vom Bundesverfassungsgericht grundsätzlich hinzunehmende Interpretation des Fachrechts dar.
Die Annahme der Unerheblichkeit eines Verfahrensfehlers ist verfassungsrechtlich allerdings dann nicht mehr hinnehmbar, wenn die Ergebniskausalität des Fehlers nur dadurch verneint werden kann, dass das Gericht eine eigene hypothetische Abwägungsentscheidung an die Stelle der Entscheidung durch die Planfeststellungsbehörde setzt.
Die Beschwerdeführer haben dies zwar hinsichtlich einer eventuell fehlerhaften Öffentlichkeitsbeteiligung und fehlerhaften Umweltverträglichkeitsprüfung geltend gemacht, ihrem Vortrag lässt sich aber nicht entnehmen, weshalb sich ohne die Fehler ein anderes Ergebnis ergeben hätte. Dass dies der Fall wäre, ist auch nicht erkennbar.
3. Dahinstehen kann, ob das Bundesverwaltungsgericht die Anstoßwirkung der ausgelegten Unterlagen in einer verfassungsrechtlich zu beanstandenden Weise bejaht hat, indem es den Einwand der Beschwerdeführer nicht gewürdigt hat, dass durch den Plan Erwartungen in Bezug auf eine besondere Wahrscheinlichkeit eines bestimmten Flugverfahrens geweckt worden seien, dessen Verwirklichung von vornherein eher unwahrscheinlich gewesen sein könnte. Auch dies würde der Verfassungsbeschwerde nicht zum Erfolg verhelfen, weil deutlich abzusehen ist, dass die Beschwerdeführer auch im Fall einer Zurückweisung an das Ausgangsgericht im Ergebnis keinen Erfolg haben würden.
a) Das Gebot effektiven Rechtsschutzes verlangt neben der Vermittlung der Kenntnis der Möglichkeit der eigenen Betroffenheit auch, dass Betroffenen ermöglicht wird, die Wahrscheinlichkeit der eigenen Betroffenheit hinreichend abschätzen zu können. Diese Garantie ist gerade auch bei der Anwendung der Vorschriften über die Auslegung der Planfeststellungsunterlagen zu beachten. Denn diesen kommt Rechtsschutzfunktion zu, weil Betroffene auf Grundlage der ausgelegten Unterlagen gegebenenfalls entscheiden müssen, ob und mit welchen Argumenten sie sich gegen das Vorhaben wenden sollen. Lassen die Planfeststellungsunterlagen in einem gestuften Verwaltungsverfahren aber nicht hinreichend deutlich erkennen, wie wahrscheinlich eine eigene Betroffenheit in geschützten Positionen ist, oder erweckt sie gar einen den Realisierungswahrscheinlichkeiten zuwider laufenden Eindruck, können sie ihre Anstoßwirkung nicht erfüllen.
Das Bundesverwaltungsgericht hat dem Einwand keine Beachtung geschenkt, dass durch den Plan Erwartungen in Bezug auf eine besondere Wahrscheinlichkeit eines bestimmten Flugverfahrens geweckt worden seien, dessen Verwirklichung nach dem nicht von der Hand zu weisenden Vorbringen der Beschwerdeführer eher unwahrscheinlich gewesen sein könnte.
Es spricht viel dafür, dass die Betroffenen nach den ausgelegten Planunterlagen davon ausgehen durften, dass es sich bei den prognostizierten parallelen Abflugverfahren um die Variante handelt, deren Verwirklichung konkret wahrscheinlich ist. Zwar mussten sie mit der Möglichkeit der Änderung der Linienführung der Flugrouten rechnen, sie mussten aber nicht davon ausgehen, dass die Verwirklichung in der in den Planunterlagen vorgesehenen Form unwahrscheinlich war. Vor dem Hintergrund der fachrechtlichen Anforderungen an die Flugroutenplanung durften die Betroffenen annehmen, dass die prognostische Flugroutenplanung nach Einschätzung der Behörde realisierbar war und den bisherigen Planungen entsprach, ihre Umsetzung also realistischerweise erwartet werden konnte, zumal es an einem hinreichend klaren Hinweis auf die besondere Unsicherheit der der Standortplanung und der Bahnkonfiguration zugrunde gelegten Flugroutenprognose gefehlt haben dürfte.
b) Selbst wenn der Planfeststellungsbeschluss wegen unzulänglicher Anstoßwirkung der ausgelegten Planunterlagen und das Bundesverwaltungsgericht mangels Beanstandung dieses Verfahrensfehlers gegen das Gebot effektiven Rechtsschutzes verstoßen haben sollten, wäre die Annahme der Verfassungsbeschwerde zur Durchsetzung der in § 90 Abs. 1 BVerfGG genannten Rechte jedoch nicht angezeigt. Es ist deutlich abzusehen, dass die Beschwerdeführer auch im Fall einer Zurückverweisung an das Ausgangsgericht im Ergebnis keinen Erfolg haben würden. Es spricht alles dafür, dass das Bundesverwaltungsgericht auch die Ergebnisrelevanz dieses Verfahrensfehlers ebenso verneinen würde wie bei den von ihm festgestellten strukturell ähnlichen Mängeln.
4. Die Feststellungen des im Verfahren 1 BvR 1026/13 angegriffenen Urteils zur materiellen Rechtmäßigkeit des Planfeststellungsbeschlusses halten hinsichtlich der Ausführungen zur Standortwahl einer verfassungsrechtlichen Nachprüfung stand und wurden von den Beschwerdeführern hinsichtlich der Bahnkonfigurationen nicht hinreichend substantiiert angegriffen.
a) Das Bundesverwaltungsgericht hat festgestellt, dass die für einen hinsichtlich der beiden Bahnen voneinander abhängigen Bahnbetrieb erstellte Grobplanung der Flugverfahren sowohl für die Wahl des Flughafenstandorts auf der Ebene der Landesplanung als auch für die Entscheidung der Planfeststellungsbehörde über die Zulassung des Vorhabens am Standort Schönefeld ausreichend gewesen sei, um die Lärmbetroffenheiten auch bei unabhängigem Bahnbetrieb im Ergebnis vertretbar abzuschätzen. Es ist von Verfassungs wegen nicht zu beanstanden, wenn eine bei der Standortwahl eines Flughafens im Rahmen der Landesplanung und der Planfeststellung zugrunde gelegte Prognose von der Rechtsprechung gebilligt wird, obwohl diese die konkreten und individuellen Betroffenheiten nicht abbildet, sondern nur nach Art und Ausmaß derart darstellt, dass sie als Abwägungsbelange in die Abwägung auf der jeweiligen Stufe eingestellt werden können. Hier ist der Belang „Lärm“ nach Auffassung des Bundesverwaltungsgerichts insgesamt zutreffend in der Abwägung bei der Standortbestimmung eingebracht und berücksichtigt worden. Das Bundesverfassungsgericht hat diese Auslegung lediglich auf die Verkennung von Grundrechten hin zu überprüfen. Eine solche ist hier nicht gegeben. Es ist von Verfassungs wegen nicht geboten, bereits auf der Ebene der Planung eine Prognose zu fordern, der sich mehr als ungefähre Anzahl der Lärmbetroffenen und die Intensität der Lärmbetroffenheiten entnehmen lässt, weil unmittelbare Grundrechtsbeeinträchtigungen insbesondere in Gestalt von Fluglärmeinwirkungen noch nicht durch den Planfeststellungsbeschluss zugelassen werden, sondern erst durch die Bestimmung der konkreten Flugrouten entstehen.
b) Das Bundesverwaltungsgericht hat auch nicht in verfassungsrechtlich nicht hinnehmbarer Weise seine eigene Entscheidung an jene des Plangebers gesetzt, sondern lediglich das Ergebnis dieser Abwägung vor dem Hintergrund einzelner eigener Feststellungen überprüft. Die Planung des Flughafens ist trotz ihrer erkennbaren Ausrichtung auf parallele Flugrouten offensichtlich stets auf der Grundlage erfolgt, dass abweichende Flugrouten in Betracht kommen und dass sie auch bei der Festlegung anderer Flugrouten Bestand haben wird. Vor diesem Hintergrund überdehnt das Bundesverwaltungsgericht den Inhalt des Planfeststellungsbeschlusses nicht, wenn es der Flugroutenprognose ein stellvertretendes, repräsentatives Element entnimmt, das es ihm wiederum ermöglicht, vergleichende Erwägungen zum Ausmaß der Lärmbetroffenheiten anderer anzustellen. Vielmehr vollzieht es die so verstandene Planung nach und stellt lediglich eigene Ermittlungen zur Kontrolle des Abwägungsergebnisses an, wenn es feststellt, dass Art und Ausmaß der Betroffenheiten bei abweichender Flugroutenfestlegung nicht „erheblich“ anders seien.
5. a) Vor diesem Hintergrund hatten auch die Verfassungsbeschwerden gegen die Abweisung der Restitutionsklagen (Aktenzeichen 1 BvR 2762/12 und 1 BvR 2763/12) keinen Erfolg. Die Annahme, dass die neu beigebrachten Urkunden keine für die Beschwerdeführer günstigere Entscheidung herbeiführen würden, weil das Festhalten an der bisherigen Grobplanung für die Wahl des Flughafenstandortes und die Zulassung des Vorhabens am Standort Schönefeld sachlich gerechtfertigt sei, war aus den vorerwähnten Gründen in verfassungsrechtlicher Hinsicht nicht zu beanstanden.
b) Auch soweit das Bundesverwaltungsgericht in dem der Verfassungsbeschwerde 1 BvR 877/13 zugrunde liegenden Verfahren von einer Verfristung der Anfechtungsklage ausgegangen ist und die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand mit der Begründung verneint hat, ein Fall höherer Gewalt liege nicht vor, ist dies verfassungsrechtlich nicht zu beanstanden. Es durfte die Anstoßfunktion der öffentlichen Bekanntmachung und damit den Beginn der Klagefrist auch bezüglich der Grundstücke bejahen, die nicht unter den ursprünglich geplanten Flugrouten lagen, weil insofern die öffentliche Bekanntmachung allein des verfügenden Teils des Planfeststellungbeschlusses im Amtsblatt und in den lokal verbreiteten Zeitungen maßgeblich war. Dass der öffentlich bekannt gemachte verfügende Teil in gleicher Weise möglicherweise unzutreffende Erwartungen in Bezug auf eine besondere Wahrscheinlichkeit eines bestimmten Flugverfahrens hätte wecken können, ist von den Beschwerdeführern nicht geltend gemacht und auch sonst nicht erkennbar. Auch hat das Bundesverwaltungsgericht die Anforderungen an das Vorliegen höherer Gewalt nicht in verfassungsrechtlich relevanter Weise überspannt, indem es den Einwand der Täuschung nicht für erheblich gehalten hat, da die Beschwerdeführer jedenfalls nicht dargelegt haben, dass eine mögliche Täuschung ursächlich für das nicht fristgerechte Erheben der Klage war.
Erfolgreiche Verfassungsbeschwerde gegen die Höhe der Telefongebühren in einer Justizvollzugsanstalt
Pressemitteilung Nr. 104/2017 vom 28. November 2017
Beschluss vom 08. November 2017
2 BvR 2221/16
Mit heute veröffentlichtem Beschluss hat die 2. Kammer des Zweiten Senats des Bundesverfassungsgerichts einer Verfassungsbeschwerde stattgegeben, die sich gegen die Höhe der Telefongebühren in einer Justizvollzugsanstalt richtete. Es verstößt gegen das verfassungsrechtliche Resozialisierungsgebot, wenn die wirtschaftlichen Interessen eines Gefangenen missachtet werden, indem der geltend gemachte Anspruch auf Anpassung der Telefongebühren lediglich mit dem Hinweis auf die mit einem privaten Telekommunikationsanbieter langfristig eingegangene Vertragsbindung abgelehnt wird.
Sachverhalt:
Der Beschwerdeführer war Strafgefangener in einer Justizvollzugsanstalt in Schleswig-Holstein. Diese verfügt über ein Insassentelefonsystem, das von einem privaten Telekommunikationsanbieter auf Grundlage eines mit dem Land Schleswig-Holstein langfristig geschlossenen Vertrags betrieben wird. Alternative Telefonnutzungsmöglichkeiten bestehen für die Insassen der Justizvollzugsanstalt nicht. Im Juni 2015 führte der Anbieter einen Tarifwechsel durch, was für den Beschwerdeführer erheblich höhere Telefonkosten mit sich brachte. Sein an die Justizvollzugsanstalt gerichteter Antrag, die Telefongebühren an diejenigen außerhalb der Anstalt anzupassen und dabei seine finanziellen Interessen zu wahren, wurde abgelehnt. Den Antrag auf gerichtliche Entscheidung wies das Landgericht zurück; die Rechtsbeschwerde zum Oberlandesgericht blieb ebenfalls ohne Erfolg. Mit seiner Verfassungsbeschwerde rügt der Beschwerdeführer vornehmlich die Verletzung seines Grundrechts auf Resozialisierung (Art. 2 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 1 Abs. 1 GG).
Wesentliche Erwägungen der Kammer:
Die Verfassungsbeschwerde ist zulässig und begründet. Der angegriffene Beschluss des Oberlandesgerichts missachtet die aus dem Resozialisierungsgebot erwachsenden Anforderungen an die Wahrung der finanziellen Interessen von Strafgefangenen.
1. Zwar müssen Telekommunikationsdienstleistungen den Gefangenen nicht entgeltfrei zur Verfügung gestellt werden. Allerdings dürfen die Gefangenen auch nicht mit Entgelten belastet werden, die, ohne dass verteuernde Bedingungen und Erfordernisse des Strafvollzugs dies notwendig machten, deutlich über den außerhalb des Vollzuges üblichen liegen. Auch mit dem verfassungsrechtlichen Grundsatz der Verhältnismäßigkeit, der es gebietet, Strafe nur als ein in seinen negativen Auswirkungen auf die Persönlichkeit des Betroffenen nach Möglichkeit zu minimierendes Übel zu vollziehen, wäre dies nicht vereinbar.
Aus diesen Bindungen kann sich die Anstalt nicht nach Belieben lösen, indem sie für die Erbringung von Leistungen Dritte einschaltet. Lässt die Justizvollzugsanstalt Leistungen durch einen privaten Betreiber erbringen, auf den die Gefangenen ohne eine am Markt frei wählbare Alternative angewiesen sind, muss sie sicherstellen, dass der ausgewählte private Anbieter die Leistung zu marktgerechten Preisen erbringt. Dabei ist für die Beurteilung, ob die Preise des privaten Anbieters noch marktgerecht sind, eine Vertragsbindung der Anstalt an den Anbieter nicht maßgeblich. Auch erfolglose Bemühungen um Tarifanpassungen im Vertragsverhältnis zu dem Anbieter entbinden die Justizvollzugsanstalt nicht von ihrer Fürsorgepflicht für die Gefangenen.
2. Das Oberlandesgericht hat die Frage der Angemessenheit der Telefontarife ausdrücklich offengelassen. Hierdurch hat es die finanziellen Interessen des Beschwerdeführers missachtet und ihn dadurch in seinem Grundrecht auf Resozialisierung (Art. 2 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 1 Abs. 1 GG) verletzt. Das Festhalten an dem Vertrag, den das Justizministerium mit einer Laufzeit von 15 Jahren ausgehandelt hat und dessen vorzeitige Kündigung es auch nicht beabsichtigt, hindert die Justizvollzugsanstalt nicht daran, dem Beschwerdeführer marktgerechte Preise in Rechnung zu stellen oder ihm kostengünstigere Alternativen der Telefonnutzung anzubieten.
Erfolglose Verfassungsbeschwerde gegen die Versagung des Namens- und Personenstandswechsels nach dem Transsexuellengesetz
Pressemitteilung Nr. 103/2017 vom 24. November 2017
Beschluss vom 17. Oktober 2017
1 BvR 747/17
Mit heute veröffentlichtem Beschluss hat die 2. Kammer des Ersten Senats des Bundesverfassungsgerichts eine Verfassungsbeschwerde gegen die Versagung der Änderung des Vornamens und des Personenstands nach dem Transsexuellengesetz (TSG) nicht zur Entscheidung angenommen. Die beschwerdeführende Person hatte vorgetragen, es sei verfassungswidrig, dass § 4 Abs. 3 Satz 1 TSG die Einholung von zwei Sachverständigengutachten verlange.
Sachverhalt:
Die beschwerdeführende Person stellte auf Grundlage des Transsexuellengesetzes (TSG) einen Antrag auf Änderung des Vornamens (§ 1 TSG) und auf Feststellung der weiblichen Geschlechtszugehörigkeit (§ 8 TSG). Dabei trug sie vor, dass ihren Anträgen aufgrund der Verfassungswidrigkeit der zugrunde liegenden Vorschrift des § 4 Abs. 3 Satz 1 TSG auch ohne die Einholung von zwei Sachverständigengutachten stattzugeben sei. Das Amtsgericht wies diesen Antrag zurück; die hiergegen gerichtete Beschwerde zum Oberlandesgericht blieb erfolglos. Mit ihrer Verfassungsbeschwerde rügt die beschwerdeführende Person vornehmlich einen Verstoß ihres allgemeinen Persönlichkeitsrechts (Art. 2 Abs. 1 GG in Verbindung mit Art 1 Abs. 1 GG). Insbesondere basiere § 4 Abs. 3 Satz 1 TSG auf der obsoleten Annahme, bei Transsexualität handele es sich um eine Krankheit und die Betroffenen sollten durch die Begutachtung zu deren Behandlung „hingeführt“ werden.
Wesentliche Erwägungen der Kammer:
Die Verfassungsbeschwerde hat mangels Rechtsschutzbedürfnisses keine Aussicht auf Erfolg.
1. Das Bundesverfassungsgericht hat erst vor wenigen Jahren festgestellt, dass es verfassungsrechtlich nicht zu beanstanden ist, wenn die Voraussetzungen des Namens- und Personenstandswechsels durch zwei Gutachten voneinander unabhängiger Sachverständiger nachgewiesen werden müssen. Diese Entscheidung des Senats besagt nicht und beruht auch nicht auf der Annahme, Transsexualität sei ein krankhafter Zustand oder eine psychische Störung.
2. a) Das Bundesverfassungsgericht hat das Erfordernis zweier Gutachten als prozessrechtliches Mittel des objektiven Nachweises der rechtlichen Voraussetzungen des Geschlechtswechsels angesehen. Die Begutachtung nach § 4 Abs. 3 TSG darf sich daher nur auf solche Aspekte beziehen, die für die sachliche Aufklärung der Voraussetzungen des Namens- und Personenstandswechsels relevant sind. Die Gerichte haben bei der Erteilung des Gutachtenauftrags und bei der Verwertung des Gutachtens darauf zu achten, dass die Betroffenen nicht der Begutachtung hinsichtlich solcher Fragen ausgesetzt sind, die für die Prüfung der Tatbestandsvoraussetzungen keine Bedeutung haben. Außerdem darf das Gutachtenverfahren nicht dazu genutzt werden, die Betroffenen zu einer therapeutischen Behandlung ihrer (als vermeintliche Krankheit begriffenen) Transsexualität hinzuführen.
b) Dass § 4 Abs. 3 TSG in der Praxis möglicherweise unzulässig angewendet wird, gibt dem Bundesverfassungsgericht hier keinen Anlass, sich erneut mit der Verfassungsmäßigkeit der Vorschrift zu befassen. Wenn die Regelung in konkreten Fällen tatsächlich in grundrechtsverletzender Weise angewendet werden sollte, stellt das nicht ohne Weiteres die Regelung selbst in Frage. Da die beschwerdeführende Person sich selbst der Begutachtung gar nicht erst unterzogen hat, kann sie nicht durch eine unzulässige Ausgestaltung der Begutachtung in ihren Grundrechten verletzt sein.
Die Bundesregierung hat Auskünfte zur Deutschen Bahn AG und zur Finanzmarktaufsicht zu Unrecht verweigert
Pressemitteilung Nr. 94/2017 vom 7. November 2017
Urteil vom 7. November 2017 - 2 BvE 2/11
Mit heute verkündetem Urteil hat der Zweite Senat des Bundesverfassungsgerichts festgestellt, dass die Bundesregierung ihrer Antwortpflicht bei der Beantwortung von Anfragen zur Deutschen Bahn AG und zur Finanzmarktaufsicht nicht genügt und hierdurch Rechte der Antragsteller und des Deutschen Bundestages verletzt hat. Die streitgegenständlichen Fragen zu Vereinbarungen zwischen der Bundesregierung und der Deutschen Bahn AG über Investitionen in das Schienennetz, zu einem Gutachten zum Projekt „Stuttgart 21“, zu Zugverspätungen und deren Ursachen sowie zu aufsichtsrechtlichen Maßnahmen der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht gegenüber mehreren Banken in den Jahren 2005 bis 2008 hat die Bundesregierung ohne hinreichende Begründung unvollständig beantwortet oder unbeantwortet gelassen.
Sachverhalt:
Im Jahr 2010 stellten Abgeordnete des Deutschen Bundestages und die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (nachfolgend Antragsteller) mehrere Anfragen zur Deutschen Bahn AG und zur Finanzmarktaufsicht. Die Antragsteller verlangten in erster Linie Informationen über Gespräche und Vereinbarungen zwischen der Bundesregierung und der Deutschen Bahn AG über Investitionen in das Schienennetz, über ein von der Bundesregierung in Auftrag gegebenes Gutachten zur Wirtschaftlichkeitsberechnung des Projektes „Stuttgart 21“ sowie über Zugverspätungen und deren Ursachen. Darüber hinaus richteten die Antragsteller Fragen zu aufsichtsrechtlichen Maßnahmen der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gegenüber mehreren Banken in den Jahren 2005 bis 2008 an die Bundesregierung. Diese beantwortete aus Sicht der Antragsteller sämtliche Anfragen nur unzureichend, weshalb sie im Organstreitverfahren die Feststellung begehren, dass die Bundesregierung die von ihnen erbetenen Auskünfte unter Berufung auf verfassungsrechtlich nicht tragfähige Erwägungen verweigert oder nur unzureichend beantwortet und sie sowie den Deutschen Bundestag in den Rechten aus Art. 38 Abs. 1 Satz 2 und Art. 20 Abs. 2 Satz 2 GG verletzt hat.
Wesentliche Erwägungen des Senats:
Die Anträge sind - soweit zulässig - überwiegend begründet.
1. a) Dem Deutschen Bundestag steht gegenüber der Bundesregierung ein Frage- und Informationsrecht zu (Art. 38 Abs. 1 Satz 2 und Art. 20 Abs. 2 Satz 2 GG), an dem die einzelnen Abgeordneten und die Fraktionen als Zusammenschlüsse von Abgeordneten teilhaben und dem grundsätzlich eine Antwortpflicht der Bundesregierung korrespondiert. Die parlamentarische Kontrolle von Regierung und Verwaltung verwirklicht den Grundsatz der Gewaltenteilung, der für das Grundgesetz ein tragendes Funktions- und Organisationsprinzip darstellt. Ohne Beteiligung am Wissen der Regierung kann das Parlament sein Kontrollrecht gegenüber der Regierung nicht ausüben. Daher kommt dem parlamentarischen Informationsinteresse besonders hohes Gewicht zu, soweit es um die Aufdeckung möglicher Rechtsverstöße und vergleichbarer Missstände innerhalb von Regierung und Verwaltung geht. Die Kontrollfunktion ist zugleich Ausdruck der aus dem Demokratieprinzip folgenden Verantwortlichkeit der Regierung gegenüber dem Parlament.
b) Das parlamentarische Informationsrecht steht unter dem Vorbehalt der Zumutbarkeit. Es sind alle Informationen mitzuteilen, über die die Bundesregierung verfügt oder die sie mit zumutbarem Aufwand in Erfahrung bringen kann. Sie muss alle ihr zu Gebote stehenden Möglichkeiten der Informationsbeschaffung ausschöpfen.
c) Der parlamentarische Informationsanspruch ist auf Beantwortung gestellter Fragen in der Öffentlichkeit angelegt. Verhandeln von Argument und Gegenargument, öffentliche Debatte und öffentliche Diskussion sind wesentliche Elemente des demokratischen Parlamentarismus. Berechtigte Geheimhaltungsinteressen der Regierung oder Grundrechte Betroffener können aber die Prüfung gebieten, ob bestimmte Vorkehrungen parlamentarischer Geheimhaltung erforderlich sind. Auch die Beantwortung parlamentarischer Anfragen unter Anwendung der Geheimschutzordnung kann geeignet sein, als milderes Mittel einen angemessenen Ausgleich zwischen dem Fragerecht der Abgeordneten und anderen schützenswerten Rechtsgütern zu schaffen.
2. Das verfassungsrechtlich garantierte parlamentarische Frage- und Informationsrecht unterliegt gleichwohl Grenzen, die, auch soweit sie einfachgesetzlich geregelt sind, ihren Grund im Verfassungsrecht haben müssen. So kann sich der Informationsanspruch des Bundestages und der einzelnen Abgeordneten von vornherein nur auf Angelegenheiten beziehen, die in die Zuständigkeit der Bundesregierung fallen und für die sie verantwortlich ist. Weitere Grenzen des Informationsrechts können sich im vorliegenden Fall durch Grundrechte Dritter oder dem Wohl des Bundes oder eines Landes (Staatswohl) ergeben.
3. Die Bundesregierung muss im Falle einer Auskunftsverweigerung die Gründe darlegen, aus denen sie die erbetenen Auskünfte verweigert oder in nicht öffentlicher Form erteilt. Einer besonderen Begründungspflicht unterliegt die Bundesregierung, soweit sie ihre Antwort eingestuft in der Geheimschutzstelle des Deutschen Bundestages zur Verfügung stellt. Es ist Aufgabe der Bundesregierung, nachvollziehbar darzulegen, aus welchem Grund die angeforderten Informationen geheimhaltungsbedürftig sind und warum sie gegebenenfalls auch noch nach Jahren oder sogar nach Abschluss des betreffenden Vorgangs nicht Gegenstand einer öffentlichen Antwort sein können.
4. Die Bundesregierung hat die Grenzen ihrer Antwortpflicht bei der Beantwortung der streitgegenständlichen Fragen betreffend den Themenkomplex Deutsche Bahn AG verkannt und hierdurch Rechte der Antragsteller und des Deutschen Bundestages aus Art. 38 Abs. 1 Satz 2 und Art. 20 Abs. 2 Satz 2 GG verletzt.
a) Die Tätigkeiten von mehrheitlich oder vollständig in der Hand des Bundes befindlichen Unternehmen in Privatrechtsform unterfallen dem Verantwortungsbereich der Bundesregierung. Dies ergibt sich aus der Legitimationsbedürftigkeit erwerbswirtschaftlicher Betätigung der öffentlichen Hand. Dabei ist die Verantwortlichkeit der Regierung nicht auf die ihr gesetzlich eingeräumten Einwirkungs- und Kontrollrechte beschränkt. Bei dem derzeitigen Stand der Verflechtung von Staat und Deutscher Bahn AG ist daher der Verantwortungsbereich der Bundesregierung im Rahmen des parlamentarischen Fragerechts eröffnet. Denn solange der Bund eine Gewährleistungsverantwortung sowohl für die Schienenwege als auch für die Verkehrsangebote trägt und zugleich als Alleineigentümer der Deutschen Bahn AG deren Geschäftspolitik zumindest bis zu einem gewissen Grade beeinflussen kann, kann er nicht von jedweder Verantwortung für die Unternehmensführung freigestellt werden.
b) Grundrechte der Deutschen Bahn AG, namentlich der Schutz ihrer Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse (Art. 12 Abs. 1 oder Art. 14 Abs. 1 GG) stehen der Auskunftserteilung nicht entgegen. Juristischen Personen des Privatrechts, deren Anteile sich - wie bei der Deutschen Bahn AG - ausschließlich in den Händen des Staates befinden, fehlt die Grundrechtsfähigkeit im Hinblick auf materielle Grundrechte. Der Umstand, dass künftig hinter der Deutschen Bahn AG private Anteilseigner, also grundrechtsfähige natürliche Personen, stehen können, zeitigt keine Vorwirkung auf die derzeitige Rechtslage. Auch Art. 87e GG stattet die Deutsche Bahn AG nicht mit eigenen Rechten gegenüber anderen staatlichen Stellen aus; ihr wird kein abwehrrechtlicher Status gegenüber Einwirkungen des Staates auf ihre Unternehmensführung verschafft.
c) Die Offenlegung von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen des in öffentlicher Hand befindlichen Unternehmens kann Auswirkungen auf den Wert der gehaltenen Anteile oder auf das Geschäftsergebnis haben. Als fiskalisches Interesse des Staates können damit Staatswohlbelange berührt sein.
d) Vor diesem Hintergrund hat die Bundesregierung bei der Beantwortung der streitgegenständlichen Fragen ihrer Antwortpflicht in Bezug auf die Anfragen „Fulda-Runden der Deutschen Bahn AG und Finanzierungsvereinbarungen zu Bedarfsplanprojekten“ (BTDrucks 17/3757) nicht genügt, da sie die Antwort nicht durch Verweis auf die Nichtexistenz jährlich und einheitlich erstellter Listen, die Nichtexistenz von Statistiken zur Höhe der vom Bund finanzierten zuwendungsfähigen Kosten sowie die aktienrechtlichen Verschwiegenheitspflichten verweigern kann. Auch die Antwortverweigerung auf die Kleine Anfrage zur Wirtschaftlichkeitsberechnung für das Projekt „Stuttgart 21“ (BTDrucks 17/3766) konnte die Bundesregierung nicht mit Verweis auf die berufsständische Verschwiegenheitspflicht der Wirtschaftsprüfer nach § 43 der WiPrO sowie der mit der Deutschen Bahn AG abgeschlossenen Vertraulichkeitsvereinbarung begründen. In Bezug auf die Kleine Anfrage „Zugverspätungen“ (BTDrucks 17/3149) durfte die Bundesregierung die Antwort nicht mit der Begründung verweigern, die erfragten Informationen gehörten vollständig in den Bereich der Geschäftstätigkeiten der Deutschen Bahn AG, da aufgrund der hundertprozentigen Beteiligung des Bundes die unternehmerische Tätigkeit der Deutschen Bahn AG in den Verantwortungsbereich der Bundesregierung fällt.
5. Auch hinsichtlich des Themenkomplexes Finanzmarktaufsicht hat die Bundesregierung die Grenze ihrer Antwortpflicht bei der Beantwortung der streitgegenständlichen Fragen überwiegend verkannt und hierdurch Rechte der Antragsteller aus Art. 38 Abs. 1 Satz 2 und Art. 20 Abs. 2 Satz 2 GG verletzt.
a) Der Verantwortungsbereich der Bundesregierung erstreckt sich auf die Finanzmarktaufsicht und auf von ihr beherrschte Finanzinstitute, so dass sich der Informationsanspruch des Bundestages und der einzelnen Abgeordneten hierauf beziehen kann. Allerdings kann die Funktionsfähigkeit staatlicher Aufsicht über Finanzinstitute als Belang des Staatswohls die Antwortpflicht der Bundesregierung beschränken. Zwar bedarf es zur Geltendmachung eines Geheimhaltungsgrundes keiner im Einzelfall belegbaren Gefährdung der Kontroll- und Aufsichtstätigkeit der Behörde. Erschwerungen der behördlichen Aufgabenwahrnehmung oder nicht auf konkreten Tatsachen beruhende Annahmen eines möglichen Rückgangs der Kooperationsbereitschaft und der freiwilligen Mitarbeit der beaufsichtigten Unternehmen als Folge der Bekanntgabe der Informationen genügen aber nicht. Sollten die gesetzlichen Befugnisse der BaFin nicht ausreichen, um ihrer Aufgabe als Aufsichtsbehörde hinreichend nachzukommen, und sollte sie daher tatsächlich zwingend auf die freiwillige und überobligatorische Preisgabe von Informationen durch die beaufsichtigten Finanzinstitute angewiesen sein, so wäre hier jedenfalls gesetzgeberisch nachzusteuern.
b) Die Stabilität des Finanzmarktes und der Erfolg staatlicher Stützungsmaßnahmen in der Finanzkrise setzen als Belange des Staatswohls dem parlamentarischen Informationsanspruch Grenzen. Charakteristisch für den Finanzmarkt ist, dass Fehlentwicklungen, denen die Aufsicht vorbeugen soll, nicht nur das einzelne Institut, sondern in besonderem Maße den Markt insgesamt betreffen. Trotz des Einschätzungs- und Prognosespielraums der Bundesregierung hinsichtlich der Abgeschlossenheit der Finanzkrise und der in diesem Zusammenhang ergriffenen Maßnahmen sowie des Ausmaßes der mit einer Offenlegung einhergehenden Beeinträchtigung, insbesondere der ins Feld geführten irrationalen Reaktionen der hoch sensiblen Märkte, kann dies nicht dazu führen, dass Transparenz und demokratische Kontrolle während der Finanzkrise uneingeschränkt hintenan stehen müssen und gleichzeitig dieses Argument auf lange Zeit fortwirkt. Allerdings hat der Bund im Zuge der Finanzkrise unter Aufwendung von Steuergeldern in Milliardenhöhe Zuwendungen an Finanzinstitute vergeben, um das Banken- und Finanzsystem zu stabilisieren und vor einer existenzgefährdenden Entwicklung zu bewahren. Diese Zielsetzung könnte konterkariert werden, wenn ein Institut durch Preisgabe sensibler Informationen wirtschaftliche Nachteile erleidet oder gar in seiner Existenz bedroht wird.
c) Vor diesem Hintergrund hat die Bundesregierung bei der Beantwortung der streitgegenständlichen Fragen ihrer Antwortpflicht auch in Bezug auf die Anfragen zur IKB/Finanzmarktaufsicht (BTDrucks 17/4350) nicht genügt. Sie kann mit dem schlichten Verweis auf vertragliche und gesetzliche Verschwiegenheitspflichten und dem Hinweis, an anderer Stelle und zu einem anderen Zeitpunkt geheim berichtet zu haben, oder nach einem Beschluss des Deutschen Bundestages die Informationen nach VS-Eintrag in der Geheimschutzstelle des Deutschen Bundestages zu hinterlegen, die Antwort nicht verweigern. Die Bundesregierung hat auch ihrer Antwortpflicht hinsichtlich der Kleinen Anfrage „Ausübung parlamentarischer Kontrollrechte im Bereich Finanzmarkt“ (BTDrucks 17/3740) überwiegend nicht genügt. Allein die nicht näher begründete Annahme, schon das Bekanntwerden der Kontrollintensität der Bankenaufsicht im Hinblick auf einzelne Institute könne zu einem irreversiblen Vertrauensverlust in das jeweilige Institut mit entsprechenden Reaktionen des Marktes führen, kann in dieser Pauschalität eine Antwortverweigerung nicht begründen. In diesem Fall wäre die Tätigkeit der BaFin der parlamentarischen Kontrolle vollständig entzogen. Es liegen auch keine konkreten Anhaltspunkte dafür vor, dass die Kenntnis der Öffentlichkeit von Aufsichtsmaßnahmen der Jahre 2005 bis 2008 bei bekanntermaßen in Schieflage geratenen und gestützten Instituten noch Ende 2010 / Anfang 2011 tatsächlich zu negativen Reaktionen auf den Märkten hätte führen können. Zudem hat die Antragsgegnerin zu Unrecht die Antwort auf die Frage zu den Gehalts- und Bonuszahlungen über 500.000 Euro bei gestützten Finanzinstituten nur eingestuft erteilt, denn das parlamentarische Interesse an einer öffentlichen Antwort mit dem Ziel der Kontrolle der Mitarbeitervergütung bei gestützten Finanzinstituten und damit der Verwendung von Steuermitteln überwiegt das Interesse an der Geheimhaltung dieser Informationen. Lediglich in Bezug auf die Risikobewertung (Zwölf-Felder-Matrix) später gestützter Finanzinstitute in den Jahren 2005 bis 2008 hat die Bundesregierung die Antwort berechtigterweise in der Geheimschutzstelle des Deutschen Bundestages zur Verfügung gestellt. Eine Information der Öffentlichkeit durch Offenlegung der Risikoeinstufung nur einiger Institute kann die Gefahr begründen, dass der Markt mangels weiterer Anhaltspunkte jede Einstufung unterhalb der höchsten Stufe als negativ ansehen könnte.
Die Staatsanwaltschaft München II darf die bei der Rechtsanwaltskanzlei Jones Day sichergestellten Unterlagen vorerst nicht auswerten
Pressemitteilung Nr. 62/2017 vom 26. Juli 2017
Beschlüsse vom 25. Juli 2017 - 2 BvR 1287/17, 2 BvR 1583/17, 2 BvR 1405/17, 2 BvR 1562/17
Die Staatsanwaltschaft München II führt im Zuge des sogenannten „VW-Dieselskandals“ ein Ermittlungsverfahren gegen Unbekannt und durchsuchte im März 2017 die Münchener Büroräume der von der Volkswagen AG mandatierten Rechtsanwaltskanzlei Jones Day. Mit heute veröffentlichten Beschlüssen hat die 3. Kammer des Zweiten Senats des Bundesverfassungsgerichts im Wege der einstweiligen Anordnung die Staatsanwaltschaft München II angewiesen, die im Rahmen der Durchsuchung sichergestellten Unterlagen und Daten beim Amtsgericht München zu hinterlegen und einstweilen nicht auszuwerten. Die Entscheidungen der Kammer beruhen auf einer Folgenabwägung.
Sachverhalt:
Anlässlich eines in den USA geführten strafrechtlichen Ermittlungsverfahrens wegen Abgasmanipulationen an Dieselfahrzeugen beauftragte die Volkswagen AG die Rechtsanwaltskanzlei Jones Day im September 2015 mit internen Ermittlungen, rechtlicher Beratung und der Vertretung gegenüber den US-amerikanischen Strafverfolgungsbehörden. Zum Zwecke der Sachaufklärung sichteten die Rechtsanwälte von Jones Day innerhalb des Volkswagen-Konzerns eine Vielzahl von Dokumenten und führten konzernintern über 700 Befragungen von Mitarbeitern durch. Mit dem Mandat waren auch Rechtsanwälte aus dem Münchener Büro der Kanzlei Jones Day befasst.
Die Staatsanwaltschaft München II führt wegen der Vorgänge im Zusammenhang mit den 3,0 Liter-Dieselmotoren der Audi AG ein Ermittlungsverfahren wegen Betruges und strafbarer Werbung, das sich bislang gegen Unbekannt richtet. Auf ihren Antrag ordnete das Amtsgericht München die Durchsuchung der Münchener Geschäftsräume der Kanzlei Jones Day an. Im Rahmen der Durchsuchung am 15. März 2017 wurden zahlreiche Aktenordner sowie ein umfangreicher Bestand an elektronischen Daten mit den Ergebnissen der internen Ermittlungen sichergestellt. Die Beschwerden der Volkswagen AG, der Rechtsanwaltskanzlei Jones Day sowie der sachbearbeitenden Rechtsanwälte aus dem Münchener Büro gegen die Durchsuchungsanordnung und die Bestätigung der Sicherstellung waren erfolglos. Mit ihren Verfassungsbeschwerden rügen die Beschwerdeführer vornehmlich die Verletzung ihrer Rechte aus Art. 13 Abs. 1, Art. 12 Abs. 1 und Art. 2 Abs. 1 i.V.m. Art. 1 Abs. 1 GG und begehren mit den Anträgen auf Erlass einer einstweiligen Anordnung, die Auswertung der sichergestellten Unterlagen und Daten bis zu einer Entscheidung über die eingelegten Verfassungsbeschwerden einstweilen auszusetzen.
Wesentliche Erwägungen der Kammer:
1. Das Bundesverfassungsgericht kann einen Zustand durch einstweilige Anordnung vorläufig regeln, wenn dies zur Abwehr schwerer Nachteile, zur Verhinderung drohender Gewalt oder aus einem anderen wichtigen Grund zum gemeinen Wohl dringend geboten ist (§ 32 Abs. 1 BVerfGG). Die Erfolgsaussichten in der Hauptsache haben außer Betracht zu bleiben, es sei denn, der in der Hauptsache gestellte Antrag erwiese sich als von vornherein unzulässig oder offensichtlich unbegründet. Bei offenem Ausgang des Hauptsacheverfahrens muss das Bundesverfassungsgericht eine Folgenabwägung vornehmen.
2. Die Verfassungsbeschwerden sind weder von vornherein unzulässig noch offensichtlich unbegründet. Im Rahmen der somit erforderlichen Folgenabwägung überwiegen die Gründe für den Erlass der einstweiligen Anordnungen.
a) Erginge die einstweilige Anordnung nicht, erwiese sich die Verfassungsbeschwerde später aber als begründet, könnte die Staatsanwaltschaft in der Zwischenzeit eine Auswertung des sichergestellten Materials vornehmen. Dieser Zugriff der Strafverfolgungsbehörden könnte nicht nur zu einer - möglicherweise irreparablen - Beeinträchtigung des rechtlich geschützten Vertrauensverhältnisses zwischen der Volkswagen AG einerseits und der Rechtsanwaltskanzlei Jones Day und damit auch den sachbearbeitenden Rechtsanwälten führen. Auch andere Mandanten, die mit dem Ermittlungsverfahren in keinem Zusammenhang stehen, könnten im Falle einer Auswertung - zumal angesichts der medialen Aufmerksamkeit, die dem Fall zukommt - ihre Geschäftsgeheimnisse und persönlichen Daten bei der Rechtsanwaltskanzlei Jones Day in Unsicherheit wähnen und deshalb ihre Aufträge zurückziehen. Dies hätte unmittelbare Folgen auch für die berufliche Tätigkeit der sachbearbeitenden Rechtsanwälte. Darüber hinaus könnte die Staatsanwaltschaft durch die Auswertung Kenntnis von Informationen erlangen, die allesamt aufgrund des von der Volkswagen AG erteilten Mandats in die Sphäre der Rechtsanwaltskanzlei Jones Day gelangt sind und über deren Preisgabe sie als Auftraggeberin bisher selbst entscheiden konnte. Zudem könnten durch die Auswertung auch persönliche Daten unbeteiligter Dritter, insbesondere von Mitarbeitern der Volkswagen AG oder ihrer Tochtergesellschaften wie etwa der Audi AG, zur Kenntnis der Strafverfolgungsbehörden gelangen.
b) Erginge dagegen die einstweilige Anordnung, erwiesen sich die Verfassungsbeschwerden später jedoch als unbegründet, würde damit lediglich eine Verzögerung der staatsanwaltlichen Ermittlungen für eine begrenzte Zeitspanne einhergehen. Ein Beweisverlust hinsichtlich der Informationen aus dem sichergestellten Material wäre nicht zu befürchten.
c) Bei Abwägung der jeweiligen Folgen wiegen die möglichen Nachteile für die Beschwerdeführer schwerer als die durch den Erlass der einstweiligen Anordnung eintretende vorübergehende Beschränkung der staatlichen Strafverfolgung.
Gegen presserechtliche Unterlassungsanordnungen kann in Ausnahmefällen unmittelbar Verfassungsbeschwerde erhoben werden
Pressemitteilung Nr. 61/2017 vom 25. Juli 2017
Beschluss vom 06. Juni 2017
1 BvQ 16/17, 1 BvR 770/17, 1 BvR 764/17, 1 BvQ 17/17
Mit ihren Verfassungsbeschwerden und den damit verbundenen Anträgen auf Erlass einer einstweiligen Anordnung erstrebt die Beschwerdeführerin die einstweilige Einstellung der Zwangsvollstreckung von Unterlassungsverfügungen wegen Veröffentlichungen im Nachrichtenmagazin „Der Spiegel“. Die Beschwerdeführerin macht geltend, dass ihr vor Erlass der Unterlassungsanordnungen vom Landgericht ohne sachlichen Grund und unter bewusster Umgehung ihrer prozessualen Rechte das rechtliche Gehör verwehrt würde. Dieses entspräche ständiger Praxis. Hintergrund dessen sei, dass sich das Landgericht darauf verlasse, dass die Gehörsverletzung wegen Heilung im späteren fachgerichtlichen Verfahren nicht mehr gerügt werden könne. Um diesem Abschneiden der Rügemöglichkeit zu entgehen, richte sich die Verfassungsbeschwerde gegen die Durchsetzung der Unterlassungsverfügungen auf der Ebene des Zwangsvollstreckungsrechts. Mit dem heute veröffentlichten Beschluss hat die 3. Kammer des Ersten Senats des Bundesverfassungsgerichts die Verfassungsbeschwerden nicht zur Entscheidung angenommen. Zwar könne das von der Beschwerdeführerin gerügte Vorgehen nicht mit einer Verfassungsbeschwerde gegen die Entscheidungen zur Zwangsvollstreckung angegriffen werden. Jedoch kommt insoweit - hinsichtlich der Rüge eines Verstoßes gegen die prozessuale Waffengleichheit und das Recht auf ein faires Verfahren - die Erhebung einer Verfassungsbeschwerde unmittelbar gegen die Unterlassungsverfügung in Betracht. Allerdings ist die insoweit geltende Monatsfrist im vorliegenden Fall bereits abgelaufen.
Sachverhalt:
Die Beschwerdeführerin verlegt unter anderem das Nachrichtenmagazin „Der Spiegel“. Im Dezember 2016 erschienen im „Spiegel“ zwei Beiträge, die sich mit dubiosen Geschäfts- und Steuerpraktiken im Profifußball beschäftigten. In der Januarausgabe 2017 berichtete „Der Spiegel“ über die Zustände in einem Heim für jugendliche Flüchtlinge in Norddeutschland. In beiden Fällen untersagte die Pressekammer des Landgerichts Hamburg auf Antrag der Kläger des Ausgangsverfahrens im Wege der einstweiligen Verfügung die Veröffentlichung und Verbreitung mehrerer Passagen der beanstandeten Artikel. Nach dem Vorbringen der Beschwerdeführerin habe das Landgericht den Antragstellern zuvor Hinweise erteilt. Die Verfügungen ergingen in dem einen Fall dreieinhalb Wochen und in dem anderen Fall fünf Wochen nach Antragstellung beim Landgericht ohne Durchführung einer mündlichen Verhandlung, und somit ohne dass die Beschwerdeführerin Gelegenheit zur Stellungnahme hatte.
Gegen diese Beschlüsse erhob die Beschwerdeführerin Widerspruch und beantragte die einstweilige Einstellung der Zwangsvollstreckung. Das Landgericht Hamburg lehnte diese Anträge mit den hier angegriffenen Beschlüssen ab. Mit ihren Verfassungsbeschwerden rügt die Beschwerdeführerin vornehmlich eine Verletzung ihres rechtlichen Gehörs (Art. 103 Abs. 1 GG) und ihrer Rechte auf prozessuale Waffengleichheit (Art. 3 Abs. 1 GG) sowie auf ein faires Verfahren (Art. 20 Abs. 3 GG). Das Landgericht hat zwischenzeitlich in beiden Verfahren mündlich verhandelt und durch Urteil (§§ 936, 925 Abs. 1 ZPO) entschieden.
Wesentliche Erwägungen der Kammer:
Die Voraussetzungen für die Annahme der Verfassungsbeschwerden liegen nicht vor, da sie unzulässig sind.
1. Soweit sich die Beschwerdeführerin gegen die Ablehnung der einstweiligen Einstellung der Zwangsvollstreckung wendet, haben sich die von ihr unmittelbar angegriffenen Beschlüsse zwischenzeitlich erledigt. Ein fortwirkendes Rechtsschutzinteresse besteht auch nicht unter dem Gesichtspunkt einer Wiederholungsgefahr.
2. Soweit die Verfassungsbeschwerden so auszulegen sind, dass die Beschwerdeführerin mittelbar eine Verletzung ihrer Grundrechte durch die ihrer Ansicht nach prozessrechtswidrig erlassenen Unterlassungsverfügungen selbst rügt, sind die Verfassungsbeschwerden unzulässig.
Hinsichtlich der Rüge der Verletzung rechtlichen Gehörs ist die Verfassungsbeschwerde deshalb unzulässig, weil eine mögliche Grundrechtsverletzung insoweit mittlerweile geheilt ist. Im Rahmen der später vom Landgericht durchgeführten mündlichen Verhandlung ist ihr rechtliches Gehör gewährt worden.
3. Soweit die Beschwerdeführerin demgegenüber eine Verletzung ihrer Rechte auf prozessuale Waffengleichheit und auf ein faires Verfahren rügt, hat sich dies durch die mündlicher Verhandlung vor dem Landgericht nicht erledigt und kommt eine Verfassungsbeschwerde unmittelbar gegen die Unterlassungsverfügung selbst grundsätzlich in Betracht. Dem steht nicht entgegen, dass die geltend gemachten Rechtsverletzungen abgeschlossen sind und durch eine Verfassungsbeschwerde nicht mehr beseitigt werden können. Denn es ist nicht ausgeschlossen, dass eine Verfassungsbeschwerde insoweit auf ein Fortwirken des Feststellungsinteresses gestützt werden kann. Die Verfassungsbeschwerde ist diesbezüglich jedoch verfristet. Da es keine prozessualen Möglichkeiten gibt, die insoweit geltend gemachten Grundrechtsverletzungen einer fachgerichtlichen Kontrolle zu unterziehen, ist Beginn für den Lauf der Verfassungsbeschwerdefrist der Zeitpunkt der Entscheidung über die einstweilige Verfügung. Danach war bei Erhebung der Verfassungsbeschwerde die hierfür geltende Monatsfrist bereits abgelaufen.
mangels Rechtswegerschöpfung erfolglos
Verfassungsbeschwerde auf Bereitstellung von Akten im Gewahrsam Privater mangels Rechtswegerschöpfung erfolglos
Pressemitteilung Nr. 58/2017 vom 12. Juli 2017
Beschluss vom 20. Juni 2017
1 BvR 1978/13
Durch heute veröffentlichten Beschluss hat der Erste Senat des Bundesverfassungsgerichts eine Verfassungsbeschwerde verworfen, die sich gegen die Versagung der Bereitstellung von Akten nach dem Informationsfreiheitsgesetz richtet, wenn diese sich im Besitz privater Dritter, insbesondere in Archiven der Stiftungen politischer Parteien, befinden. Wenn die Akten nie an das Bundesarchiv gelangt sind, muss sich die Beschwerdeführerin zunächst an die für die Aktenführung zuständige Behörde halten und gegebenenfalls dieser gegenüber den Rechtsweg erschöpfen. Denn wichtige einfachrechtliche Fragen des mit der Verfassungsbeschwerde geltend gemachten Informationszugangsrechts sind bislang ungeklärt.
Sachverhalt:
Die Beschwerdeführerin ist Journalistin und Historikerin. Sie befasste sich mit den von der Bundesrepublik Deutschland in der Zeit von 1961 bis 1965 an Israel geleisteten finanziellen Wiedergutmachungen in Höhe von insgesamt 630 Millionen DM und der in diesem Zusammenhang geheim vereinbarten, sogenannten Aktion „Geschäftsfreund“. Das hierzu verwendete Steuergeld soll ohne parlamentarische Legitimation und Kabinettsbeschluss ausgezahlt worden sein. Im Rahmen ihrer Recherchen war die Beschwerdeführerin der Auffassung, dass hierzu Akten der Bundesregierung existieren, die vom Bundeskanzleramt für die Bundesregierung geführt worden waren. Diese teilweise als Verschlusssachen gekennzeichneten Akten sollen in den Besitz zweier privater Stiftungen gelangt sein. Die Beschwerdeführerin wandte sich an beide Einrichtungen mit der Bitte um Einsichtnahme; beide Institutionen lehnten dies jedoch ab.
Die Beschwerdeführerin wandte sich daraufhin an das Bundesarchiv mit dem Antrag, die amtlichen Unterlagen bereitzustellen und der Beschwerdeführerin Einsicht in diese zu gewähren. Der Präsident des Bundesarchivs teilte ihr mit, dass das Bundesarchiv nur solche Unterlagen bereitstellen könne, die bei ihm lagerten, und dies bei den von ihr begehrten Unterlagen nicht der Fall sei. Die Beschwerdeführerin verfolgte ihr Begehren gegenüber dem Bundesarchiv weiter und erhob Klage gegen die Bundesrepublik Deutschland mit dem Antrag, die Bundesrepublik zu verpflichten, sämtliche amtlichen Unterlagen bereitzustellen und ihr die Erlaubnis zur Einsichtnahme zu erteilen. Die Klage blieb vor dem Verwaltungsgericht und Oberverwaltungsgericht ohne Erfolg; die Beschwerde gegen die Nichtzulassung der Revision wies das Bundesverwaltungsgericht zurück. Mit ihrer gegen die verwaltungsgerichtlichen Entscheidungen gerichteten Verfassungsbeschwerde rügt die Beschwerdeführerin im Wesentlichen eine Verletzung der Informationsfreiheit (Art. 5 Abs. 1 Satz 1, Halbsatz 2 GG).
Wesentliche Erwägungen des Senats:
Die Verfassungsbeschwerde ist unzulässig; sie genügt nicht den Anforderungen an den Grundsatz der Subsidiarität (§ 90 Abs. 2 Satz 1 BVerfGG). Danach muss ein Beschwerdeführer vor dem Anrufen des Bundesverfassungsgerichts zunächst die ihm zur Verfügung stehenden Möglichkeiten ergreifen, um die geltend gemachte Grundrechtsverletzung im sachnächsten Verfahren zu verhindern oder zu beseitigen.
1. Die Beschwerdeführerin hat es versäumt, zur Durchsetzung des von ihr begehrten Informationszugangs nach § 1 Abs. 1 Satz 1 des Informationsfreiheitsgesetzes des Bundes (IFG) zunächst einen Antrag an das Bundeskanzleramt zu stellen, in dessen Zuständigkeit die Akten geführt wurden. Ein solcher Antrag ist nicht deshalb entbehrlich, weil die Beschwerdeführerin stattdessen einen Antrag an das Bundesarchiv gestellt hat. Die Akten haben dem Bundesarchiv nie vorgelegen und sind nicht zu Archivgut geworden. Ein entsprechender Antrag hat sich auch nicht durch das nachfolgende Klageverfahren erübrigt. Gegenstand des verwaltungsgerichtlichen Verfahrens war allein der Antrag an das Bundesarchiv und dessen Verpflichtung, die begehrten Unterlagen zugänglich zu machen.
2. Das Bundesverfassungsgericht kann zwar vor Erschöpfung des Rechtswegs über eine Verfassungsbeschwerde entscheiden, wenn sie von allgemeiner Bedeutung ist. Dies kommt grundsätzlich jedoch dann nicht in Betracht, wenn die Ausschöpfung des fachgerichtlichen Rechtswegs eine für den Fall maßgebliche Klärung einfachrechtlicher Vorfragen oder die Feststellung auch für die verfassungsrechtliche Beurteilung erheblicher Tatsachen erwarten lässt. So liegt es hier in Bezug auf die Reichweite des Informationszugangsanspruchs (§ 1 Abs. 1 Satz 1 IFG).
a) Die Informationsfreiheit (Art. 5 Abs. 1 Satz 1, Halbsatz 2 GG) schützt den Zugang zu allgemein zugänglichen Informationsquellen. Allgemein zugänglich ist eine Informationsquelle dann, wenn sie geeignet und bestimmt ist, der Allgemeinheit, also einem individuell nicht bestimmbaren Personenkreis, Informationen zu verschaffen. Das Grundrecht gewährleistet insoweit grundsätzlich nur das Recht, sich ungehindert aus einer solchen für die allgemeine Zugänglichkeit bestimmten Quelle zu unterrichten. Fehlt es an dieser Bestimmung, ist die Informationsbeschaffung in der Regel nicht vom Grundrecht der Informationsfreiheit geschützt. Dementsprechend umfasst das Grundrecht ein gegen den Staat gerichtetes Recht auf Informationszugang jedenfalls dann, wenn eine im staatlichen Verantwortungsbereich liegende Informationsquelle auf Grund rechtlicher Vorgaben zur öffentlichen Zugänglichkeit bestimmt ist.
b) § 1 Abs. 1 Satz 1 IFG eröffnet grundsätzlich einen Anspruch auf Zugang zu amtlichen Informationen aus allgemein zugänglichen Quellen im Sinne der Informationsfreiheit. Soweit das Informationsfreiheitsgesetz nicht bestimmte Bereiche schon als solche aus dem Zugangsanspruch ausnimmt, ergibt sich aus ihm die Entscheidung des Gesetzgebers, dass amtliche Informationen der Öffentlichkeit grundsätzlich zugänglich sein sollen. Dass der Zugangsanspruch nach Maßgabe solcher Einzelfallentscheidung unter Umständen hinter anderen Belangen zurücktreten muss, steht dem nicht entgegen. Aus der Charakterisierung der Informationen als allgemein zugängliche Quellen folgt nicht, dass ihre Zugänglichkeit auch im Ergebnis ohne weiteres gewährleistet ist. Vielmehr können Zugangsansprüche für verschiedene Verwaltungsangelegenheiten im Ergebnis auch weitflächig und nicht nur ausnahmsweise versagt werden.
c) Für die hier in Frage stehende Konstellation, in der sich die begehrten Informationen nicht unmittelbar bei der Behörde selbst, sondern bei einer privaten Stiftung befinden, regelt das Informationsfreiheitsgesetz indes nicht ausdrücklich, ob auch insoweit der Zugang zu den Akten eröffnet sein soll. Zwar ergibt sich aus dem Gesetz, dass es keinen allgemeinen Beschaffungsanspruch von Akten begründet, die nicht in den Bestand der Behörden gelangt sind. Ungeklärt ist indes, ob das auch für die Frage der Wiederbeschaffung von Akten gilt, die bei der Behörde angefallen waren und dann in den Gewahrsam Privater gelangt sind.
aa) Ob das Informationsfreiheitsgesetz in solchen Fällen Informationszugang gewährt, ist nicht von vornherein ausgeschlossen und bedarf fachgerichtlicher Klärung.
Das Informationsfreiheitsgesetz ordnet für bestimmte Konstellationen selbst an, dass auch den Behörden nicht unmittelbar selbst vorliegende Informationen einbezogen werden. Auch wird eine Pflicht zur Wiederbeschaffung von Akten in Literatur und Fachrechtsprechung etwa dann anerkannt, wenn die informationspflichtige Stelle Unterlagen an Dritte ausgeliehen hat oder wenn die informationspflichtige Stelle sie in Kenntnis eines geltend gemachten Informationsbegehrens aus der Hand gibt. Eine Wiederbeschaffungspflicht liegt damit nicht von vornherein außerhalb des gesetzlichen Rahmens.
Bei den von der Beschwerdeführerin begehrten Informationen soll es sich um Dokumente handeln, die im Rahmen staatlicher Aufgabenwahrnehmung angelegt worden sind und als Akten des Bundeskanzleramts geführt wurden. Durch die Übergabe an private Einrichtungen hätten diese Dokumente dann den Charakter amtlicher Unterlagen nicht verloren und könnten diese jedenfalls dem Grundsatz nach herausfordert werden.
Durch die Entscheidung, eine Akte von einer privaten Einrichtung herauszufordern oder nicht, bestimmt der Bund im Ergebnis darüber mit, wer Zugang zu den Akten erhalten kann und wer nicht. Der Bund ist hierbei durch Art. 3 GG gebunden. Dem ist auch bei der Auslegung des § 1 Abs. 1 IFG Rechnung zu tragen. Es bedarf insoweit einer Auslegung, die für den Zugang zu den Informationen weder eine ungerechtfertigte Ungleichbehandlung zwischen den verschiedenen Zugangsinteressierten untereinander begründet, noch zwischen den Zugangsinteressierten und der jeweiligen privaten Einrichtung, an die die Informationen gelangt sind.
bb) Ob unter diesen Gesichtspunkten einfachrechtlich ein Anspruch der Beschwerdeführerin gegeben und ob der Schutzbereich der Informationsfreiheit eröffnet ist, haben die Fachgerichte noch nicht entschieden. Zwar haben sie einen Anspruch der Beschwerdeführerin insoweit verneint, als es um den von der Beschwerdeführerin geltend gemachten Anspruch gegenüber dem Bundesarchiv ging, welches die Akten nie in Gewahrsam hatte. Demgegenüber wurde die Frage einer möglichen Wiederbeschaffungspflicht der Akten durch die Behörde, bei der diese angefallen waren und die für diese zuständig ist, nicht in die gerichtliche Prüfung einbezogen. Nach dem Grundsatz der Subsidiarität sind diese Fragen zunächst von den Fachgerichten zu klären. Gegebenenfalls haben diese auch weitere Feststellungen zu dem tatsächlichen Charakter der in Frage stehenden Dokumente zu treffen, die sie bisher offenlassen konnten.
3. Wenn § 1 Abs. 1 IFG nach fachgerichtlicher Auslegung den von der Beschwerdeführerin geltend gemachten Anspruch auf Zugangsverschaffung zu den begehrten Informationen deckt, steht dieser Informationszugang unter dem Schutz der Informationsfreiheit und bedarf es für die nähere Bestimmung dieses Anspruchs einer Auslegung der maßgeblichen Vorschriften des Informationsfreiheitsgesetzes im Lichte der grundrechtlich gewährleisteten Informationsfreiheit. Dabei ist der Bedeutung der allgemeinen Zugänglichkeit der Quellen das ihr für die Freiheitswahrnehmung des Einzelnen wie für die Kommunikation im demokratischen Verfassungsstaat zukommende Gewicht beizumessen und mit entgegenstehenden Belangen in einen vertretbaren Ausgleich zu bringen.
Das Tarifeinheitsgesetz ist weitgehend mit dem Grundgesetz vereinbar
Pressemitteilung Nr. 57/2017 vom 11. Juli 2017
Urteil vom 11. Juli 2017 - 1 BvR 1571/15, 1 BvR 1588/15, 1 BvR 2883/15, 1 BvR 1043/16, 1 BvR 1477/16
Mit heute verkündetem Urteil hat der Erste Senat des Bundesverfassungsgerichts entschieden, dass die Regelungen des Tarifeinheitsgesetzes weitgehend mit dem Grundgesetz vereinbar sind. Die Auslegung und Handhabung des Gesetzes muss allerdings der in Art. 9 Abs. 3 GG grundrechtlich geschützten Tarifautonomie Rechnung tragen; über im Einzelnen noch offene Fragen haben die Fachgerichte zu entscheiden. Unvereinbar ist das Gesetz mit der Verfassung nur insoweit, als Vorkehrungen dagegen fehlen, dass die Belange der Angehörigen einzelner Berufsgruppen oder Branchen bei der Verdrängung bestehender Tarifverträge einseitig vernachlässigt werden. Der Gesetzgeber muss insofern Abhilfe schaffen. Bis zu einer Neuregelung darf ein Tarifvertrag im Fall einer Kollision im Betrieb nur verdrängt werden, wenn plausibel dargelegt ist, dass die Mehrheitsgewerkschaft die Belange der Angehörigen der Minderheitsgewerkschaft ernsthaft und wirksam in ihrem Tarifvertrag berücksichtigt hat. Das Gesetz bleibt mit dieser Maßgabe ansonsten weiterhin anwendbar. Die Neuregelung ist bis zum 31. Dezember 2018 zu treffen.
Die Entscheidung ist teilweise mit Gegenstimmen ergangen; zwei Mitglieder des Senats haben ein Sondervotum abgegeben.
Sachverhalt:
Das Tarifeinheitsgesetz regelt Konflikte im Zusammenhang mit der Geltung mehrerer Tarifverträge in einem Betrieb. Es ordnet an, dass im Fall der Kollision der Tarifvertrag derjenigen Gewerkschaft verdrängt wird, die weniger Mitglieder im Betrieb hat, und sieht ein gerichtliches Beschlussverfahren zur Feststellung dieser Mehrheit vor. Der Arbeitgeber muss die Aufnahme von Tarifverhandlungen den anderen tarifzuständigen Gewerkschaften bekannt geben und diese mit ihren tarifpolitischen Forderungen anhören. Wird ihr Tarifvertrag im Betrieb verdrängt, hat die Gewerkschaft einen Anspruch auf Nachzeichnung des verdrängenden Tarifvertrags.
Mit den nun entschiedenen Verfassungsbeschwerden wenden sich Berufsgruppengewerkschaften, Branchengewerkschaften, ein Spitzenverband sowie ein Gewerkschaftsmitglied unmittelbar gegen das Tarifeinheitsgesetz und rügen vornehmlich eine Verletzung der Koalitionsfreiheit (Art. 9 Abs. 3 GG).
Wesentliche Erwägungen des Senats:
1. a) Das Grundrecht aus Art. 9 Abs. 3 GG ist in erster Linie ein Freiheitsrecht. Es schützt alle koalitionsspezifischen Verhaltensweisen, insbesondere die Tarifautonomie und Arbeitskampfmaßnahmen, die auf den Abschluss von Tarifverträgen gerichtet sind. Das Grundrecht vermittelt jedoch kein Recht auf absolute tarifpolitische Verwertbarkeit von Schlüsselpositionen und Blockademacht zum eigenen Nutzen. Art. 9 Abs. 3 GG enthält auch keine Bestandsgarantie für einzelne Koalitionen. Allerdings wird die Koalitionsfreiheit ausdrücklich für jedermann und alle Berufe garantiert. Daher wären staatliche Maßnahmen mit Art. 9 Abs. 3 GG unvereinbar, die gerade darauf zielten, bestimmte Gewerkschaften aus dem Tarifgeschehen heraus zu drängen oder bestimmten Gewerkschaftstypen, wie etwa Berufsgewerkschaften, generell die Existenzgrundlage zu entziehen. Darüber hinaus ist die Selbstbestimmung über die innere Ordnung ein wesentlicher Teil der Koalitionsfreiheit. Das umfasst die Entscheidung über das eigene Profil auch durch Abgrenzung nach Branchen, Fachbereichen oder Berufsgruppen; bestimmte Vorgaben hierzu wären unzulässig.
b) Die Regelung zur Verdrängung eines Tarifvertrags im Kollisionsfall greift in die Koalitionsfreiheit ein. Sie kann außerdem grundrechtsbeeinträchtigende Vorwirkungen entfalten. Denn sowohl die drohende Verdrängung des eigenen Tarifvertrags als auch die gerichtliche Feststellung, in einem Betrieb in der Minderheit zu sein, können eine Gewerkschaft bei der Mitgliederwerbung und der Mobilisierung ihrer Mitglieder für Arbeitskampfmaßnahmen schwächen und Entscheidungen zur tarifpolitischen Ausrichtung und Strategie beeinflussen. Beeinflusst wird auch die grundrechtlich geschützte Entscheidung, ob und inwieweit mit anderen Gewerkschaften kooperiert wird und welches Profil sich eine Gewerkschaft gibt.
Dagegen wird das in Art. 9 Abs. 3 GG geschützte Recht, mit den Mitteln des Arbeitskampfes auf den jeweiligen Gegenspieler Druck und Gegendruck ausüben zu können, um zu einem Tarifabschluss zu gelangen, durch das Tarifeinheitsgesetz nicht angetastet. Die Unsicherheit im Vorfeld eines Tarifabschlusses über das Risiko, dass ein Tarifvertrag verdrängt werden kann, begründet weder bei klaren noch bei unsicheren Mehrheitsverhältnissen ein Haftungsrisiko einer Gewerkschaft bei Arbeitskampfmaßnahmen. Dies haben die Arbeitsgerichte gegebenenfalls in verfassungskonformer Anwendung der Haftungsregeln sicherzustellen.
c) Art. 9 Abs. 3 GG berechtigt den Gesetzgeber, das Verhältnis der sich gegenüber stehenden Tarifvertragsparteien zu regeln, um strukturelle Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass Tarifverhandlungen einen fairen Ausgleich ermöglichen und damit angemessene Wirtschafts- und Arbeitsbedingungen hervorbringen können. Zur Funktionsfähigkeit der Tarifautonomie gehört aber nicht nur die strukturelle Parität zwischen Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite. Zu ihr gehören auch die Bedingungen der Aushandlung von Tarifverträgen, welche die Entfaltung der Koalitionsfreiheit dort sichern, wo auf Seiten der Gewerkschaften oder der Arbeitgeber mehrere Akteure untereinander konkurrieren. Auch hier verfügt der Gesetzgeber über einen weiten Handlungsspielraum. Er ist nicht gehindert, Rahmenbedingungen zu verändern, so aus Gründen des Gemeinwohls, um gestörte Paritäten wieder herzustellen oder um einen fairen Ausgleich auf einer Seite zu sichern.
2. Die Regelungen des Tarifeinheitsgesetzes sind in der verfassungsrechtlich gebotenen Auslegung und Handhabung weitgehend mit Art. 9 Abs. 3 GG vereinbar.
a) Zweck des Gesetzes ist es, Anreize für ein kooperatives Vorgehen der Arbeitnehmerseite in Tarifverhandlungen zu setzen und so Tarifkollisionen zu vermeiden. Damit verfolgt der Gesetzgeber das legitime Ziel, zur Sicherung der strukturellen Voraussetzungen von Tarifverhandlungen das Verhältnis der Gewerkschaften untereinander zu regeln. Die angegriffenen Regelungen sind geeignet, dieses Ziel zu erreichen, auch wenn nicht gewiss ist, dass der gewollte Effekt tatsächlich eintritt. Es bestehen auch keine verfassungsrechtlich durchgreifenden Bedenken gegen ihre Erforderlichkeit. Jedenfalls steht kein zweifelsfrei gleich wirksames, Gewerkschaften und ihre Mitglieder aber weniger beeinträchtigendes Mittel zur Verfügung, um die legitimen Ziele zu erreichen. Der Gesetzgeber hat den ihm hier zustehenden Beurteilungs- und Prognosespielraum nicht verletzt.
b) Die mit dem Tarifeinheitsgesetz verbundenen Belastungen sind in einer Gesamtabwägung überwiegend zumutbar, wenn ihnen durch eine restriktive Auslegung der Verdrängungsregelung (§ 4a Abs. 2 TVG), ihrer verfahrensrechtlichen Einbindung sowie durch eine weite Interpretation des Nachzeichnungsanspruchs Schärfen genommen werden.
aa) Das Gewicht der Beeinträchtigung durch die Regelungen ist dadurch relativiert, dass es die Betroffenen in gewissem Maße selbst in der Hand haben, ob es zur Verdrängungswirkung kommt oder nicht. Die Verdrängungsregelung ist tarifdispositiv; allerdings müssen dazu alle betroffenen Tarifvertragsparteien vereinbaren, dass die Kollisionsnorm nicht zur Anwendung kommt.
bb) Zudem ist die Verdrängungswirkung im Fall der Tarifkollision im Betrieb schon nach der gesetzlichen Regelung mehrfach beschränkt. Darüber hinaus sind die Arbeitsgerichte gehalten, Tarifverträge im Kollisionsfall so auszulegen, dass die durch eine Verdrängung beeinträchtigten Grundrechtspositionen möglichst weitgehend geschont werden. Wenn und soweit es objektiv dem Willen der Tarifvertragsparteien des Mehrheitstarifvertrags entspricht, eine Ergänzung ihrer Regelungen durch Tarifverträge konkurrierender Gewerkschaften zuzulassen, werden diese nicht verdrängt. Besteht Grund zu der Annahme, dass Regelungen kollidierender Tarifverträge nebeneinander bestehen sollen, findet die Verdrängung dort nicht statt.
cc) Um unzumutbare Härten zu vermeiden, dürfen bestimmte tarifvertraglich garantierte Leistungen nicht verdrängt werden. Das betrifft längerfristig bedeutsame Leistungen, auf die sich Beschäftigte in ihrer Lebensplanung typischerweise einstellen und auf deren Bestand sie berechtigterweise vertrauen, wie beispielsweise Leistungen zur Alterssicherung, zur Arbeitsplatzgarantie oder zur Lebensarbeitszeit. Der Gesetzgeber hat dafür keine Schutzvorkehrungen getroffen. Hier müssen die Gerichte von Verfassungs wegen sicherstellen, dass die Verdrängung eines Tarifvertrags zumutbar bleibt. Lassen sich die Härten nicht in der Anwendung des für die weitere Gewährung solcher Leistungen maßgeblichen Rechts vermeiden, ist der Gesetzgeber gehalten, dies zu regeln.
dd) Die beeinträchtigende Wirkung wird auch durch die Auslegung der Kollisionsregelung gemildert, wonach die Verdrängung eines Tarifvertrags nur solange andauert, wie der verdrängende Tarifvertrag läuft und kein weiterer Tarifvertrag eine Verdrängung bewirkt. Der verdrängte Tarifvertrag lebt danach für die Zukunft wieder auf. Ob dies anders zu beurteilen ist, um ein kurzfristiges Springen zwischen verschiedenen Tarifwerken zu vermeiden, müssen die Fachgerichte entscheiden.
ee) Die Belastungswirkungen der Verdrängung sind durch den Anspruch auf Nachzeichnung eines anderen Tarifvertrags gemildert (§ 4a Abs. 4 TVG). Dieser ist verfassungskonform so auszulegen, dass er sich auf den gesamten verdrängenden Tarifvertrag bezieht. Der Nachzeichnungsanspruch korrespondiert so zumindest mit der Reichweite der Verdrängung, kann aber auch weiter reichen.
ff) Die Beeinträchtigung der Rechte aus Art. 9 Abs. 3 GG wird auch durch Verfahrens- und Beteiligungsrechte der von der Verdrängung betroffenen Gewerkschaft gemindert. Der Arbeitgeber ist verpflichtet, die Aufnahme von Tarifverhandlungen rechtzeitig im Betrieb bekannt zu geben. Die nicht selbst verhandelnde, aber tarifzuständige Gewerkschaft hat einen Anspruch darauf, dem Arbeitgeber ihre Vorstellungen vorzutragen. Diese Verfahrenspositionen sind als echte Rechtspflichten zu verstehen. Werden sie verletzt, liegen die Voraussetzungen für eine Verdrängung nicht vor.
gg) Die Ungewissheit des Arbeitgebers über die tatsächliche Durchsetzungskraft einer Gewerkschaft aufgrund deren Mitgliederstärke ist für die von Art. 9 Abs. 3 GG geschützte Parität zwischen Gewerkschaften und Arbeitgeberseite von besonderer Bedeutung. Das neu geregelte Beschlussverfahren nach § 2a Abs. 1 Nr. 6, § 99 ArbGG geht mit dem Risiko einher, dass es zur Offenlegung der Mitgliederstärke der Gewerkschaften kommt. Die Fachgerichte müssen die prozessrechtlichen Möglichkeiten nutzen, um dies möglichst zu vermeiden. Wenn dies nicht in allen Fällen gelingt, ist das mit Blick auf das gesetzgeberische Ziel jedoch insgesamt zumutbar.
3. Die mit der Verdrängung eines Tarifvertrags verbundenen Beeinträchtigungen sind insoweit unverhältnismäßig, als Schutzvorkehrungen gegen eine einseitige Vernachlässigung der Angehörigen einzelner Berufsgruppen oder Branchen durch die jeweilige Mehrheitsgewerkschaft fehlen. Der Gesetzgeber hat keine Vorkehrungen getroffen, die sichern, dass in einem Betrieb die Interessen von Angehörigen kleinerer Berufsgruppen, deren Tarifvertrag verdrängt wird, hinreichend berücksichtigt werden. So ist nicht auszuschließen, dass auch im Fall der Nachzeichnung deren Arbeitsbedingungen und Interessen mangels wirksamer Vertretung in der Mehrheitsgewerkschaft unzumutbar übergangen werden. Der Gesetzgeber ist gehalten, hier Abhilfe zu schaffen; er hat dabei einen weiten Gestaltungsspielraum.
4. Die teilweise Verfassungswidrigkeit des § 4a TVG führt nicht zu dessen Nichtigerklärung, sondern nur zur Feststellung seiner Unvereinbarkeit mit dem Grundgesetz. Die Defizite betreffen nicht den Kern der Regelung. Die strukturellen Rahmenbedingungen der Aushandlung von Tarifverträgen, auf die der Gesetzgeber hier zielt, sind dagegen von großer Bedeutung. Bis zu einer Neuregelung darf die Vorschrift daher nur mit der Maßgabe angewendet werden, dass eine Verdrängungswirkung erst in Betracht kommt, wenn plausibel dargelegt werden kann, dass die Mehrheitsgewerkschaft die Interessen der Berufsgruppen, deren Tarifvertrag verdrängt wird, ernsthaft und wirksam in ihrem Tarifvertrag berücksichtigt hat.
Abweichende Meinung des Richters Paulus und der Richterin Baer
Richter Paulus und Richterin Baer sind sich mit dem Senat hinsichtlich der Anforderungen einig, die aus dem Freiheitsrecht des Art. 9 Abs. 3 GG für Regelungen zur Sicherung der Tarifautonomie folgen. Sie können dem Urteil jedoch in der Bewertung des Mittels, mit dem der Gesetzgeber die Tarifautonomie stärken möchte, in der Entscheidung, das Gesetz fortgelten zu lassen, und in der Überantwortung grundrechtlicher Probleme an die Fachgerichte nicht folgen. Sie sind der Auffassung, das Ziel der Sicherung der Tarifautonomie sei legitim, aber das Mittel der Verdrängung eines abgeschlossenen Tarifvertrags sei zu scharf. Komplexe Fragen habe der Gesetzgeber zu entscheiden und nicht der Senat. Außerdem seien die weiteren im Urteil identifizierten verfassungsrechtlichen Defizite des Tarifeinheitsgesetzes entweder durch eine zwingende verfassungskonforme Auslegung oder durch eine Neuregelung und damit vom Gesetzgeber zu lösen.
Wesentliche Erwägungen der abweichenden Meinung:
1. Der Gesetzgeber darf auf Erosionen der Tarifbindung reagieren und Regelungen in Kraft setzen, die das Freiheitsrecht des Art. 9 Abs. 3 GG in verhältnismäßiger Weise beschränken. Er darf aber weder auf eine Vorstellung „widerspruchsfreier Ordnung“ noch auf eine Einheitsgewerkschaft zielen oder Arbeitgeber vor vielfachen gewerkschaftlichen Forderungen zu schützen suchen.
2. Das Urteil beruht jedoch auf Einschätzungen der sozialen Wirklichkeit, an denen Zweifel bestehen. Weder substantiiert noch sonst belegt worden ist die These, derzeit in Tarifkollision ausgehandelte Löhne würden als ungerecht empfunden, was den Betriebsfrieden störe. Nicht zu übersehen ist auch, dass es an Kooperation zwischen Gewerkschaften aus Gründen fehlt, denen das Urteil zu wenig Bedeutung beimisst. Tarifpluralität ist Ausfluss grundrechtlicher Freiheit und insbesondere von Arbeitgebern oft gewollt, Kollisionen selten und Konflikte Teil spezifischer Entwicklungen. Es gibt seit langem klärende Verbandsverfahren. Nicht übersehen werden kann, dass die angegriffenen Regelungen auf einen einseitigen politischen Kompromiss zurückgehen, und der Gesetzgeber nicht nur scharf sanktioniert, sondern auch strukturell einseitig vorgeht.
3. Es ist fraglich, ob die angegriffenen Regelungen geeignet sind, das Ziel der Funktionsfähigkeit des Tarifvertragssystems zu erreichen. Die Wahrscheinlichkeit, dass der Gesetzgeber heftigere Konkurrenzen und Statuskämpfe in einzelnen Betrieben provoziert, erscheint hoch. Auch an der Erforderlichkeit des Tarifeinheitsgesetzes bestehen erhebliche Zweifel. Die angeführte Änderung in der Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts hat nicht dazu geführt, dass die Funktionsfähigkeit der Tarifautonomie beeinträchtigt wurde; schon vor 2010 gab es keine durchgängige Tarifeinheit im Betrieb. Mit der Verdrängung eines Tarifvertrags nur nach einem gerichtlichen Beschlussverfahren steht ein milderes, als Anreiz zur Kooperation der Tarifvertragsparteien aber ebenso wirksames Mittel zur Verfügung.
a) Das Tarifeinheitsgesetz ist nicht nur hinsichtlich des Berufsgruppenschutzes im anwendbaren Tarifvertrag grundrechtlich unzumutbar. Die Unzumutbarkeit betrifft auch die im Urteil noch ermöglichte Auslegung der Regelung als Verdrängung eines Tarifvertrags ohne arbeitsgerichtlichen Beschluss. Das Urteil überlässt die Handhabung der Kollisionsregel insoweit den Arbeitsgerichten. Die Auslegung, wonach dem gerichtlichen Beschlussverfahren klärende Gestaltungswirkung zukommt, ist dann verfassungsrechtlich zwingend. Nur wenn die Verdrängung eines Tarifvertrags im Kollisionsfall an ein konstitutives Beschlussverfahren gebunden wird, schafft dies Rechtssicherheit und vermeidet unkalkulierbare und das Tarifvertragssystem zusätzlich belastende Unsicherheiten.
b) Das Urteil geht zu Recht davon aus, dass es mit Art. 9 Abs. 3 GG unvereinbar wäre, wenn die Kollisionsregelung auch zum Verlust langfristig angelegter, die Lebensplanung der Beschäftigten berührender Ansprüche aus einem Tarifvertrag führen würde. Das hat der Gesetzgeber nicht berücksichtigt. Es ist nicht an den Gerichten, diese Lücke zu füllen. Wo grundrechtlich klar geschützte Belange einfach ignoriert worden sind, liegt es in der Verantwortung des Gesetzgebers, sich für eine von vielen denkbaren Regelungen zu entscheiden.
c) Hinter der Annahme der Senatsmehrheit, die Nachzeichnung eines Tarifvertrags einer anderen Gewerkschaft halte den Verlust des eigenen Tarifvertrags in Grenzen, steht eine gefährliche Tendenz, die Interessen aller Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer als einheitlich aufzufassen. Die Vorstellung, es komme nicht auf den konkret ausgehandelten Vertrag an, solange überhaupt eine Tarifbindung bestehe, privilegiert in der Sache die großen Branchengewerkschaften. Dies widerspricht dem Grundgedanken des Art. 9 Abs. 3 GG, der auf das selbstbestimmte tarifpolitische Engagement von Angehörigen jedweden Berufes setzt.
d) Das Urteil eröffnet die Möglichkeit, dass im gerichtlichen Beschlussverfahren die Mehrheitsverhältnisse der Gewerkschaften in einem Betrieb offengelegt werden. Solange der Gesetzgeber keine Vorkehrungen trifft, die damit einhergehende Verschiebung der Kampfparität zu verhindern, ist auch dies nicht zumutbar.
4. Der Senat ist sich zwar einig, dass eine Regelung, die keinerlei Rücksicht auf die spezifischen Interessen und Bedürfnisse derjenigen nimmt, deren Tarifverträge in einem Betrieb verdrängt werden, nicht mit dem Grundgesetz vereinbar ist. Dann kann jedoch die insoweit verfassungswidrige Norm nicht mehr fortgelten. Die Nichtigkeit als Regelfolge ist zwar hart, aber eindeutig normiert; die anerkannten Gründe für die ausnahmsweise Fortgeltung verfassungswidriger Normen liegen nicht vor. Daher hätte das Tarifeinheitsgesetz jedenfalls insoweit für verfassungswidrig und nichtig erklärt werden müssen; § 4a Abs. 2 Satz 2 TVG wäre bis zu einer Neuregelung unanwendbar. Wo der Gesetzgeber die Weichen für eine zumutbare Einschränkung der Koalitionsfreiheit nicht gestellt hat, ist er selbst gefragt. Der Senat verlangt nun von den Fachgerichten die Überprüfung der sachlichen Angemessenheit von Tarifverträgen. Hingegen vertraut Art. 9 Abs. 3 GG der eigenverantwortlich wahrgenommenen Freiheit der Tarifvertragsparteien.
<< Neues Textfeld >>
Erfolgreicher Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung gegen die Verpflichtung eines Nachrichtenmagazins zum Abdruck eines „Nachtrags“
Pressemitteilung Nr. 50/2017 vom 27. Juni 2017
Beschluss vom 22. Juni 2017
1 BvR
666/17
Im Wege der einstweiligen Anordnung hat die 3. Kammer des Ersten Senats des Bundesverfassungsgerichts auf Antrag der Beschwerdeführerin mit heute veröffentlichtem Beschluss die Vollstreckung aus einem Urteil des Hanseatischen Oberlandesgerichts Hamburg einstweilen eingestellt. Mit diesem Urteil war der Beschwerdeführerin auferlegt worden, einen „Nachtrag“ zu einem im Nachrichtenmagazin „Der Spiegel“ erschienenen Artikel abzudrucken. Die Entscheidung der Kammer beruht auf einer Folgenabwägung. Ein weiterer Aufschub bei der Vollstreckung ist dem Kläger des Ausgangsverfahrens eher zumutbar als es die Verpflichtung zum sofortigen Abdruck für die Antragstellerin wäre.
Sachverhalt:
Im August 2010 erschien in der Zeitschrift „Der Spiegel“ ein Beitrag, der sich kritisch mit den Zuständen bei der HSH Nordbank AG befasste. Darin wird unter anderem dargestellt, dass der Kläger des Ausgangsverfahrens als Justitiar der HSH Nordbank AG im Jahr 2009 an einer Abhörmaßnahme gegen ein Vorstandsmitglied beteiligt gewesen sein könnte. Wegen dieser Berichterstattung betrieb er ein Unterlassungsverfahren gegen die Beschwerdeführerin. Im Jahr 2015 verurteilte das Oberlandesgericht die Beschwerdeführerin, eine vom Kläger des Ausgangsverfahrens formulierte Erklärung in der nächsten Ausgabe ihres Nachrichtenmagazins unter der Bezeichnung als „Nachtrag“ zu veröffentlichen. In dieser werden auch weitere angeblich an der Abhöraktion beteiligte Personen benannt. Der letzte Satz dieser Erklärung lautet:
„[haben wir durch die Berichterstattung] (…) den Verdacht erweckt, der HSH-Chefjustitiar G. habe an den beschriebenen angeblichen Abhörmaßnahmen gegen R. mitgewirkt. Diesen Verdacht erhalten wir aus heutiger Sicht nicht aufrecht. Der Verlag.“
Die hiergegen eingelegte Nichtzulassungsbeschwerde wies der Bundesgerichtshof ebenso zurück wie eine nachfolgend erhobene Anhörungsrüge. Inzwischen wird die Beschwerdeführerin im Zwangsmittelwege dazu angehalten, die Erklärung abzudrucken. Mit ihrer Verfassungsbeschwerde rügt die Beschwerdeführerin vornehmlich die Verletzung ihres Grundrechts auf Pressefreiheit (Art. 5 Abs. 1 Satz 1 und 2 GG) und begehrt mit dem Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung, die Vollziehung des Urteils des Oberlandesgerichts einstweilen auszusetzen.
Wesentliche Erwägungen der Kammer:
Der zulässige Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung ist begründet.
1. Das Bundesverfassungsgericht kann einen Zustand durch einstweilige Anordnung vorläufig regeln, wenn dies zur Abwehr schwerer Nachteile, zur Verhinderung drohender Gewalt oder aus einem anderen wichtigen Grund zum gemeinen Wohl dringend geboten ist (§ 32 Abs. 1 BVerfGG). Die Erfolgsaussichten in der Hauptsache haben außer Betracht zu bleiben, es sei denn, der in der Hauptsache gestellte Antrag erwiese sich als von vornherein unzulässig oder offensichtlich unbegründet. Bei offenem Ausgang des Hauptsacheverfahrens muss das Bundesverfassungsgericht eine Folgenabwägung vornehmen.
2. Die Verfassungsbeschwerde ist weder von vornherein unzulässig noch offensichtlich unbegründet; sie wirft vielmehr Fragen auf, die im vorläufigen Rechtsschutzverfahren nicht abschließend beurteilt werden können. Demnach war eine Folgenabwägung vorzunehmen. Nach ihrem Ergebnis überwiegen im vorliegenden Verfahren die Gründe, die für den Erlass einer einstweiligen Anordnung sprechen.
a) Erginge die beantragte einstweilige Anordnung nicht und würde sich die Verfassungsbeschwerde im Hauptsacheverfahren als begründet erweisen, müsste die Beschwerdeführerin eine Erklärung veröffentlichen, die ihr in dieser Form eventuell nicht hätte auferlegt werden dürfen. Für die Beschwerdeführerin bedeutete dies einen Eingriff in ihre redaktionelle Gestaltungsfreiheit. Von Gewicht ist dabei, dass ihr eine Veröffentlichung in der vorgesehenen Form auch eine inhaltliche Distanzierung abverlangen würde. Zudem könnte durch die Veröffentlichung des „Nachtrags“ ein Imageschaden eintreten. Schließlich besteht die Gefahr, dass durch die Veröffentlichung Persönlichkeitsrechte Dritter beeinträchtigt werden, ohne dass dies nachträglich heilbar wäre.
b) Erginge die einstweilige Anordnung, erwiese sich die Verfassungsbeschwerde aber später als unbegründet, würde die Beschwerdeführerin bis zur Entscheidung über die Verfassungsbeschwerde keinen „Nachtrag“ abdrucken. Dies ist angesichts der im Raum stehenden Vorwürfe zwar von Gewicht. Seit der Veröffentlichung des Artikels sind bereits sechs Jahre verstrichen. Auch bedeutet eine zeitliche Verzögerung im vorliegenden Fall nicht, dass der Effekt des erstrebten Nachtrags unwiederbringlich verloren ginge. Für den Kläger des Ausgangsverfahrens kann die Veröffentlichung des „Nachtrags“ auch später noch ihren Sinn erfüllen.
c) Beurteilt man die Folgen, wiegen die Nachteile, die der Beschwerdeführerin im Falle der Ablehnung des Erlasses der begehrten einstweiligen Anordnung drohen, schwerer als die Nachteile, die für den Kläger des Ausgangsverfahrens im Falle eines Anordnungserlasses entstünden. Ein weiterer Aufschub bei der Vollstreckung ist diesem eher zumutbar als es die Verpflichtung zum sofortigen Abdruck für die Beschwerdeführerin wäre.
| Newsletter Juli 2017 |
Wir stellen Ihnen in unserem aktuellen Newsletter wieder neue interessante und nützliche Urteile aus verschiedenen Rechtsgebieten vor.
Über unsere Homepage www.deutsche-anwaltshotline.de erhalten Sie sofort Rechtsberatung per Telefon und per E-Mail durch selbstständige Rechtsanwälte.
Viel Vergnügen beim Lesen unseres Newsletters wünschen Ihnen die Kooperationsanwälte und die Geschäftsleitung der Deutschen Anwaltshotline!
Inhalt:
Behörde muss Schwerbehinderten nicht einladen
Ein öffentlicher Arbeitgeber ist nicht verpflichtet, einen schwerbehinderten Bewerber zum zweiten Mal für dieselbe Arbeitsstelle zu einem Vorstellungsgespräch
einzuladen.
Das Arbeitsgericht Karlsruhe fällte dazu ein interessantes Urteil.
Die komplette Urteilsmeldung finden Sie hier.
Meer dreckig: Reisemangel?
Wer im Urlaub erkrankt, weil er im dreckigen Meerwasser schwimmt, kann dafür nicht den Reiseveranstalter verantwortlich machen.
So entschied das Landgericht Köln.
Die komplette Urteilsmeldung finden Sie hier.
Brifkasten versetzt: Kündigung?
Ein Mieter darf seinen Briefkasten versetzen, wenn er von der Wohnung zu weit entfernt und nicht ausreichend vor Witterung geschützt ist. Selbst dann, wenn der
Vermieterin das psychische Probleme bereitet .
Das Amtsgericht Kleve hatte in diesem Fall zu entscheiden.
Die komplette Urteilsmeldung finden Sie hier.
Auf Tagung gegen Glaswand gelaufen: Schmerzensgeld?
Wer gegen eine Glaswand läuft, der hat keinen Anspruch auf Schmerzensgeld oder Schadensersatz. Denn in einem modernen Gebäude, das hauptsächlich aus Glas besteht,
muss man mit einer Glaswand rechnen.
Das hatte das Landgericht Essen zu entscheiden.
Die komplette Urteilsmeldung finden Sie hier.
Diskretion für Escort-Dame
Wer sich als Escort-Dame mit Fotos auf einer Internetplattform anmeldet, der trägt einen Teil seiner Intimsphäre in die Öffentlichkeit. Das berechtigt aber niemanden,
die Verwandtschaft der Person über deren Aktivität zu informieren.
So urteilte das Landgericht Frankfurt am Main.
Die komplette Urteilsmeldung finden Sie hier.
Informationen für Mitglieder der Deutschen Anwaltshotline:
Auf der Seite www.jura-ticker.de stellt die Deutsche Anwaltshotline Ihnen kostenlos einen dynamischen Ticker mit täglich wechselnden Rechtsnachrichten zur Verfügung. Sie können diesen von uns entwickelten Ticker in Ihre eigene Homepage einbinden und so den Besuchern Ihrer Website einen neuen und informativen Service bieten.
Alle juristisch interessierten Leser können auch auf der Jura-Ticker-Homepage täglich aktualisierte Rechtsmeldungen studieren.
Als Abonnent unseres Newsletters haben Sie übrigens auch kostenlosen Zugang zum Mitgliederbereich. Sie können dort kostenlos eine Auswahl an anwaltlich geprüften Verträgen und Dokumenten downloaden, z.B. Kfz-Kaufvertrag, Arbeitsvertrag, Patientenverfügung, usw. Sie erhalten dort auch kostenlos Zugriff auf hilfreiche Broschüren, wie etwa zum Thema „Grillen – was ist erlaubt?“ oder „Hartz IV – Alles was wichtig ist“.
Besuchen Sie unseren Mitgliederbereich unter https://www.deutsche-anwaltshotline.de/allgemein/mitglieder/index.php mit folgenden Zugangsdaten (Groß- und Kleinschreibung beachten):
Benutzer: Deutsche-Anwaltshotline
Passwort: rechtlich
Den Mitgliederbereich erreichen Sie auch über den Menüpunkt "für Mitglieder" auf unserer Homepage.
Für alle persönlichen Rechtsfragen stehen Ihnen selbstständige Anwälte über die Deutschen Anwaltshotline von Montag bis Sonntag von 7:00 Uhr morgens - 01:00 nachts Uhr zur Verfügung.
Rufnummer Rechtsberatung: 0900-1-875 000-10 (1,99 Eur/Min*)
*inklusive 19 % Mehrwertsteuer aus dem Festnetz der Deutschen Telekom; ggf. abweichende Preise aus Mobilfunknetzen.
Unter www.deutsche-anwaltshotline.de können Sie auch die direkten Durchwahlen zu über 50 Rechtsgebieten abfragen.
Impressum:
Deutsche Anwaltshotline AG, Am Plärrer 7, 90443 Nürnberg Tel.: +49 911 / 376569-0, Fax: +49 911 / 376569-99
Register und Registernummer: Amtsgericht Nürnberg HRB 24658
Umsatzsteuer-ID: DE261181671
vertreten durch: Johannes Goth, Volker Schwengler, Christian Ulshöfer
Aufsichtsrat: Hartmut Dicke (Vorsitzender), Alexander Keller, Reinhold Gleichmann
Verantwortlicher für journalistisch-redaktionelle Inhalte gem. § 55 II RstV: Engin Aydin, Lars Roedel
<< Neues Textfeld >>
| Newsletter Juni 2017 |
Wir stellen Ihnen in unserem aktuellen Newsletter wieder neue interessante und nützliche Urteile aus verschiedenen Rechtsgebieten vor.
Über unsere Homepage www.deutsche-anwaltshotline.de erhalten Sie sofort Rechtsberatung per Telefon und per E-Mail durch selbstständige Rechtsanwälte.
Neu: Unsere Blitzabfindung - Kündigung erhalten? Rundum sorglos dank Schlichtung. Jetzt kostenlosen Rückruf anfordern!
Viel Vergnügen beim Lesen unseres Newsletters wünschen Ihnen die Kooperationsanwälte und die Geschäftsleitung der Deutschen Anwaltshotline!
Inhalt:
Nürnberg (D-AH/fk) – Wer seinen Namen ändern möchte, der darf sich nicht wie der aus Literatur und Film bekannte Geheimagent James Bond nennen. Das entschied das Verwaltungsgericht Koblenz (Az. 1 K 616/16.KO).
Wie die telefonische Rechtsberatung der Deutschen Anwaltshotline berichtet, sah sich ein Mann wiederholt mit Strafanzeigen gegen ihn durch seinen Onkel und den Rest seiner Familie konfrontiert. Er war wegen diverser psychischer Erkrankungen in ärztlicher Behandlung. Schließlich war er der Meinung, sein Name trage zu dieser Situation bei und wollte diesen ändern lassen. Nach eigener Aussage höre er schon seit Jahren nur auf den Namen James Bond und auch seine Ärzte wären der Meinung, eine Änderung können seinen Zustand verbessern. Die zuständige Behörde versagte ihm aber seinen Wunsch. Das wollte dieser aber nicht hinnehmen und ging deswegen vor Gericht.
Das Verwaltungsgericht Koblenz stellte sich nun auf die Seite der Behörde. Der Mann habe keinen Anspruch auf eine Namensänderung. Da gegen den Mann bereits Strafverfahren liefen und er im Schuldenregister eigetragen ist, würde eine Namensänderung eine mögliche Strafverfolgung zusätzlich erschweren. „Es ist auch nicht ersichtlich, wie ein anderer Name die Familienstreitigkeiten beilegen sollte“, erklärt Rechtsanwalt Volker Scheinert (telefonische Rechtsberatung unter 0900/1875000-0 für 1,99 Euro pro Minute).
Auch eine Kombination seines echten Namens mit dem Namen James Bond lehnten die Richter ab. Denn auch dabei wäre die Assoziation mit Ian Flemmings Geheimagenten unvermeidlich, so das Gericht.
Kündigung für Rauchenden Heimbewohner rechtmäßig?
Nürnberg (D-AH/fk) – Wer trotz Rauchverbotes in seinem Zimmer in einem Pflegeheim raucht, der gefährdet Leib und Leben der anderen Heimbewohner. Das Heim darf diesem Bewohner dann kündigen, entschied das Landgericht Münster (Az. 02 O 114/16).
Wie die telefonische Rechtsberatung der Deutschen Anwaltshotline berichtet, verbrachte ein Mann nach einem Hirninfarkt sein Leben einem Pflegeheim. Der starke Raucher bekam dort auch einen Betreuer zur Seite gestellt. Die Heimleitung gestattete ihm, in seinem Zimmer zu rauchen. Allerdings warf er die glimmenden Zigarettenstummel in den Papierkorb. Das führte zu einem Schwelbrand und die Heimleitung verbot ihm daraufhin, weiter in dem Zimmer zu rauchen. Daran hielt sich der Mann aber nicht und entsorgte wieder seine glühenden Zigaretten im Papierkorb. Als es wieder zu einem Brand kam hatte die Heimleitung genug und kündigte dem Mann das Zimmer. Dieser wollte das nicht akzeptieren und der Fall ging vor Gericht.
Das Landgericht Münster stellte sich nun auf die Seite des Heims. Der Mann habe eine schwerwiegende Vertragsverletzung begangen. Das stelle einen wichtigen Grund dar, um das Vertragsverhältnis fristlos zu beenden. „Schließlich hat der Mann mit seinem Verhalten Leib und Leben anderer Heimbewohner gefährdet“, erklärt Rechtsanwältin Petra Nieweg (telefonische Rechtsberatung unter 0900/1875000-0 für 1,99 Euro pro Minute). Auch wenn der Mann es schwer haben werde, aufgrund dieser Vorfälle schnell einen neuen Heimplatz zu finden, sei die Kündigung gerechtfertigt.
An der geistigen Zurechnungsfähigkeit des Mannes hegte das Gericht dabei keine Zweifel. Denn nur weil ein Betreuer bestellt worden ist, sei nicht von einer verminderten Aufnahmefähigkeit auszugehen.
Scheidung: Was wird aus den Hunden?
Nürnberg (D-AH/fk) – Trennen sich zwei Ehepartner, so ist für die Frage, wer die drei Hunde bekommt, neben der Grundversorgung auch das seelische Wohl der Tiere entscheidend. Das beschloss das Oberlandesgericht Nürnberg (Az. 10 UF 1249/16).
Wie die telefonische Rechtsberatung der Deutschen Anwaltshotline berichtet, war sich ein Ehepaar nach der Trennung uneins, wer die Hunde schließlich bekommen sollte. Der Ehemann hatte sich als Rentner, der an Herzproblemen leidet, stets intensiv um die Tiere gekümmert. Seine berufstätige Gattin konnte das zwar nicht, hatte aber eine mindestens ebenso starke Bindung zu den Tieren. Bei der Trennung nahm sie diese schließlich mit zu ihrem neuen Lebensgefährten. Ihr Mann allerdings wollte die Hunde nicht missen und so ging der Fall schließlich vor Gericht.
Doch das Oberlandesgericht Nürnberg erteilte der Ehefrau die Sorge für die Vierbeiner und bestätigte damit auch das Urteil der Vorinstanz. Zwar gelten Haustiere von Gesetzes wegen als Sachgegenstand. „Doch bei der komplexen Gefühlswelt eines Hundes ist auch das seelische Wohl zu berücksichtigen“, erklärt Rechtsanwältin Christina Bethke (telefonische Rechtsberatung unter 0900/1875000-0 für 1,99 Euro pro Minute). Die existenzielle Grundversorgung der Tiere sei zwar bei beiden Ehepartnern gegeben. Doch der neue Lebensgefährte und dessen Mutter seien zusätzlich in der Lage, sich um die Tiere zu kümmern.
Durch den Tod drei der ehemals sechs Hunde und die Trennung, sei die Struktur des Rudels in den letzten Monaten mehrfach belastet worden, so das Gericht. Die berufstätige Ehefrau und ihr neuer Lebensgefährte bieten das deutlich stabilere Umfeld.
Handy am Steuer angetippt: Ordnungswidrigkeit?
Nürnberg (D-AH/lr) - Wer am Steuer sein Handy nutzt, begeht eine Ordnungswidrigkeit, das ist allgemein bekannt. Doch auch das bloße Antippen eines Buttons zur Kontrolle, ob es ausgeschaltet ist, stellt eine verbotene Nutzung dar, so der Beschluss des Oberlandesgerichts Hamm (Az. 1 RB 170/16).
Wie die telefonische Rechtsberatung der Deutschen Anwaltshotline berichtet, wurde ein Autofahrer vom Amtsgericht Hamm wegen verbotener Handynutzung am Steuer zu einer Geldbuße verurteilt. Seinen Angaben zufolge betätigte der Mann jedoch nur den „Home-Button“ seines iPhones, um sicherzugehen, dass es wie gewünscht ausgeschaltet sei. Gegen das Urteil des Amtsgerichts legte der Fahrer daher eine Rechtsbeschwerde ein, da sich ein ausgeschaltetes Handy nicht benutzen ließe und er es somit auch nicht verbotenerweise hätte nutzen können.
Vor dem Oberlandesgericht Hamm hatte die Beschwerde jedoch keinen Erfolg. Auch eine Überprüfung des ein- oder ausgeschalteten Zustands stelle eine Mobiltelefonnutzung dar, so das Gericht. Die Richter wiesen darauf hin, dass nach obergerichtlicher Rechtsprechung bereits hinreichend geklärt sei, dass selbst das Ein- und Ausschalten eine Handynutzung darstellt. „Daraus leitet das Gericht ab, dass eine Nutzung des Mobiltelefons nicht voraussetzt, dass dieses eingeschaltet sein muss“, erklärt Rechtsanwalt Frank Böckhaus (telefonische Rechtsberatung unter 0900/1875000-0 für 1,99 Euro pro Minute).
Die Überprüfung der Sachlage habe also keinen Rechtsfehler zum Nachteil des Fahrers ergeben, so die Richter.
Vermieter kündigt wegen Eigenbedarf auf Vorrat
Nürnberg (D-AH/lr) – Eine Eigenbedarfskündigung seitens des Vermieters ist nicht zulässig, wenn diese lediglich als Vorratskündigung erfolgt. So lautet der Beschluss des Bundesgerichtshofes (Az. VIII ZR 300/15).
Wie die telefonische Rechtsberatung der Deutschen Anwaltshotline berichtet, klagte eine Mieterin auf Schadensersatz wegen einer Eigenbedarfskündigung ihres Vermieters, da die Wohnung nach ihrem Auszug noch lange Zeit leer stand. Die ehemalige Mieterin hegte erhebliche Zweifel daran, dass der angekündigte Plan des Vermieters, seine kranke Mutter in der Wohnung unterzubringen, tatsächlich in die Tat umgesetzt werden sollte. Nachdem in erster Instanz die Klage gescheitert war, wies auch die zweite Instanz die Mieterin ab. Allerdings ohne die Frau überhaupt anzuhören. Die Mieterin zog daraufhin vor den Bundesgerichtshof.
Der Bundesgerichtshof stellte sich auf die Seite der Mieterin. Eine Vorratskündigung reicht für eine Kündigung wegen Eigenbedarfs nicht aus. „Ein Nutzungswunsch für die baldige Eigennutzung muss bereits im Kündigungszeitpunkt vorliegen“, erläutert Rechtsanwalt Kai Steinle (telefonische Rechtsberatung unter 0900/1875000-0 für 1,99 Euro pro Minute). Sollte die Eigennutzung nicht in die Tat umgesetzt werden, so muss der Vermieter plausibel darlegen, warum die Absicht nachträglich entfallen sein soll. Erst dann liegt es am Mieter zu beweisen, dass der Selbstnutzungswille zum Kündigungszeitpunkt noch nicht bestand.
Außerdem ist der Anspruch auf rechtliches Gehör im Grundgesetz verankert. Die zweite Instanz hatte die Frau aber nicht angehört. Schon deshalb sei dieser Beschluss rechtlich nicht haltbar, so das Gericht.
Informationen für Mitglieder der Deutschen Anwaltshotline:
Auf der Seite www.jura-ticker.de stellt die Deutsche Anwaltshotline Ihnen kostenlos einen dynamischen Ticker mit täglich wechselnden Rechtsnachrichten zur Verfügung. Sie können diesen von uns entwickelten Ticker in Ihre eigene Homepage einbinden und so den Besuchern Ihrer Website einen neuen und informativen Service bieten.
Alle juristisch interessierten Leser können auch auf der Jura-Ticker-Homepage täglich aktualisierte Rechtsmeldungen studieren.
Als Abonnent unseres Newsletters haben Sie übrigens auch kostenlosen Zugang zum Mitgliederbereich. Sie können dort kostenlos eine Auswahl an anwaltlich geprüften Verträgen und Dokumenten downloaden, z.B. Kfz-Kaufvertrag, Arbeitsvertrag, Patientenverfügung, usw. Sie erhalten dort auch kostenlos Zugriff auf hilfreiche Broschüren, wie etwa zum Thema „Grillen – was ist erlaubt?“ oder „Hartz IV – Alles was wichtig ist“.
Besuchen Sie unseren Mitgliederbereich unter https://www.deutsche-anwaltshotline.de/allgemein/mitglieder/index.php mit folgenden Zugangsdaten (Groß- und Kleinschreibung beachten):
Benutzer: Deutsche-Anwaltshotline
Passwort: rechtlich
Den Mitgliederbereich erreichen Sie auch über den Menüpunkt "für Mitglieder" auf unserer Homepage.
Für alle persönlichen Rechtsfragen stehen Ihnen selbstständige Anwälte über die Deutschen Anwaltshotline von Montag bis Sonntag von 7:00 Uhr morgens - 01:00 nachts Uhr zur Verfügung.
Rufnummer Rechtsberatung: 0900-1-875 000-10 (1,99 Eur/Min*)
*inklusive 19 % Mehrwertsteuer aus dem Festnetz der Deutschen Telekom; ggf. abweichende Preise aus Mobilfunknetzen.
Unter www.deutsche-anwaltshotline.de können Sie auch die direkten Durchwahlen zu über 50 Rechtsgebieten abfragen.
Impressum:
Deutsche Anwaltshotline AG, Am Plärrer 7, 90443 Nürnberg Tel.: +49 911 / 376569-0, Fax: +49 911 / 376569-99
Register und Registernummer: Amtsgericht Nürnberg HRB 24658
Umsatzsteuer-ID: DE261181671
vertreten durch: Johannes Goth, Volker Schwengler, Christian Ulshöfer
Aufsichtsrat: Hartmut Dicke (Vorsitzender), Alexander Keller, Reinhold Gleichmann
Verantwortlicher für journalistisch-redaktionelle Inhalte gem. § 55 II RstV: Engin Aydin, Lars Roedel„Kernbrennstoffsteuergesetz“
Hinweis auf die Veröffentlichung der Entscheidung in Sachen „Kernbrennstoffsteuergesetz“
Pressemitteilung Nr. 41/2017 vom 6. Juni 2017
Aktenzeichen: 2 BvL 6/13
Mit Aussetzungs- und Vorlagebeschluss vom 29. Januar 2013 hat das Finanzgericht Hamburg die Frage, ob das Kernbrennstoffsteuergesetz (KernbrStG) vom 8. Dezember 2010 (BGBl I S. 1804) mit dem Grundgesetz unvereinbar ist, dem Bundesverfassungsgericht zur Entscheidung vorgelegt.
Die Entscheidung des Zweiten Senats des Bundesverfassungsgerichts im Verfahren „Kernbrennstoffsteuergesetz“ (2 BvL 6/13) wird am 7. Juni 2017 um 9:30 Uhr gemeinsam mit einer Pressemitteilung veröffentlicht werden.
StartseitePresseErfolgloser Eilantrag gegen versammlungsrechtliche Auflage
Erfolgloser Eilantrag gegen versammlungsrechtliche Auflage
Pressemitteilung Nr. 40a/2017 vom 3. Juni 2017
Beschluss vom 03. Juni 2017
1 BvQ 29/17
Am Samstag, 3. Juni 2017, fand in Karlsruhe-Durlach eine Versammlung des Landesverbands Baden-Württemberg der Partei „DIE RECHTE“ statt. Im Vorfeld der Versammlung hatte die Versammlungsbehörde der Stadt Karlsruhe als Auflage Redeverbote für neun der ursprünglich vorgesehenen Redner ausgesprochen. Hiergegen wendete sich der Antragsteller - Mitglied im Bundesvorstand der Partei und zugleich stellvertretender Leiter der geplanten Versammlung - im Wege des verwaltungsgerichtlichen Eilrechtsschutzes. Die gegen die ablehnende Entscheidung des Verwaltungsgerichts Karlsruhe gerichtete Beschwerde wies der Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg zurück, da dem Antragsteller die erforderliche Antragsbefugnis fehle. Insbesondere sei nicht ersichtlich, dass der Antragsteller tatsächlich die Aufgaben des Versammlungsleiters übernehmen müsse. Der Antragsteller habe weder die Art noch die Symptome der behaupteten Erkrankung des vorgesehenen Versammlungsleiters erläutert oder dargelegt, ob und weshalb konkret mit einem Ausfall des Versammlungsleiters zu rechnen sei. Nach Beginn der Versammlung beantragte der Antragsteller den Erlass einer einstweiligen Anordnung durch das Bundesverfassungsgericht.
Der Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung ist unzulässig, da er dem Grundsatz der Subsidiarität des verfassungsgerichtlichen Rechtsschutzes nicht genügt. Der Antragsteller hat erstmals im verfassungsrechtlichen Eilrechtsschutzverfahren näher zur Erkrankung des Versammlungsleiters vorgetragen. Die Fachgerichtsbarkeit hatte ferner darauf hingewiesen, dass der veranstaltende Landesverband gegen die Auflagen nicht vorgegangen war und dass ein stellvertretender Versammlungsleiter diese Entscheidung durch Inanspruchnahme von Rechtsmitteln nicht konterkarieren dürfe. Der Antragsteller hätte zumindest darlegen müssen, dass er im Einvernehmen mit dem Landesverband als Adressat der Auflage handelte. Das Verfahren der Verfassungsbeschwerde bzw. der einstweiligen Anordnung dient jedoch nicht dem Zweck, prozessuale Versäumnisse des Antragstellers zu kompensieren.
Erfolgreiche Verfassungsbeschwerde gegen die Abschiebung nach Griechenland aufgrund von unzureichender Sachaufklärung im Einzelfall
Pressemitteilung Nr. 39/2017 vom 23. Mai 2017
Beschluss vom 08. Mai 2017
2 BvR 157/17
Mit heute veröffentlichtem Beschluss hat die 1. Kammer des Zweiten Senats des Bundesverfassungsgerichts einer Verfassungsbeschwerde stattgegeben, die sich gegen die Versagung von Eilrechtsschutz im gerichtlichen Verfahren gegen die Ablehnung eines Asylantrags und die Androhung der Abschiebung nach Griechenland richtete. Die fachgerichtliche Beurteilung der Aufnahmebedingungen in einem Drittstaat muss, jedenfalls wenn Anhaltspunkte für eine unmenschliche oder erniedrigende Behandlung vorliegen und damit der Grundsatz des gegenseitigen Vertrauens erschüttert ist, auf einer hinreichend verlässlichen, auch ihrem Umfang nach zureichenden tatsächlichen Grundlage beruhen. Soweit entsprechende Informationen im einstweiligen Rechtsschutzverfahren nicht vorliegen und nicht eingeholt werden können, ist es zur Sicherung effektiven Rechtsschutzes geboten, Eilrechtsschutz zu gewähren.
Sachverhalt:
Der syrische Beschwerdeführer reiste im Juli 2015 in die Bundesrepublik Deutschland ein und stellte im Dezember 2015 einen Asylantrag. Im Rahmen einer Anhörung gab er an, ein bereits in Griechenland gestellter Asylantrag sei dort positiv beschieden worden. Allerdings habe er in Griechenland auf der Straße gelebt und keine Unterstützung vom griechischen Staat erhalten. Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge lehnte daraufhin den Asylantrag mit Hinweis auf die Schutzgewährung in Griechenland als unzulässig ab, woraufhin der Beschwerdeführer Klage zum Verwaltungsgericht erhob. Den Antrag auf Gewährung von Eilrechtsschutz durch die Anordnung der aufschiebenden Wirkung der Klage wies das Verwaltungsgericht ab. Aus den zugänglichen Quellen lasse sich nicht entnehmen, dass anerkannt Schutzberechtigte in Griechenland systematisch schlechter behandelt würden als Inländer. Zudem habe sich die Situation für Flüchtlinge in den letzten Monaten deutlich verbessert. Mit seiner Verfassungsbeschwerde rügte der Beschwerdeführer vornehmlich die Verletzung seines Rechts auf Gewährleistung effektiven Rechtsschutzes (Art. 19 Abs. 4 Satz 1 GG).
Wesentliche Erwägungen der Kammer:
Die Verfassungsbeschwerde ist offensichtlich begründet.
1. Die Verfahrensgewährleistung des Art. 19 Abs. 4 Satz 1 GG gibt dem Bürger einen Anspruch auf eine wirksame gerichtliche Kontrolle. In Fällen, in denen es um die Beurteilung der Aufnahmebedingungen in einem Drittstaat als unmenschliche oder erniedrigende Behandlung geht, kommt der verfahrensrechtlichen Sachaufklärungspflicht verfassungsrechtliches Gewicht zu. Die fachgerichtliche Beurteilung dieser Frage muss, jedenfalls wenn Anhaltspunkte für eine unmenschliche oder erniedrigende Behandlung vorliegen, auf einer hinreichend verlässlichen, auch ihrem Umfang nach zureichenden tatsächlichen Grundlage beruhen. Dabei kann es geboten sein, dass sich die zuständigen Behörden und Gerichte vor einer Rückführung in den Drittstaat über die dortigen Verhältnisse informieren und gegebenenfalls Zusicherungen der zuständigen Behörden einholen. Soweit entsprechende Erkenntnisse und Zusicherungen im einstweiligen Rechtsschutzverfahren nicht vorliegen und nicht eingeholt werden können, ist es zur Sicherung effektiven Rechtsschutzes geboten, die aufschiebende Wirkung der Klage anzuordnen.
2. Die angegriffenen Entscheidungen werden diesen Vorgaben nicht gerecht. Die Schlussfolgerung des Verwaltungsgerichts beruht im Wesentlichen auf der Annahme, die Situation des Beschwerdeführers als anerkannter Schutzberechtigter in Griechenland sei anders zu bewerten als jene von Asylbewerbern; der Umstand, dass sich anerkannt Schutzberechtigte auf eine Gleichbehandlung mit Inländern berufen könnten, genüge den unionsrechtlichen Vorgaben.
Das Verwaltungsgericht setzt sich jedoch nicht damit auseinander, dass die in Griechenland verfügbaren Sozialleistungen - nach den vom Beschwerdeführer vorgelegten Erkenntnissen - an einen bis zu zwanzigjährigen legalen Aufenthalt anknüpfen, weshalb anerkannt Schutzberechtigte von der Inanspruchnahme dieser Leistungen faktisch ausgeschlossen sind. Zudem bedarf es einer Auseinandersetzung mit der Einschätzung, bei anerkannt Schutzberechtigten ebenso wie bei Asylbewerbern treffe die Annahme des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte zu, dass es sich hierbei um eine besonders verletzliche Gruppe handelt, die zumindest für eine Übergangszeit auf staatliche Hilfe bei der Integration in den Aufnahmestaat angewiesen ist. Es hätte daher im vorliegenden Einzelfall weiterer Feststellungen dazu bedurft, ob und wie für nach Griechenland zurückgeführte anerkannt Schutzberechtigte zumindest in der ersten Zeit nach ihrer Ankunft der Zugang zu Obdach, Nahrungsmitteln und sanitären Einrichtungen sichergestellt wird. Eine Zusicherung seitens der griechischen Behörde, den Beschwerdeführer zumindest für eine Übergangszeit unterzubringen, ist im vorliegenden Verfahren nicht abgegeben und von Bundesamt oder Bundesregierung - soweit ersichtlich - auch nicht angefordert worden. Vielmehr hat das Bundesamt in seinem Bescheid lediglich ausgeführt, dass davon auszugehen sei, dass Griechenland die einschlägigen Regelungen des EU-Rechts einhalte.
3. Bei einer erneuten Entscheidung wird das Verwaltungsgericht zu prüfen und berücksichtigen haben, inwieweit seit der Einführung allgemeiner Sozialhilfeleistungen zum 1. Januar 2017 anerkannt Schutzberechtigten in Griechenland in der Praxis Zugang zu diesen effektiv offen steht.
Weitere Eilanträge in Sachen „Vorratsdatenspeicherung“ erfolglos
Pressemitteilung Nr. 28/2017 vom 13. April 2017
Beschlüsse vom 26. März 2017 - 1 BvR 3156/15, 1 BvR 141/16
Die Antragsteller haben sich mit ihren Anträgen auf Erlass einer einstweiligen Anordnung erneut gegen das Gesetz zur Einführung einer Speicherpflicht und einer Höchstspeicherfrist für Verkehrsdaten vom 10. Dezember 2015 gewandt. Sie wollten insbesondere mit Blick auf das Urteil des Gerichtshofs der Europäischen Union vom 21. Dezember 2016 (Rs. C-203/15 und C-698/15) erreichen, dass die durch dieses Gesetz eingeführte Vorratsspeicherung von Telekommunikations-Verkehrsdaten zu Zwecken der öffentlichen Sicherheit außer Kraft gesetzt wird. Mit heute veröffentlichten Beschlüssen hat die 3. Kammer des Ersten Senats des Bundesverfassungsgerichts die Anträge auf Erlass einer einstweiligen Anordnung abgelehnt. Auch nach der Entscheidung des Gerichtshofs der Europäischen Union stellen sich hinsichtlich der verfassungsrechtlichen Bewertung der angegriffenen Regelungen Fragen, die nicht zur Klärung im Eilrechtschutzverfahren geeignet sind.
Verfassungsbeschwerde gegen die Verurteilung wegen Beleidigung eines Ehepaars aus Jamel erfolglos
Pressemitteilung Nr. 29/2017 vom 21. April 2017
Beschluss vom 13. März 2017
1 BvR 1438/15
Mit heute veröffentlichtem Beschluss hat die 3. Kammer des Ersten Senats des Bundesverfassungsgerichts eine Verfassungsbeschwerde gegen die Verurteilung wegen Beleidigung eines in Jamel (Mecklenburg-Vorpommern) lebenden Ehepaars nicht zur Entscheidung angenommen. Das von den Fachgerichten angenommene Überwiegen der Belange der persönlichen Ehre ist verfassungsrechtlich nicht zu beanstanden und verletzt nicht die Meinungsfreiheit des Beschwerdeführers.
Sachverhalt:
Der Beschwerdeführer veröffentlichte im Internet einen Beitrag unter der Überschrift „Jamel ehrt die ,Helden des Nordens‘“. Dem Beitrag war ein Foto eines am Ortsrand von Jamel (Mecklenburg-Vorpommern) aufgestellten Schildes beigefügt. Die Seite des Schildes, die man beim Verlassen des Ortes sieht, zeigt ein in Jamel lebendes Ehepaar als Karikatur, das um einen Topf mit Gold tanzt und die Aufschrift trägt: „Die Faulen und die Dreisten bekommen am meisten“. Auf der anderen Seite sind die karikierten Köpfe der Eheleute abgebildet. Die Köpfe werden von dem Text „Die Dorfgemeinschaft grüßt: Die ,Helden‘ des Nordens“ umrahmt. Das Amtsgericht verurteilte den Beschwerdeführer wegen Beleidigung zu einer Geldstrafe. Die hiergegen gerichtete Revision zum Oberlandesgericht blieb erfolglos. Mit seiner Verfassungsbeschwerde rügt der Beschwerdeführer die Verletzung seiner Meinungs- und Pressefreiheit (Art. 5 Abs. 1 Satz 1 und 2 GG).
Wesentliche Erwägungen der Kammer:
Die Verfassungsbeschwerde wird nicht zur Entscheidung angenommen.
Die angegriffenen Entscheidungen bewegen sich im fachgerichtlichen Wertungsrahmen und verletzen nicht die Meinungsfreiheit des Beschwerdeführers. Der Beitrag selbst wurde zutreffend als zulässige Meinungsäußerung eingeordnet. Demgegenüber sind die Gerichte im Hinblick auf die Abbildung des am Ortseingang aufgestellten Schildes nach Vornahme der gebotenen Abwägung zu dem verfassungsrechtlich nicht zu beanstandenden Ergebnis gekommen, dass die Belange der persönlichen Ehre der Abgebildeten überwiegen. Der Text auf der Rückseite des Schildes und die Bezeichnung als „dumm“ und „dreist“ enthält keinerlei spezifische politische Aussage und beschränkt sich ausschließlich darauf, die Abgebildeten menschlich schlecht zu machen. Durch das an prominenter Stelle am Ortseingang aufgestellte Schild und die verzerrte Darstellung werden die Abgebildeten an den Pranger gestellt und aus der Dorfgemeinschaft ausgegrenzt. Vor diesem situativen Hintergrund und in Verbindung mit der entpolitisierten Aussage ist die Annahme eines Überwiegens der Belange der persönlichen Ehre gut vertretbar und verletzt die Meinungsfreiheit des Beschwerdeführers nicht.
<< Neues Textfeld >>
Erfolgreiche Verfassungsbeschwerde gegen die Verurteilung wegen Beihilfe zur Volksverhetzung
Pressemitteilung Nr. 30/2017 vom 21. April 2017
Beschluss vom 28. März 2017
1 BvR 1384/16
Die 3. Kammer des Ersten Senats des Bundesverfassungsgerichts hat mit heute veröffentlichtem Beschluss einer Verfassungsbeschwerde gegen die Verurteilung wegen Beihilfe zur Volksverhetzung stattgegeben und die Sache zur erneuten Entscheidung an das Landgericht zurückverwiesen. Die Strafgerichte müssen den Sinngehalt einer zu beurteilenden Äußerung zutreffend erfassen und sich zudem auf der Ebene der Abwägung mit der Frage auseinandersetzen, welche Bedeutung der Meinungsfreiheit für die zu treffende Entscheidung zukommt.
Sachverhalt:
Der Beschwerdeführer, der als selbständiger Publizist tätig ist, veröffentlichte auf seiner Internetseite einen mit „Konspiration“ überschriebenen Text. Darin heißt es unter anderem:
„Auch der Staat bedient sich des Mittels der Konspiration, um unerwünschte Meinungen zu bekämpfen. Da wird ganz offen zum ,Kampf gegen Rechts‘ aufgerufen, unter Vorspiegelung falscher Tatsachen. So seltsam es klingen mag, aber seit 1944 ist kein einziger Jude nach Auschwitz verschleppt worden. Und seit die Alliierten keine deutschen Städte mehr bombardieren, werden Synagogen nur noch gebaut und nicht gesprengt. Der schreckliche Antisemitismus, gegen den der ,Kampf gegen Rechts‘ so entschlossen vorgeht, bezieht sich heute auf WORTE, die den Juden nach Ansicht der Meinungskontrolleure womöglich nicht gefallen.“
Die Strafgerichte verurteilten den Beschwerdeführer unter anderem wegen Beihilfe zur Volksverhetzung in Form der Leugnung des durch den Nationalsozialismus begangenen Völkermords zu einer Geldstrafe. Mit seiner Verfassungsbeschwerde wendet sich der Beschwerdeführer gegen die gerichtlichen Entscheidungen und rügt - unter anderem - die Verletzung seiner Meinungsfreiheit (Art. 5 Abs. 1 Satz 1 GG).
Wesentliche Erwägungen der Kammer:
Das Urteil des Landgerichts und der Beschluss des Oberlandesgerichts verletzen den Beschwerdeführer in seiner Meinungsfreiheit.
a) Die Feststellung, ob eine Äußerung den Schutz der Meinungsfreiheit genießt, setzt voraus, dass die Äußerung in ihrem Sinngehalt zutreffend erfasst worden ist. Die Verurteilung wegen einer Äußerung verstößt schon dann gegen Art. 5 Abs. 1 Satz 1 GG, wenn diese den Sinn, den das Gericht ihr entnommen und der Verurteilung zugrunde gelegt hat, nicht besitzt oder wenn bei mehrdeutigen Äußerungen die zur Verurteilung führende Deutung zugrunde gelegt worden ist, ohne dass andere, ebenfalls mögliche Deutungen mit überzeugenden Gründen ausgeschlossen worden sind. Dabei haben die Gerichte insbesondere ausgehend vom Wortlaut auch den Kontext und die sonstigen Begleitumstände der Äußerung zu beachten.
b) Einer Nachprüfung anhand dieser Maßstäbe halten die angegriffenen Entscheidungen nicht stand.
aa) Diese gehen übereinstimmend davon aus, dass der Satz „So seltsam es klingen mag, aber seit 1944 ist kein einziger Jude nach Auschwitz verschleppt worden“ allein dahingehend verstanden werden kann, dass im gesamten Verlauf des Jahres 1944 kein Mensch jüdischen Glaubens in das Konzentrationslager Auschwitz verschleppt worden sei. Dies wurde letztlich allein damit begründet, dass der Beschwerdeführer den Satz mit den Worten „So seltsam es klingen mag“ einleitet. Hierdurch haben die Fachgerichte die ebenfalls mögliche Deutung, dass letztmalig im Jahr 1944, nämlich im November diesen Jahres, Menschen jüdischen Glaubens durch das nationalsozialistische Unrechtsregime in das Konzentrationslager Auschwitz verschleppt wurden, schon auf Ebene des Wortlauts nicht mit überzeugenden Gründe ausgeschlossen. Der schriftlichen Äußerung des Beschwerdeführers können bei isolierter Betrachtung des Wortlauts beide Bedeutungen zugemessen werden, da „1944“ keinen bestimmten Zeitpunkt, sondern einen Zeitraum bezeichnet. Die Satzeinleitung „So seltsam es klingen mag“ bietet für sich keine tragfähige Grundlage, der Äußerung des Beschwerdeführers den durch die Fachgerichte zugrunde gelegten Bedeutungsgehalt beizumessen.
bb) Eine überzeugende Erfassung der Aussage des Beschwerdeführers hätte den Kontext berücksichtigen müssen. Die Strafgerichte hätten sich jedenfalls damit auseinandersetzen müssen, aus welchem Grund der Äußerung des Beschwerdeführers bei verständiger Würdigung gerade der zu seiner Verurteilung führende Bedeutungsgehalt zukommt. Allein die Anknüpfung an die aus dem Gesamttext ersichtliche politische Haltung des Beschwerdeführers rechtfertigt eine solche Interpretation jedenfalls nicht.
cc) Obwohl die den Gegenstand der Verurteilung bildende schriftliche Äußerung des Beschwerdeführers ersichtlich mit Meinungsäußerungen verbunden ist, fehlt im Urteil des Landgerichts jede Auseinandersetzung mit der Frage, welche Bedeutung dem Grundrecht für die zu treffende Entscheidung zukommt. Das Landgericht hat die Reichweite des Grundrechts im konkreten Fall nicht etwa nur unrichtig bestimmt, es hat das Grundrecht der Meinungsfreiheit bei seiner Entscheidung nicht beachtet. Diese Abwägung ist im Rahmen einer Neuentscheidung nachzuholen.
Die falsche Einordnung einer Äußerung als Schmähkritik verkürzt den grundrechtlichen Schutz der Meinungsfreiheit
Pressemitteilung Nr. 25/2017 vom 5. April 2017
Beschluss vom 08. Februar 2017
1 BvR 2973/14
Wegen seines die Meinungsfreiheit verdrängenden Effekts ist der Begriff der Schmähkritik von Verfassungs wegen eng zu verstehen. Auch eine überzogene oder gar ausfällige Kritik macht eine Äußerung für sich genommen noch nicht zur Schmähung. Die Annahme einer Schmähung hat wegen des mit ihr typischerweise verbundenen Unterbleibens einer Abwägung gerade in Bezug auf Äußerungen, die als Beleidigung beurteilt werden, ein eng zu handhabender Sonderfall zu bleiben. Dies hat die 3. Kammer des Ersten Senats des Bundesverfassungsgerichts mit heute veröffentlichtem Beschluss entschieden und damit einer Verfassungsbeschwerde gegen die strafgerichtliche Verurteilung des Beschwerdeführers wegen Beleidigung stattgegeben.
Sachverhalt:
Der Beschwerdeführer war Versammlungsleiter einer ordnungsgemäß angemeldeten Demonstration aus dem rechten Spektrum in Köln. Die Demonstration stieß auf zahlreiche Gegendemonstranten. Unter diesen war auch ein Bundestagsabgeordneter der Partei BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN vor Ort, um die Durchführung des Aufzuges aktiv zu verhindern. Er bezeichnete die Teilnehmer der Demonstration mehrfach wörtlich und sinngemäß als „braune Truppe“ und „rechtsextreme Idioten“. Der Beschwerdeführer äußerte sich über den Bundestagsabgeordneten wörtlich wie folgt:
„Ich sehe hier einen aufgeregten grünen Bundestagsabgeordneten, der Kommandos gibt, der sich hier als Obergauleiter der SA-Horden, die er hier auffordert. Das sind die Kinder von Adolf Hitler. Das ist dieselbe Ideologie, die haben genauso angefangen.“
Das Amtsgericht verurteilte den Beschwerdeführer wegen Beleidigung in Form einer Schmähkritik zu einer Geldstrafe. Auf die Berufung des Beschwerdeführers verwarnte das Landgericht den Beschwerdeführer und behielt sich die Verurteilung zu einer Geldstrafe vor. Die Revision zum Oberlandesgericht blieb erfolglos. Mit seiner Verfassungsbeschwerde wendet sich der Beschwerdeführer gegen die gerichtlichen Entscheidungen und rügt im Wesentlichen die Verletzung seiner Meinungsfreiheit.
Wesentliche Erwägungen der Kammer:
Die angegriffenen Entscheidungen verletzen den Beschwerdeführer in seinem Grundrecht auf Meinungsfreiheit aus Art. 5 Abs. 1 Satz 1 GG.
1. Das Grundrecht auf Meinungsfreiheit schützt nicht nur sachlich-differenzierte Äußerungen. Vielmehr darf Kritik auch pointiert, polemisch und überspitzt erfolgen. Einen Sonderfall bilden hingegen herabsetzende Äußerungen, die sich als Formalbeleidigung oder Schmähung darstellen. Dann ist ausnahmsweise keine Abwägung zwischen der Meinungsfreiheit und dem Persönlichkeitsrecht notwendig, weil die Meinungsfreiheit regelmäßig hinter den Ehrenschutz zurücktritt. Bedeutung und Tragweite der Meinungsfreiheit sind auch dann verkannt, wenn eine Äußerung unzutreffend als Tatsachenbehauptung, Formalbeleidigung oder Schmähkritik eingestuft wird mit der Folge, dass sie dann nicht im selben Maß am Schutz des Grundrechts teilnimmt wie Äußerungen, die als Werturteil ohne beleidigenden oder schmähenden Charakter anzusehen sind.
2. Die Gerichte ordnen die Äußerung des Beschwerdeführers in verfassungsrechtlich nicht mehr tragbarer Weise als Schmähkritik ein und unterlassen die verfassungsrechtlich gebotene Abwägung zwischen der Meinungsfreiheit des Beschwerdeführers und dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht des von der Äußerung Betroffenen. Die angegriffenen Entscheidungen verkennen, dass der Beschwerdeführer mit seiner Äußerung auch das Handeln des Geschädigten kommentierte, der sich maßgeblich an der Blockade der vom Beschwerdeführer als Versammlungsleiter angemeldeten Versammlung beteiligte und die Teilnehmenden auch seinerseits als „braune Truppe“ und „rechtsextreme Idioten“ beschimpft hatte. Es ging dem Beschwerdeführer nicht ausschließlich um die persönliche Herabsetzung des Geschädigten. Bereits die unzutreffende Einordnung verkennt Bedeutung und Tragweite der durch Art. 5 Abs. 1 Satz 1 GG geschützten Meinungsfreiheit.
3. Die angegriffenen Entscheidungen beruhen auf diesem Fehler. Wie diese Abwägung ausgeht, ist verfassungsrechtlich nicht vorgegeben. Bei erneuter Befassung wird auf der einen Seite das Vorverhalten des Geschädigten, der aktiv eine Demonstration verhindern wollte, wie auf der anderen Seite das schwere Gewicht einer Ehrverletzung zu berücksichtigen sein, das in einem individuell adressierten Vergleich mit Funktionsträgern des nationalsozialistischen Unrechtsregimes liegt.
Mit großer Mehrheit stimmte die Regierungskoalition im Bundestag am Donnerstag für den neuen Paragraphen 13 b im Baugesetzbuch, der die Ausweisung neuer Wohnbaugebiete am Außenrand von Ortsteilen ermöglicht. Der Bundesgeschäftsführer der Deutschen Umwelthilfe, Sascha Müller-Kraenner, kritisierte die neue Richtlinie am Freitag in einer Mitteilung:
Hier hat sich einmal mehr die Baulobby gegen den Naturschutz und eine nachhaltige Städteplanung durchgesetzt. Die Schaffung nötigen Wohnraumes ist wichtig, darf aber nicht zur Zersiedlung der Landschaft führen. Durch die zweijährige Ausnahmeregelung können die über 10.000 Gemeinden in Deutschland in dieser Zeit ohne Umweltprüfung und Naturausgleich in beschleunigten Verfahren Baugebiete ausweisen. Damit sind auch Wasserneubildungsgebiete, Frischluftschneisen und Freiräume für Erholung gefährdet. Mit dieser Ausnahme werden grundlegende Prinzipien rechtsstaatlicher Beteiligungsmöglichkeiten ausgesetzt. Die Bundesregierung konterkariert damit ihr eigenes im Koalitionsvertrag verankertes Ziel zum Flächenverbrauch. In ihrem Koalitionsvertrag hatten Union und SPD beschlossen, den Flächenverbrauch auf maximal 30 Hektar pro Tag zu reduzieren. Wenn allerdings nur die Hälfte der Gemeinden in Deutschland von dem neuen Baurecht Gebrauch machen und zusätzliche Bauflächen ausweisen würde, könnte der Flächenverbrauch von heute 60 Hektar auf bis zu 120 Hektar pro Tag ansteigen.
| Newsletter April 2017 |
Wir stellen Ihnen in unserem aktuellen Newsletter wieder neue interessante und nützliche Urteile aus verschiedenen Rechtsgebieten vor.
Über unsere Homepage www.deutsche-anwaltshotline.de erhalten Sie sofort Rechtsberatung per Telefon und per E-Mail durch selbstständige Rechtsanwälte.
Viel Vergnügen beim Lesen unseres Newsletters wünschen Ihnen die Kooperationsanwälte und die Geschäftsleitung der Deutschen Anwaltshotline!
Inhalt:
Muss Krankenkasse für Kontaktlinsen zahlen?
Nürnberg (D-AH/fk) – Krankenkassen müssen Kontaktlinsen nur bezahlen, wenn es sich um eine sehr schwere Sehbeeinträchtigung oder aber um eine Therapie von
Augenkrankheiten handelt. Zusätzlich muss ein medizinischer Ausnahmefall vorliegen, der gerade eine Kontaktlinse erforderlich macht, urteilte das Landessozialgericht Berlin-Brandenburg (Az. L 1 KR
156/13).
Wie die telefonische Rechtsberatung der Deutschen Anwaltshotline berichtet, verletzte sich ein einäugiger Mann an seinem noch gesunden Auge. Er erlitt einen bleibenden Schaden der Hornhaut. Seine
Krankenkasse übernahm die Kosten für die benötigte Kontaktlinse in Höhe von 320 Euro. Doch die Linse ging bald darauf unverschuldet zu Bruch. Die Krankenkasse weigerte sich aber nun, eine neue Linse
zu bezahlen. Denn wegen der mittlerweile neuen veränderten Hilfsmittel-Richtline erfülle der Versicherungsnehmer nun nicht mehr die Kriterien, um die Kontaktlinse bezahlt zu bekommen. Das wollte der
Mann nicht hinnehmen und zog vor Gericht.
Doch auch das Landessozialgericht Berlin-Brandenburg versagte ihm die Leistung. Die Erstattung von Kontaktlinsen sei an die Schwere der Sehbeeinträchtigung geknüpft. Und diese gebe die
Weltgesundheitsorganisation vor. Der Mann leide nicht an einer so schweren Sehschwäche, dass er für eine Kostenerstattung infrage komme. Auch benötige er trotz der Hornhautschäden keine Kontaktlinsen
zur Therapie.
„Der Mann benötigt zwar aus therapeutischen Gründen eine Sehhilfe, doch eine Brille mit Kunststoffgläsern ist hierfür ausreichend“, erklärt Rechtsanwältin Heike Brüggemann (telefonische
Rechtsberatung unter 0900/1875000-0 für 1,99 Euro pro Minute). Er habe schließlich nicht darlegen können, warum er gerade eine Kontaktlinse und keine Brille benötigt, so das Gericht.
Sturz bei Betriebsausflug: Dienstunfall?
Nürnberg (D-AH/fk) – Stürzt ein Lehrer während eines Schulausflugs und verletzt sich dabei schwer, so handelt es sich um einen Arbeitsunfall, auch wenn sich der Unfall
nicht durch Einwirkung von außen ereignet. So urteilte das Verwaltungsgericht Düsseldorf (Az. 23 K 308/15).
Wie die telefonische Rechtsberatung der Deutschen Anwaltshotline berichtet, hatten sich die Lehrer einer Schule in einem Botel, einem Hotelschiff, einquartiert. Einem Lehrer wurde am Morgen schlecht
und er ging deswegen an Deck um frische Luft zu schnappen. Dort kippte er um und musste sich von seinen Kollegen wieder auf die Beine helfen lassen. Als er daraufhin unter Deck gehen wollte wurde ihm
erneut schwindelig und er stürzte die enge Kajütentreppe hinunter. Dabei brach er sich zwei Halswirbel und ist seitdem querschnittsgelähmt.
Doch das zuständige Amt weigerte sich, den Unfall als Arbeitsunfall anzusehen. Der Sturz habe sich nicht in Zusammenhang mit der Ausübung seines Berufs ereignet. Außerdem beruhe der Sturz nicht auf
äußeren Einwirkungen, sondern habe innere körperliche Gründe gehabt, und das sei bei einem Arbeitsunfall entscheidend. Gegen diese Auffassung wehrte sich der Beamte nun vor Gericht.
Und das zu recht, wie das Verwaltungsgericht Düsseldorf urteilte. Auch bei einem Betriebsausflug handele es sich um eine dienstliche Angelegenheit, denn die Schulleitung bestimmte den
Aufenthaltsort und das Ausflugsziel. „Der Aufenthalt auf dem Schiff war also eine dienstliche Verpflichtung und da ist der Gang an Deck oder in die Kajüte unvermeidlich“, erklärt Rechtsanwalt Frank
Böckhaus (telefonische Rechtsberatung unter 0900/1875000-0 für 1,99 Euro pro Minute). Daher sei der Sturz sehr wohl als Arbeitsunfall zu werten, so das Gericht.
Auch an der äußeren Einwirkung mangele es hier nicht. Denn diese bedürfe nicht zwangsläufig physischer Gewalt, sondern könne auch vom Körper selbst kommen. So sei beispielsweise ein Herzinfarkt
während des Sportunterrichts auch als Arbeitsunfall anzusehen, urteilte das Gericht.
Darf der Vermieter Teppich durch Laminat ersetzen?
Nürnberg (D-AH/fk) – Ein Vermieter darf den Teppichboden gegen den Willen seiner Mieterin nicht ohne Weiteres gegen einen Laminatboden austauschen. Denn dies verändere
den ursprünglichen Zustand der Wohnung gravierend, urteilte das Landgericht Stuttgart (Az. 13 S 154/14).
Wie die telefonische Rechtsberatung der Deutschen Anwaltshotline berichtet, hatte ein Vermieter seine Mieterin aufgefordert, den Teppichboden in ihrer Wohnung durch einen Laminatboden ersetzen zu
lassen. Die war damit jedoch nicht einverstanden. Zwar erklärte sie sich grundsätzlich zu einem neuen Fußboden bereit, da der alte Teppich nach 17 Jahren bereits stark abgenutzt war. Sie wollte aber
auf einen Teppichboden nicht verzichten und verweigerte sich dem Laminat. Der Vermieter zog daraufhin vor Gericht.
Doch das Landgericht Stuttgart stellte sich auf die Seite der Mieterin. Zwar dürfe der Vermieter im Rahmen seiner Erhaltungspflicht, geringfügige Details an der Wohnung verändern. Ein Laminatboden
anstelle eines Teppichs überschreite aber diese Pflicht, so das Landgericht. Es handle sich hierbei um eine wesentliche Abweichung vom Urzustand der Wohnung. „Das ist eher eine
Modernisierungsmaßnahme als ein Erhalt der Wohnung. Und diese hätte formell im Vornherein angekündigt werden müssen“, erklärt Rechtsanwalt Frank Böckhaus (telefonische Rechtsberatung unter
0900/1875000-0 für 1,99 Euro pro Minute).
Der Wunsch der Mieterin, einen Teppichboden und damit das bisherige Wohngefühl beizubehalten, stünde hier vor dem Interesse des Vermieters. Denn das Laminat würde das subjektive Wohngefühl verändern,
und die Mieterin habe sich damals schließlich für eine Wohnung mit Teppich entschieden, erklärte das Landgericht.
Fahrt mit sexistischem Dienstwagen verweigert: Kündigung?
Nürnberg (D-AH/fk) – Wer seiner Arbeit nicht nachkommt, weil er den erforderlichen Dienstwagen für sexistisch hält, dem darf der Arbeitgeber nicht gleich fristlos
kündigen. Jedenfalls nicht, wenn er vorher keine Abmahnung erteilt hat. So urteilte Arbeitsgericht Mönchengladbach (Az. 2 Ca 1765/15).
Wie die telefonische Rechtsberatung der Deutschen Anwaltshotline berichtet, arbeitete ein Verkäufer seit fast 20 Jahren für seinen Betrieb. Er fuhr mit seinem Dienstwagen zu den Kunden und verkaufte
Kaffeemaschinen. Als der Fuhrpark des Unternehmens erneuert wurde, bekam auch sein Dienstwagen neue Werbeaufkleber. Sie zeigten eine spärlich bekleidete Frau in obszöner Pose. Der Angestellte empfand
diese Fahrzeuggestaltung als sexistisch und weigerte sich fortan, seiner Arbeit in diesem Auto nachzugehen. Sein Arbeitgeber kündigte ihm daraufhin fristlos. Doch der Verkäufer wehrte sich und der
Fall ging vor Gericht.
Das Arbeitsgericht Mönchengladbach gab dem Angestellten recht – die Kündigung sei nicht rechtens gewesen. Zwar habe der Mann seine geschuldete Arbeitsleistung verweigert. Doch hätte der Arbeitgeber
ohne Weiteres davon ausgehen können, dass sich das Verhalten des Mitarbeiters mit einer Abmahnung gebessert hätte. „Wenn eine Abmahnung auch geeignet wäre, das Fehlverhalten des Angestellten zu
korrigieren, so ist eine Kündigung unangemessen“, erklärt Rechtsanwältin Petra Nieweg (telefonische Rechtsberatung unter 0900/1875000-0 für 1,99 Euro pro Minute). Die fristlose Kündigung sei nur das
allerletzte Mittel, so das Gericht.
Nur wenn das Fehlverhalten so schwer wiegt, dass es dem Arbeitgeber nicht zuzumuten ist, das Arbeitsverhältnis fortzuführen, ist eine Abmahnung nicht nötig. Doch dies sei hier nicht der Fall,
urteilte das Gericht. Daher sei die fristlose Kündigung unwirksam.
Weniger Lohn bei gleicher Arbeit: Diskriminierung?
Nürnberg (D-AH/fk) – Verdient eine Angestellte aufgrund ihres Geschlechts für dieselbe Arbeit weniger als ihre männliche Kollegen, so hat sie Anspruch auf eine
Entschädigung. So urteilte das Landesarbeitsgericht Rheinland-Pfalz (Az. 4 Sa 12/14).
Wie die telefonische Rechtsberatung der Deutschen Anwaltshotline berichtet, arbeitete eine 56-jährige Mitarbeiterin in der Produktion einer Schuhfabrik. Bei einer Betriebsversammlung kam ans Licht,
dass die angestellten Frauen für die gleiche Arbeit weniger verdienten. Über einen Zeitraum von drei Jahren häufte sich so eine Differenz von durchschnittlich 11.000 Euro an. Damit war die
Angestellte nicht einverstanden. Sie wollte von der Firma die Differenz erstattet bekommen und dazu noch eine Entschädigung erhalten.
Ihr Arbeitgeber sah die Sache aber anders. Es sei betriebsintern stets offen kommuniziert worden, dass weibliche Arbeiterinnen weniger Geld erhalten. Das soll nicht ganz so schlimm sein wie eine
heimliche Diskriminierung. Der Fall ging schließlich vor Gericht.
Das Landesarbeitsgericht Rheinland-Pfalz gab der Angestellten recht und bestätigte auch das Urteil der Vorinstanz. Dabei bezifferte das Gericht die Entschädigung auf 6.000 Euro – wegen der langen und
schweren Ungleichbehandlung. Es liege auf der Hand, dass der einzige Grund für den Verdienstunterschied das Geschlecht ist. „Dabei handelt es sich um eine offensichtliche Diskriminierung der
angestellten Frauen“, erklärt Rechtsanwältin Christina Bethke (telefonische Rechtsberatung unter 0900/1875000-0 für 1,99 Euro pro Minute). Der Betrieb muss der Angestellten also den Differenzbetrag
erstatten. Dass der unterschiedliche Lohn angeblich offen kommuniziert wurde, entlaste den Arbeitgeber dabei nicht, so das Gericht.
Informationen für Mitglieder der Deutschen Anwaltshotline:
Auf der Seite www.jura-ticker.de stellt die Deutsche Anwaltshotline Ihnen kostenlos einen dynamischen Ticker mit täglich wechselnden Rechtsnachrichten zur Verfügung. Sie können diesen von uns entwickelten Ticker in Ihre eigene Homepage einbinden und so den Besuchern Ihrer Website einen neuen und informativen Service bieten.
Alle juristisch interessierten Leser können auch auf der Jura-Ticker-Homepage täglich aktualisierte Rechtsmeldungen studieren.
Als Abonnent unseres Newsletters haben Sie übrigens auch kostenlosen Zugang zum Mitgliederbereich. Sie können dort kostenlos eine Auswahl an anwaltlich geprüften Verträgen und Dokumenten downloaden, z.B. Kfz-Kaufvertrag, Arbeitsvertrag, Patientenverfügung, usw. Sie erhalten dort auch kostenlos Zugriff auf hilfreiche Broschüren, wie etwa zum Thema „Grillen – was ist erlaubt?“ oder „Hartz IV – Alles was wichtig ist“.
Besuchen Sie unseren Mitgliederbereich unter http://www.deutsche-anwaltshotline.de/allgemein/mitglieder/index.php mit folgenden Zugangsdaten (Gross- und Kleinschreibung beachten):
Benutzer: Deutsche-Anwaltshotline
Passwort: rechtlich
Den Mitgliederbereich erreichen Sie auch über den Menüpunkt "für Mitglieder" auf unserer Homepage.
Für alle persönlichen Rechtsfragen stehen Ihnen selbstständige Anwälte über die Deutschen Anwaltshotline von Montag bis Sonntag von 7:00 Uhr morgens - 01:00 nachts Uhr zur Verfügung.
Rufnummer Rechtsberatung: 0900-1-875 000-10 (1,99 Eur/Min*)
*inklusive 19 % Mehrwertsteuer aus dem Festnetz der Deutschen Telekom; ggf. abweichende Preise aus Mobilfunknetzen.
Unter www.deutsche-anwaltshotline.de können Sie auch die direkten Durchwahlen zu über 50 Rechtsgebieten abfragen.
Impressum:
Deutsche Anwaltshotline AG, Am Plärrer 7, 90443 Nürnberg Tel.: +49 911 / 376569-0, Fax: +49 911 / 376569-99
Register und Registernummer: Amtsgericht Nürnberg HRB 24658
Umsatzsteuer-ID: DE261181671
vertreten durch: Johannes Goth, Volker Schwengler, Christian Ulshöfer
Aufsichtsrat: Hartmut Dicke (Vorsitzender), Alexander Keller, Reinhold Gleichmann
Verantwortlicher für journalistisch-redaktionelle Inhalte gem. § 55 II RstV: Engin Aydin, Lars Roedel
die Presse
Zur Abbildung von Prominenten im öffentlichen und im privaten Raum durch die Presse
Pressemitteilung Nr. 17/2017 vom 15. März 2017
Beschlüsse vom 9. Februar 2017 - 1 BvR 2897/14, 1 BvR 790/15; 1 BvR 967/15
Die Zivilgerichte müssen im Rahmen der vorzunehmenden Abwägung das Gewicht der Pressefreiheit bei der Berichterstattung über Ereignisse, die von großem öffentlichen Interesse sind, ausreichend berücksichtigen. Von Bedeutung ist dabei unter anderem, ob sich die abgebildete Person im öffentlichen Raum bewegt. Betrifft die visuelle Darstellung die Privatsphäre oder eine durch räumliche Privatheit geprägte Situation, ist das Gewicht der Belange des Persönlichkeitsschutzes erhöht. Über die sich hieraus näher ergebenden Anforderungen hat die 3. Kammer des Ersten Senats des Bundesverfassungsgerichts in zwei heute veröffentlichten Beschlüssen entschieden.
Sachverhalt:
Gegen den Kläger der Ausgangsverfahren wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Vergewaltigung geführt, in dessen Vorfeld er auch in Untersuchungshaft saß. Das Verfahren endete mit einem Freispruch.
1. Die Beschwerdeführerin und Beklagte des Ausgangsverfahrens im Verfahren 1 BvR 967/15 begleitete den Strafprozess mit einer umfangreichen Berichterstattung. Sie illustrierte die Wortberichterstattung unter anderem mit einem Lichtbild des Klägers, das ihn wenige Meter vom Eingang der Kanzlei seiner Verteidigerin entfernt auf dem Gehweg zeigt. Der Kläger machte letztinstanzlich erfolgreich die Unterlassung der Bildberichterstattung geltend. Hiergegen wendet sich die Beschwerdeführerin mit ihrer Verfassungsbeschwerde. Sie rügt im Wesentlichen die Verletzung ihrer Pressefreiheit.
2. Die Beschwerdeführerinnen in den Verfahren 1 BvR 2897/14 und 1 BvR 790/15 wenden sich gegen zivilgerichtliche Unterlassungsverfügungen, mit denen ihnen untersagt wurde, den Kläger im Innenhof der Kanzlei seiner Verteidigerin im Vorfeld des gegen ihn gerichteten Strafverfahrens abzubilden. Auch sie rügen die Verletzung ihrer Pressefreiheit.
Wesentliche Erwägungen der Kammer:
1. Die Verfassungsbeschwerde im Verfahren 1 BvR 967/15 ist begründet.
a) Im Zentrum der grundrechtlichen Gewährleistung der Pressefreiheit steht das Recht, Art und Ausrichtung sowie Inhalt und Form des Publikationsorgans frei zu bestimmen. Die Vorschriften über die Veröffentlichung fotografischer Abbildungen von Personen enthalten ein abgestuftes Schutzkonzept, das sowohl dem Schutzbedürfnis der abgebildeten Person wie den von den Medien wahrgenommenen Informationsinteressen der Allgemeinheit Rechnung trägt. Für die Gewichtung der Belange des Persönlichkeitsschutzes wird neben den Umständen der Gewinnung der Abbildung auch bedeutsam, in welcher Situation der Betroffene erfasst und wie er dargestellt wird.
b) Diesen verfassungsrechtlichen Anforderungen genügen die angegriffenen Entscheidungen nicht; sie verletzen die Beschwerdeführerin in ihrer Pressefreiheit. Die Gerichte berücksichtigen nicht ausreichend das Gewicht der Pressefreiheit aufgrund des großen öffentlichen Informationsinteresses. Der Kläger durfte nicht die berechtigte Erwartung haben, nicht in den Medien abgebildet zu werden, etwa weil er in Begleitung seiner Verteidigerin abgebildet wurde. Auch hat er sich nicht in einer durch räumliche Privatheit geprägten Situation befunden, sondern in einem öffentlichen Bereich, in dem er aufgrund der Gesamtumstände damit rechnen musste, dass er dort wahrgenommen wird.
2. Die Verfassungsbeschwerden in den Verfahren 1 BvR 2897/14 und 1 BvR 790/15 sind unbegründet. Die den Entscheidungen zugrundeliegende Abwägung ist mit den verfassungsrechtlichen Anforderungen vereinbar. Das Gewicht der mit der Abbildung verbundenen Beeinträchtigungen des Persönlichkeitsrechts ist erhöht, weil sich der Abgebildete in einer durch räumliche Privatheit geprägten Situation in einem vom öffentlichen Raum nur eingeschränkt einsehbaren Innenhof befand. In dieser Situation, in der sich der Abgebildete im Vorfeld des Prozesses auf privates Gelände zurückgezogen hatte, durfte er die berechtigte Erwartung haben, nicht in den Medien abgebildet zu werden.
Ministerpräsidenten in Deutschland
Erfolglose Verfassungsbeschwerde gegen den Auftritt des türkischen Ministerpräsidenten in Deutschland
Pressemitteilung Nr. 16/2017 vom 10. März 2017
Beschluss vom 08. März 2017
2 BvR 483/17
Mit heute veröffentlichtem Beschluss hat die 2. Kammer des Zweiten Senats des Bundesverfassungsgerichts eine vornehmlich gegen den Auftritt des türkischen Ministerpräsidenten Yildirim am 18. Februar 2017 in Oberhausen gerichtete Verfassungsbeschwerde nicht zur Entscheidung angenommen. Zwar haben Staatsoberhäupter und Mitglieder ausländischer Regierungen weder von Verfassungs wegen noch nach einer allgemeinen Regel des Völkerrechts einen Anspruch auf Einreise in das Bundesgebiet und können sich in ihrer amtlichen Eigenschaft auch nicht auf Grundrechte berufen. Die Verfassungsbeschwerde ist jedoch bereits unzulässig, weil der Beschwerdeführer nicht hinreichend substantiiert dargelegt hat, dass er selbst betroffen ist.
Sachverhalt:
Mit seiner Verfassungsbeschwerde wendet sich der Beschwerdeführer dagegen, dass die Bundesregierung es dem türkischen Ministerpräsidenten Yildirim ermöglicht habe, am 18. Februar 2017 in Oberhausen für eine Verfassungsänderung in der Republik Türkei zu werben, sowie gegen weitere im Zusammenhang mit dieser Verfassungsreform stehende öffentliche Auftritte von Regierungsmitgliedern der Republik Türkei in Deutschland. Damit verfolgt er das Ziel, dass Mitglieder der türkischen Regierung sich in ihrer amtlichen Eigenschaft in Deutschland nicht politisch betätigen können.
Wesentliche Erwägungen der Kammer:
Die Verfassungsbeschwerde ist unzulässig.
1. Zwar haben Staatsoberhäupter und Mitglieder ausländischer Regierungen weder von Verfassungs wegen noch nach einer allgemeinen Regel des Völkerrechts einen Anspruch auf Einreise in das Bundesgebiet und die Ausübung amtlicher Funktionen in Deutschland. Hierzu bedarf es der Zustimmung der Bundesregierung, in deren Zuständigkeit für auswärtige Angelegenheiten eine solche Entscheidung fällt. Soweit ausländische Staatsoberhäupter oder Mitglieder ausländischer Regierungen in amtlicher Eigenschaft und unter Inanspruchnahme ihrer Amtsautorität in Deutschland auftreten, können sie sich nicht auf Grundrechte berufen. Denn bei einer Versagung der Zustimmung würde es sich nicht um eine Entscheidung eines deutschen Hoheitsträgers gegenüber einem ausländischen Bürger handeln, sondern um eine Entscheidung im Bereich der Außenpolitik, bei der sich die deutsche und die türkische Regierung auf der Grundlage des Prinzips der souveränen Gleichheit der Staaten begegnen.
2. Der Beschwerdeführer hat jedoch nicht hinreichend substantiiert dargelegt, dass er durch die nicht näher bezeichneten Maßnahmen bzw. Unterlassungen der Bundesregierung selbst betroffen ist. Vor diesem Hintergrund hat er keinen subjektiven Anspruch darauf, dass die Bundesregierung ihr Ermessen in auswärtigen Angelegenheiten in einer bestimmten Richtung ausübt.
Verfassungsbeschwerde gegen die Änderung der gesetzlichen Bewertung von in der DDR zurückgelegten rentenrechtlichen Zeiten erfolglos
Pressemitteilung Nr. 5/2017 vom 18. Januar 2017
Beschluss vom 13. Dezember 2016
1 BvR 713/13
Mit heute veröffentlichtem Beschluss hat die 1. Kammer des Ersten Senats des Bundesverfassungsgerichts eine Verfassungsbeschwerde gegen die geänderte Bewertung in der DDR zurückgelegter rentenversicherungsrechtlicher Zeiten von Personen, die vor dem 18. Mai 1990 aus der DDR in die damalige Bundesrepublik übersiedelten, nicht zur Entscheidung angenommen. Der davon benachteiligte Beschwerdeführer hat sich weder hinreichend mit der der geänderten Rentenberechnung zugrundeliegenden Rechtslage auseinandergesetzt noch einen Verstoß gegen Grundrechte schlüssig dargelegt.
Sachverhalt:
Übersiedler aus der DDR wurden, weil sie bis zum Fall der Mauer infolge ihrer Flucht den für sie zuständigen Rentenversicherungsträger der DDR nicht mehr in Anspruch nehmen konnten, durch das Fremdrentengesetz (FRG) so gestellt, als hätten sie ihre rentenrechtlichen Beitragszeiten in der Bundesrepublik erbracht. Nach der Wiedervereinigung sah das im Einigungsvertrag vorgesehene Gesetz zur Herstellung der Rechtseinheit in der gesetzlichen Renten- und Unfallversicherung (Rentenüberleitungsgesetz – RÜG) vom 25. Juli 1991 eine Anwendbarkeit des FRG nur noch übergangsweise für Versicherte mit einem Rentenbeginn vor dem 1. Januar 1996 vor. Zur Verwaltungsvereinfachung wurde diese Regelung anschließend noch dahingehend geändert, dass die Vertrauensschutzregelung (§ 259a Sozialgesetzbuch Sechstes Buch - SGB VI) nicht mehr auf den Zeitpunkt des tatsächlichen Rentenbeginns bezogen ist, sondern für alle Versicherten gilt, die vor dem 1. Januar 1937 geboren sind und damit bei Inkrafttreten des RÜG bereits das 55. Lebensjahr vollendet hatten, während für die jüngeren Versicherten die allgemeinen Regeln zur Rentenüberleitung maßgeblich sind. Diese Rentenberechnung kann zu einer geringeren Rente als bei Anwendung des FRG führen, weil mit dem FRG Übersiedlern für ihre in der DDR zurückgelegte Erwerbsbiographie Rentenansprüche entsprechend dem westdeutschen Rentensystem gutgeschrieben wurden, nunmehr aber auf die in der DDR tatsächlich in die Rentenversicherung eingezahlten - unter Umständen geringeren - Beiträge abgestellt wird.
Mit seiner Verfassungsbeschwerde wendet sich der Beschwerdeführer, der zu der Gruppe der von diesen Regelungen nachteilig Betroffenen gehört, gegen ihn hinsichtlich der Feststellung seiner Versicherungszeit im Beitrittsgebiet belastende Rentenbescheide und die dazu ergangenen Gerichtsentscheidungen. Er rügt im Wesentlichen eine Verletzung von Art. 14 Abs. 1 GG und Art. 3 Abs. 1 GG.
Wesentliche Erwägungen der Kammer:
Die Verfassungsbeschwerde ist nicht zur Entscheidung anzunehmen.
1. Art. 14 Abs. 1 GG schützt Rentenansprüche und auch Rentenanwartschaften, soweit diese im Geltungsbereich des Grundgesetzes erworben worden sind. Nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts unterliegen hingegen durch das FRG begründete Rentenanwartschaften nicht dem Schutz des Art. 14 Abs. 1 GG, wenn ihnen ausschließlich Beitrags- und Beschäftigungszeiten zugrunde liegen, die in den Herkunftsgebieten erbracht oder zurückgelegt wurden. Eigentumsgeschützte Rechtspositionen werden mangels Eigenleistung der Berechtigten durch das FRG nicht begründet.
In der DDR begründete und im Zeitpunkt ihres Beitritts zur Bundesrepublik bestehende Rentenanwartschaften nehmen zwar als Rechtspositionen, die der Einigungsvertrag grundsätzlich anerkannt hat, am Schutz des Art. 14 Abs. 1 GG teil. Der verfassungsrechtliche Eigentumsschutz kommt den Rentenanwartschaften aber nur in der Form zu, die sie aufgrund des Vertrages zwischen der Bundesrepublik und der DDR über die Herstellung der Einheit Deutschlands erhalten haben. Aus Art. 30 Abs. 5 Satz 1 des Einigungsvertrages ergibt sich, dass die Einzelheiten der Überleitung des SGB VI auf das Beitrittsgebiet in einem Bundesgesetz geregelt werden.
Das Bundeverfassungsgericht hat zwar bislang nicht über die im hiesigen Verfahren von den Fachgerichten verneinte Frage entschieden, ob die von den Berechtigten aus dem FRG abgeleiteten Anwartschaften dem Eigentumsschutz des Art. 14 Abs. 1 GG dann unterliegen, wenn sie sich zusammen mit den in der gesetzlichen Rentenversicherung der Bundesrepublik erworbenen Rentenanwartschaften zu einer rentenrechtlichen Gesamtrechtsposition verbinden. Die Begründung der Verfassungsbeschwerde genügt jedoch nicht den sich aus §§ 23 Abs. 1 Satz 2, 92 BVerfGG ergebenden Anforderungen. Das Vorbringen des Beschwerdeführers setzt sich weder mit der aus den gesetzlichen Regelungen folgenden Pflicht zur Bewertung von im Beitrittsgebiet zurückgelegten rentenrechtlichen Zeiten nach dem FRG über den Anwendungsbereich des § 259a SGB VI hinaus auseinander, noch enthält es eine ins Einzelne gehende argumentative Auseinandersetzung mit den angegriffenen Entscheidungen und ihren konkreten Begründungen.
2. Auch legt der Beschwerdeführer nicht substantiiert dar, dass die mit der Änderung der Bewertung der in der DDR zurückgelegten rentenrechtlichen Zeiten verbundene sogenannte unechte Rückwirkung ausnahmsweise unzulässig wäre. Der Beschwerdeführer setzt sich nicht hinreichend mit der Frage der Schutzwürdigkeit seines Vertrauens im Hinblick auf die fortwährende Bewertung seiner im Beitrittsgebiet zurückgelegten rentenrechtlichen Zeiten nach dem Fremdrentengesetz auseinander. Allein das Vertrauen in den Fortbestand einer gesetzlichen Lage ist nicht schutzwürdig.
3. Auch ein Verstoß gegen Art. 3 Abs. 1 GG ergibt sich aus dem Vorbringen des Beschwerdeführers nicht hinreichend. Der allgemeine Gleichheitssatz gebietet dem Gesetzgeber, wesentlich Gleiches gleich und wesentlich Ungleiches ungleich zu behandeln. Die Begründung der Verfassungsbeschwerde lässt indes bereits eine nachvollziehbare Vergleichsgruppenbildung nicht erkennen.
Durchsetzung ihrer verfassungsfeindlichen Ziele
Kein Verbot der NPD wegen fehlender Anhaltspunkte für eine erfolgreiche Durchsetzung ihrer verfassungsfeindlichen Ziele
Pressemitteilung Nr. 4/2017 vom 17. Januar 2017
Urteil vom 17. Januar 2017 - 2 BvB 1/13
Die Nationaldemokratische Partei Deutschlands (NPD) vertritt ein auf die Beseitigung der bestehenden freiheitlichen demokratischen Grundordnung gerichtetes politisches Konzept. Sie will die bestehende Verfassungsordnung durch einen an der ethnisch definierten „Volksgemeinschaft“ ausgerichteten autoritären Nationalstaat ersetzen. Ihr politisches Konzept missachtet die Menschenwürde und ist mit dem Demokratieprinzip unvereinbar. Die NPD arbeitet auch planvoll und mit hinreichender Intensität auf die Erreichung ihrer gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung gerichteten Ziele hin. Allerdings fehlt es (derzeit) an konkreten Anhaltspunkten von Gewicht, die es möglich erscheinen lassen, dass dieses Handeln zum Erfolg führt, weshalb der Zweite Senat des Bundesverfassungsgerichts den zulässigen Antrag des Bundesrats auf Feststellung der Verfassungswidrigkeit und Auflösung der NPD und ihrer Unterorganisationen (Art. 21 Abs. 2 GG) mit heute verkündetem Urteil einstimmig als unbegründet zurückgewiesen hat.
Wesentliche Erwägungen des Senats:
1. Der Verbotsantrag ist zulässig. Der Durchführung des Verfahrens steht weder ein Verstoß gegen das Gebot strikter Staatsfreiheit noch eine Verletzung des Grundsatzes des fairen Verfahrens entgegen. Der Antragsteller hat zur Überzeugung des Gerichts dargetan, dass alle V-Leute auf den Führungsebenen der NPD spätestens zum Zeitpunkt des Bekanntmachens der Absicht, einen Verbotsantrag zu stellen, abgeschaltet waren und eine informationsgewinnende Nachsorge unterblieben ist. Auch ist davon auszugehen, dass die Prozessstrategie der NPD nicht mit nachrichtendienstlichen Mitteln ausgespäht wurde und hinreichende Vorkehrungen getroffen worden sind, um im Rahmen der Beobachtung der NPD hierüber zufällig erlangte Erkenntnisse nicht zu deren Lasten zu verwenden.
2. Der Antragsteller begehrt gemäß Art. 21 Abs. 2 GG in Verbindung mit §§ 43 ff. BVerfGG die Feststellung, dass die NPD verfassungswidrig ist, weil sie nach ihren Zielen oder dem Verhalten ihrer Anhänger darauf ausgeht, die freiheitliche demokratische Grundordnung zu beeinträchtigen. Dem sind folgende Maßstäbe zugrunde zu legen:
a) Der Begriff der freiheitlichen demokratischen Grundordnung im Sinne von Art. 21 Abs. 2 GG beinhaltet die zentralen Grundprinzipien, die für den freiheitlichen Verfassungsstaat schlechthin unentbehrlich sind. Ihren Ausgangspunkt findet die freiheitliche demokratische Grundordnung in der Würde des Menschen (Art. 1 Abs. 1 GG). Die Garantie der Menschenwürde umfasst insbesondere die Wahrung personaler Individualität, Identität und Integrität sowie die elementare Rechtsgleichheit. Auf rassistische Diskriminierung zielende Konzepte sind damit nicht vereinbar. Daneben sind im Rahmen des Demokratieprinzips die Möglichkeit gleichberechtigter Teilhabe aller Bürgerinnen und Bürger am Prozess der politischen Willensbildung und die Rückbindung der Ausübung aller Staatsgewalt an das Volk (Art. 20 Abs. 1 und 2 GG) konstitutive Bestandteile der freiheitlichen demokratischen Grundordnung. Hinsichtlich des Rechtsstaatsprinzips gilt dies für die Rechtsbindung der öffentlichen Gewalt, die Kontrolle dieser Bindung durch unabhängige Gerichte und das staatliche Gewaltmonopol.
b) Der Begriff des Beseitigens im Sinne des Art. 21 Abs. 2 GG bezeichnet die Abschaffung zumindest eines der Wesenselemente der freiheitlichen demokratischen Grundordnung oder deren Ersetzung durch eine andere Verfassungsordnung oder ein anderes Regierungssystem. Von einem Beeinträchtigen ist auszugehen, wenn eine Partei nach ihrem politischen Konzept mit hinreichender Intensität eine spürbare Gefährdung eines der Wesenselemente der freiheitlichen demokratischen Grundordnung bewirkt.
c) Dass eine Partei die Beeinträchtigung oder Beseitigung der freiheitlichen demokratischen Grundordnung anstrebt, muss sich aus den Zielen oder dem Verhalten ihrer Anhänger ergeben. Die Ziele einer Partei sind der Inbegriff dessen, was eine Partei (offen oder verdeckt) politisch anstrebt. Anhänger sind alle Personen, die sich für eine Partei einsetzen und sich zu ihr bekennen, auch wenn sie nicht Mitglied der Partei sind. Zuzurechnen sind einer Partei grundsätzlich die Tätigkeit der Parteiführung, leitender Funktionäre (auch von Teilorganisationen) und Äußerungen in Publikationsorganen der Partei. Bei Äußerungen oder Handlungen einfacher Mitglieder oder von Anhängern, die nicht der Partei angehören, ist entscheidend, dass in deren Verhalten der politische Wille der Partei erkennbar zum Ausdruck kommt. Dies ist regelmäßig der Fall, wenn das Verhalten eine in der Partei vorhandene Grundtendenz widerspiegelt oder die Partei sich dieses Verhalten ausdrücklich zu Eigen gemacht hat.
d) Das Parteiverbot erfordert ein „Ausgehen“ auf die Beeinträchtigung oder Beseitigung der freiheitlichen demokratischen Grundordnung. Es ist kein Gesinnungs- oder Weltanschauungsverbot. Vielmehr muss die Partei über das Bekennen ihrer verfassungsfeindlichen Ziele hinaus die Grenze zum Bekämpfen der freiheitlichen demokratischen Grundordnung überschreiten. Dies setzt voraus, dass sie sich durch aktives und planvolles Handeln für ihre Ziele einsetzt und auf die Beeinträchtigung oder Beseitigung der freiheitlichen demokratischen Grundordnung hinwirkt. Nicht erforderlich ist, dass das Handeln der Partei zu einer konkreten Gefahr für die Schutzgüter des Art. 21 Abs. 2 Satz 1 GG führt. Es müssen jedoch konkrete Anhaltspunkte von Gewicht vorliegen, die es zumindest möglich erscheinen lassen, dass das Handeln der Partei erfolgreich sein kann (Potentialität). Lässt das Handeln einer Partei dagegen noch nicht einmal auf die Möglichkeit eines Erreichens ihrer verfassungsfeindlichen Ziele schließen, bedarf es des präventiven Schutzes der Verfassung durch ein Parteiverbot nicht. An der abweichenden Definition im KPD-Urteil, nach der es einem Parteiverbot nicht entgegenstehe, wenn für die Partei nach menschlichem Ermessen keine Aussicht darauf besteht, dass sie ihre verfassungswidrige Absicht in absehbarer Zukunft werde verwirklichen können (BVerfG 5, 85 <143>), hält der Senat nicht fest.
e) Für die Annahme weiterer (ungeschriebener) Tatbestandsmerkmale ist im Rahmen des Art. 21 Abs. 2 GG kein Raum. Weder findet der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit im Parteiverbotsverfahren Anwendung, noch kommt der Wesensverwandtschaft einer Partei mit dem Nationalsozialismus eine die Tatbestandsmerkmale des Art. 21 Abs. 2 GG ersetzende Funktion zu. Allerdings kann die Wesensverwandtschaft mit dem Nationalsozialismus indizielle Bedeutung hinsichtlich der Verfolgung verfassungsfeindlicher Ziele einer Partei entfalten.
3. Nach diesen Maßstäben ist der Verbotsantrag unbegründet.
a) Das politische Konzept der NPD ist auf die Beseitigung der freiheitlichen demokratischen Grundordnung gerichtet.
aa) Der von der NPD vertretene Volksbegriff verletzt die Menschenwürde. Er negiert den sich hieraus ergebenden Achtungsanspruch der Person und führt zur Verweigerung elementarer Rechtsgleichheit für alle, die nicht der ethnisch definierten „Volksgemeinschaft“ in ihrem Sinne angehören. Das Politikkonzept der NPD ist auf die Ausgrenzung, Verächtlichmachung und weitgehende Rechtlosstellung von gesellschaftlichen Gruppen (Ausländern, Migranten, religiösen und sonstigen Minderheiten) gerichtet.
bb) Darüber hinaus missachtet die NPD die freiheitliche demokratische Grundordnung auch mit Blick auf das Demokratieprinzip. In einem durch die „Einheit von Volk und Staat“ geprägten Nationalstaat im Sinne der NPD ist für eine Beteiligung ethnischer Nichtdeutscher an der politischen Willensbildung grundsätzlich kein Raum. Dieses Konzept widerspricht dem im menschenrechtlichen Kern des Demokratieprinzips wurzelnden Anspruch auf gleichberechtigte Teilhabe aller Staatsangehörigen an der politischen Willensbildung. Außerdem tritt die NPD für die Abschaffung des bestehenden parlamentarisch-repräsentativen Systems und seine Ersetzung durch einen am Prinzip der „Volksgemeinschaft“ orientierten Nationalstaat ein.
cc) Die NPD weist eine Wesensverwandtschaft mit dem Nationalsozialismus auf. Das Konzept der „Volksgemeinschaft“, die antisemitische Grundhaltung und die Verächtlichmachung der bestehenden demokratischen Ordnung lassen deutliche Parallelen zum Nationalsozialismus erkennen. Hinzu kommen das Bekenntnis zu Führungspersönlichkeiten der NSDAP, der punktuelle Rückgriff auf Vokabular, Texte, Liedgut und Symbolik des Nationalsozialismus sowie geschichtsrevisionistische Äußerungen, die eine Verbundenheit zumindest relevanter Teile der NPD mit der Vorstellungswelt des Nationalsozialismus dokumentieren. Die Wesensverwandtschaft der NPD mit dem Nationalsozialismus bestätigt deren Missachtung der freiheitlichen demokratischen Grundordnung.
b) Einem Verbot der NPD steht aber entgegen, dass das Tatbestandsmerkmal des „Darauf Ausgehens“ im Sinne von Art. 21 Abs. 2 Satz 1 GG nicht erfüllt ist. Die NPD bekennt sich zwar zu ihren gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung gerichteten Zielen und arbeitet planvoll auf deren Erreichung hin, so dass sich ihr Handeln als qualifizierte Vorbereitung der von ihr angestrebten Beseitigung der freiheitlichen demokratischen Grundordnung darstellt. Es fehlt jedoch an konkreten Anhaltspunkten von Gewicht, die eine Durchsetzung der von ihr verfolgten verfassungsfeindlichen Ziele möglich erscheinen lassen. Weder steht eine erfolgreiche Durchsetzung dieser Ziele im Rahmen der Beteiligung am Prozess der politischen Willensbildung in Aussicht (aa), noch ist der Versuch einer Erreichung dieser Ziele durch eine der NPD zurechenbare Beeinträchtigung der Freiheit der politischen Willensbildung in hinreichendem Umfang feststellbar (bb).
aa) Ein Erreichen der verfassungswidrigen Ziele der NPD mit parlamentarischen oder außerparlamentarischen demokratischen Mitteln erscheint ausgeschlossen.
(1) Im parlamentarischen Bereich verfügt die NPD weder über die Aussicht, bei Wahlen eigene Mehrheiten zu gewinnen, noch über die Option, sich durch die Beteiligung an Koalitionen eigene Gestaltungsspielräume zu verschaffen. Auf überregionaler Ebene ist sie gegenwärtig lediglich mit einem Abgeordneten im Europäischen Parlament vertreten. Die Wahlergebnisse bei Europa- und Bundestagswahlen stagnieren auf niedrigem Niveau. Die NPD hat es in den mehr als fünf Jahrzehnten ihres Bestehens nicht vermocht, dauerhaft in einem Landesparlament vertreten zu sein. Anhaltspunkte für eine künftige Veränderung dieser Entwicklung fehlen. Hinzu kommt, dass die sonstigen in den Parlamenten auf Bundes- und Landesebene vertretenen Parteien zu Koalitionen oder auch nur punktuellen Kooperationen mit der NPD bisher nicht bereit sind. Trotz ihrer Präsenz in den Kommunalparlamenten ist ein bestimmender Einfluss auf die politische Willensbildung auch in den kommunalen Vertretungskörperschaften weder gegeben noch zukünftig zu erwarten.
(2) Auch durch die Beteiligung am Prozess der politischen Willensbildung mit demokratischen Mitteln außerhalb des parlamentarischen Handelns hat die NPD in absehbarer Zeit keine Möglichkeit ihre verfassungsfeindlichen Ziele erfolgreich zu verfolgen. Vielmehr stehen einer nachhaltigen Beeinflussung der außerparlamentarischen politischen Willensbildung durch die NPD deren niedriger und tendenziell rückläufiger Organisationsgrad sowie ihre eingeschränkte Kampagnenfähigkeit und geringe Wirkkraft in die Gesellschaft entgegen. Eine Gesamtzahl von weniger als 6.000 Mitgliedern führt zu einer erheblichen Beschränkung der Aktionsmöglichkeiten der NPD. Es ist nicht ersichtlich, dass sie ihre strukturellen Defizite und ihre geringe Wirkkraft durch ihre Öffentlichkeitsarbeit oder die Umsetzung der „Kümmerer-Strategie“ im Wege „national-revolutionärer Graswurzelarbeit“ kompensieren könnte. Auch fehlen Belege, dass es der NPD gelingt, mit ihren asyl- und ausländerpolitischen Aktivitäten zusätzliche Unterstützung für ihre verfassungsfeindlichen Absichten in relevantem Umfang zu gewinnen. Ebenso hat sie es nicht vermocht ‑ abgesehen von punktuellen Kooperationen ‑ ihre Wirkkraft in die Gesellschaft durch die Schaffung rechtsextremer Netzwerke unter ihrer Führung zu erhöhen.
bb) Konkrete Anhaltspunkte von Gewicht, die darauf hindeuten, dass die NPD die Grenzen des zulässigen politischen Meinungskampfes in einer das Tatbestandsmerkmal des „Darauf Ausgehens“ erfüllenden Weise überschreitet, liegen ebenfalls nicht vor. Sie vermag Dominanzansprüche in abgegrenzten Sozialräumen nicht in relevantem Umfang zu verwirklichen. Der Kleinstort Jamel stellt einen Sonderfall dar, der nicht verallgemeinerungsfähig ist. Sonstige Beispiele erfolgreicher Umsetzung räumlicher Dominanzansprüche sind nicht ersichtlich. Eine Grundtendenz der NPD zur Durchsetzung ihrer verfassungsfeindlichen Absichten mit Gewalt oder durch die Begehung von Straftaten kann den im Verfahren geschilderten Einzelfällen (noch) nicht entnommen werden. Schließlich fehlen hinreichende Anhaltspunkte für die Schaffung einer Atmosphäre der Angst, die zu einer spürbaren Beeinträchtigung der Freiheit des Prozesses der politischen Willensbildung führt oder führen könnte. Der Umstand, dass die NPD durch einschüchterndes oder kriminelles Verhalten von Mitgliedern und Anhängern punktuell eine nachvollziehbare Besorgnis um die Freiheit des politischen Prozesses oder gar Angst vor gewalttätigen Übergriffen auszulösen vermag, ist nicht zu verkennen, erreicht aber die durch Art. 21 Abs. 2 GG markierte Schwelle nicht. Auf Einschüchterung und Bedrohung sowie den Aufbau von Gewaltpotentialen muss mit den Mitteln des präventiven Polizeirechts und des repressiven Strafrechts rechtzeitig und umfassend reagiert werden, um die Freiheit des politischen Prozesses ebenso wie einzelne vom Verhalten der NPD Betroffene wirkungsvoll zu schützen.
persönliche Anmerkung:
Was muss noch passieren, dass diese faschistische Partei verboten wird. Wieviele Menschen müssen noch sterben oder seelisch wie körperlich ihr Leben lang leiden, weil sie Opfer rechtsextremer Übergriffe, Bedrohungen oder massiven Einschüchterungen betroffen sind. Wenn das Verfassungsgericht solange benötigt, um eine solch wichtige Entscheidung zu treffen, dann könnte es künftig passieren, dass der Staat selbst nicht mehr zu retten ist, weil die Nazis schon ihre faschistische Diktatur errichtet haben.
Mit dieser Begründung, müsste zwangsläufig das Verbotsurteil der KPD von 1956 aufgehoben werden!!!!
Die Dreizehnte Novelle des Atomgesetzes ist im Wesentlichen mit dem Grundgesetz vereinbar
Pressemitteilung Nr. 88/2016 vom 6. Dezember 2016
Urteil vom 06. Dezember 2016
1 BvR 2821/11, 1 BvR 1456/12, 1 BvR 321/12
Die Regelungen des Dreizehnten Gesetzes zur Änderung des Atomgesetzes vom 31. Juli 2011 („13. AtG-Novelle“) erweisen sich weitgehend als eine zumutbare und auch die Anforderungen des Vertrauensschutzes und des Gleichbehandlungsgebots wahrende Bestimmung von Inhalt und Schranken des Eigentums. Dies hat der Erste Senat des Bundesverfassungsgerichts mit heute verkündetem Urteil entschieden. Die 13. AtG-Novelle verletzt die Eigentumsgarantie (Art. 14 GG) jedoch insoweit, als die Einführung fester Abschalttermine für die in Deutschland betriebenen Kernkraftwerke (§ 7 Abs. 1a Satz 1 Atomgesetz in der Fassung der 13. AtG-Novelle), einen konzerninternen Verbrauch der im Jahr 2002 jedem Kernkraftwerk gesetzlich zugewiesenen Stromerzeugungskontingente bis zu den festgesetzten Abschaltdaten nicht sicherstellt. Hierdurch werden die durch die Eigentumsgarantie geschützten Nutzungsmöglichkeiten der Anlagen unzumutbar, teilweise auch gleichheitswidrig beschränkt. Demgegenüber steht die Streichung der mit dem Elften Gesetz zur Änderung des Atomgesetzes vom 8. Dezember 2010 („11. AtG-Novelle“) den einzelnen Kernkraftwerken zusätzlich gewährten Stromerzeugungskontingente in Einklang mit dem Grundgesetz. Mit Art. 14 GG unvereinbar ist ferner, dass die 13. AtG-Novelle keine Regelung zum Ausgleich für Investitionen vorsieht, die im berechtigten Vertrauen auf die im Jahr 2010 zusätzlich gewährten Stromerzeugungskontingente vorgenommen, durch deren Streichung mit der 13. AtG-Novelle aber entwertet wurden. § 7 Abs. 1a Satz 1 Atomgesetz ist zunächst weiter anwendbar; der Gesetzgeber muss bis 30. Juni 2018 eine Neuregelung treffen.
Sachverhalt:
Die Verfassungsbeschwerden richten sich gegen die im Jahr 2011 beschlossene Beschleunigung des Ausstiegs aus der friedlichen Nutzung der Kernenergie. Die Grundentscheidung für den Ausstieg erfolgte bereits durch die Ausstiegsnovelle im Jahr 2002. Den einzelnen Kernkraftwerken wurden Kontingente an Reststrommengen zugeteilt, die auch auf andere, jüngere Kernkraftwerke übertragen werden durften. Nach deren Verbrauch waren die Kraftwerke abzuschalten. Ein festes Enddatum enthielt das Ausstiegsgesetz aus dem Jahr 2002 nicht. Nach der Bundestagswahl 2009 entschied sich die neue Bundesregierung für ein verändertes Energiekonzept, das die Kernenergie noch für einen längeren Zeitraum als „Brückentechnologie“ nutzen sollte. Demgemäß gewährte der Gesetzgeber mit der 11. AtG-Novelle allen Kernkraftwerken zusätzliche Reststrommengen und verfolgte damit das Ziel einer Verlängerung der Laufzeiten der deutschen Kernkraftwerke um durchschnittlich 12 Jahre. Infolge des Tsunamis vom 11. März 2011 und dem dadurch ausgelösten Schmelzen von drei Reaktorkernen im Kernkraftwerk Fukushima in Japan hat der Gesetzgeber mit der 13. AtG-Novelle erstmals feste Endtermine für den Betrieb der Kernkraftwerke gesetzlich verankert und zugleich die durch die 11. AtG-Novelle im Herbst 2010 vorgenommene Laufzeitverlängerung der Kernkraftwerke rückgängig gemacht. Hiergegen wenden sich die Kernkraftgesellschaften von drei der vier großen in Deutschland tätigen Energieversorgungsunternehmen sowie eine Kernkraftwerksbetriebsgesellschaft mit ihren Verfassungsbeschwerden. Nicht Gegenstand der Verfassungsbeschwerden ist hingegen die mit dem Ausstiegsgesetz von 2002 getroffene Grundsatzentscheidung über die Beendigung der friedlichen Nutzung der Kernenergie in Deutschland. Die verfassungsrechtliche Kontrolle der angegriffenen 13. AtG-Novelle setzt damit auf einer Rechtslage auf, nach der die Beendigung des Leistungsbetriebs der Kernkraftwerke nach Maßgabe der ihnen zugeteilten Elektrizitätsmengen bereits feststand. Die Beschwerdeführerinnen rügen vornehmlich eine Verletzung der Eigentumsfreiheit (Art. 14 Abs. 1 GG).
Wesentliche Erwägungen des Senats:
Die Verfassungsbeschwerden sind zulässig und teilweise begründet.
1. Die beiden Beschwerdeführerinnen im Verfahren 1 BvR 1456/12 sind ausnahmsweise berechtigt, Verfassungsbeschwerde gegen die 13. AtG-Novelle zu erheben, obwohl der schwedische Staat mittelbar Geschäftsanteile an der einen zu 100 % und an der anderen zu 50 % hält. Die für die Verneinung der Grundrechtsfähigkeit juristischer Personen des öffentlichen Rechts und juristischer Personen des Privatrechts, welche ganz oder überwiegend vom deutschen Staat gehalten werden, maßgeblichen Erwägungen gelten für inländische juristische Personen des Privatrechts, die von einem ausländischen Staat gehalten werden, nicht uneingeschränkt. Wird ihnen die Erhebung der Verfassungsbeschwerde verwehrt, bleiben sie gegenüber unmittelbaren gesetzlichen Eingriffen ohne Rechtsschutzmöglichkeit. Denn der fachgerichtliche Verwaltungsrechtsschutz greift regelmäßig nicht unmittelbar gegen Gesetze. Auch verfügt eine von einem ausländischen Staat gehaltene juristische Person des Privatrechts weder unmittelbar noch mittelbar über innerstaatliche Machtbefugnisse. Insbesondere steht ihr innerhalb der Staatsorganisation keine Möglichkeit der Interessenwahrnehmung zur Verfügung. Angesichts dieser besonderen Umstände des Falles ist die insoweit offene Auslegung des Art. 19 Abs. 3 GG auch mit Blick auf die unionsrechtlich geschützte Niederlassungsfreiheit vorzunehmen. Ohne die Möglichkeit einer Verfassungsbeschwerde bedürfte es angesichts der schweren Beeinträchtigung der Beschwerdeführerinnen durch die 13. AtG-Novelle der Rechtfertigung vor der Niederlassungsfreiheit. Da es vorliegend an den Voraussetzungen für die Rechtfertigung fehlen würde, ist den Beschwerdeführerinnen die Gesetzesverfassungsbeschwerde gegen die 13. AtG-Novelle zu eröffnen.
2. Das Eigentum der Beschwerdeführerinnen wird durch die 13. AtG-Novelle in mehrfacher Hinsicht beeinträchtigt.
a) Die Eigentumsgarantie schützt den konkreten Bestand in der Hand der einzelnen Eigentümer gegenüber Maßnahmen der öffentlichen Gewalt. Die Reichweite des Schutzes ergibt sich erst aus der Bestimmung von Inhalt und Schranken des Eigentums, die Sache des Gesetzgebers ist. Seine Befugnis zur Inhalts- und Schrankenbestimmung ist umso weiter, je stärker der soziale Bezug des Eigentumsobjekts ist. Bei Kernkraftwerken und damit in Zusammenhang stehenden Eigentumsrechtspositionen handelt es sich um Eigentum mit einem besonders ausgeprägten sozialen Bezug. Dies verschafft dem Gesetzgeber bei der Ausgestaltung des Atomrechts einen besonders weiten Gestaltungsspielraum, auch gegenüber bestehenden Eigentumspositionen, ohne diesen jedoch jeglichen Schutz zu nehmen.
b) Die 13. AtG-Novelle greift in mehrfacher Hinsicht in Eigentumspositionen der Beschwerdeführerinnen ein. Sie bestimmt erstmals feste Termine für das Erlöschen der Berechtigung zum Leistungsbetrieb der einzelnen Kernkraftwerke. Mit dem Ende der Betriebsberechtigung entfällt das aus dem Eigentum an den Grundstücken und Anlagen fließende Nutzungsrecht der Stromerzeugung aus Kernkraft. Diese Beeinträchtigung geht über die bereits vorhandene Vorbelastung durch den 2002 gesetzlich beschlossenen Atomausstieg hinaus, die im Übrigen nicht Gegenstand der Verfassungsbeschwerden ist. Aufgrund der 2011 geregelten festen Endzeitpunkte des Leistungsbetriebs werden die im Jahr 2002 zugewiesenen Reststrommengen bei zwei der Beschwerdeführerinnen aller Voraussicht nach weder in dem jeweiligen Kernkraftwerk, dem sie zugeteilt wurden, noch in anderen Kraftwerken desselben Konzerns produziert werden können. Zudem werden die den Kernkraftwerken erst kurz zuvor mit der 11. AtG-Novelle zusätzlich zugewiesenen Reststrommengen wieder gestrichen. Schließlich können die Einführung fester Abschalttermine und die Streichung der Stromzusatzmengen dazu führen, dass im Vertrauen auf die bestehende Rechtslage vorgenommene Investitionen hinfällig werden.
c) Die Eigentumsgarantie ist dadurch in verschiedenen Ausprägungen betroffen. Vom Schutz des Eigentums nach Art. 14 Abs. 1 Satz 1 GG umfasst ist das zivilrechtliche Sacheigentum, dessen Besitz und die Möglichkeit, es zu nutzen. Die Regelungen der 13. AtG-Novelle treffen auf Anlageneigentum der Beschwerdeführerinnen, dessen Nutzung atomrechtlich genehmigt ist und das durch diese Genehmigungen konkretisiert ist. Die atomrechtliche Genehmigung zur Errichtung und zum Betrieb einer Kernkraftwerksanlage oder die Genehmigung zum Leistungsbetrieb (§ 7 Abs. 1 und 1a AtG) selbst sind kein nach Art. 14 GG geschütztes Eigentumsrecht. Sie sind nicht vergleichbar jenen subjektiven öffentlichen Rechten, denen nach gefestigter verfassungsgerichtlicher Rechtsprechung Eigentumsschutz zuerkannt wird. Die im Jahr 2002 zugeteilten Reststrommengen genießen keinen eigenständigen Schutz, haben aber Teil an dem verfassungsrechtlichen Eigentumsschutz, den Art. 14 GG für die Nutzung des Eigentums an einer zugelassenen kerntechnischen Anlage gewährt. Eine Sonderstellung nehmen die dem Kernkraftwerk Mülheim-Kärlich zugewiesenen Reststrommengen ein, weil deren Zuschreibung im Rahmen eines Vergleichs als Gegenleistung für die Beendigung des Amtshaftungsprozesses gegen das Land Rheinland-Pfalz und für die Rücknahme des Antrags auf Erteilung einer atomrechtlichen Betriebsgenehmigung für das Kernkraftwerk erfolgte. Ein entsprechender Eigentumsschutz an der Nutzung der Kernkraftwerke kommt auch den mit der 11. AtG-Novelle zugewiesenen Zusatzstrommengen mit Blick auf die dadurch eröffneten Nutzungsmöglichkeiten zu.
3. Die angegriffenen Bestimmungen der 13. AtG-Novelle führen nicht zu einer Enteignung der Beschwerdeführerinnen an den genannten Eigentumsrechten.
a) Die Enteignung ist auf die vollständige oder teilweise Entziehung konkreter subjektiver Eigentumspositionen zur Erfüllung bestimmter öffentlicher Aufgaben gerichtet. Die Enteignung im Sinne des Art. 14 Abs. 3 GG setzt weiterhin zwingend voraus, dass der hoheitliche Zugriff auf das Eigentumsrecht zugleich eine Güterbeschaffung zugunsten der öffentlichen Hand oder des sonst Enteignungsbegünstigten ist. Das Erfordernis einer Güterbeschaffung als konstitutives Merkmal der Enteignung war bisher umstritten. Für dieses Merkmal spricht vor allem, dass ein praktischer Bedarf für den bloßen Eigentumsentzug, der nicht zugleich mit einem Übergang des Eigentums auf den Staat oder einen Drittbegünstigten verbunden ist, gerade dann besteht, wenn das Eigentumsrecht im weitesten Sinne bemakelt ist. In solchen Fällen hat der Staat typischerweise kein originäres Interesse an der Beschaffung des betroffenen Gegenstands aus Gründen des Gemeinwohls. Es entspricht der grundsätzlichen Sozialpflichtigkeit des Eigentums (Art. 14 Abs. 2 GG), den Eigentumsentzug in solchen Fällen nicht als entschädigungspflichtige Enteignung zu qualifizieren, sondern als Bestimmung von Inhalt und Schranken des Eigentums. Mit der Begrenzung der Enteignung auf Fälle der Güterbeschaffung werden auch Eigentumsbelastungen aus dem Bereich der entschädigungspflichtigen Enteignung ausgenommen, mit denen der Staat konkrete Eigentumspositionen nur entzieht und die damit ein besonderes Eingriffsgewicht haben. In diesen Fällen hat der Gesetzgeber besonders sorgfältig zu prüfen, ob ein solcher Entzug nur dann mit Art. 14 Abs. 1 GG vereinbar ist, wenn für den Eigentümer ein angemessener Ausgleich vorgesehen ist.
b) Durch die Einführung fester Abschalttermine werden den Beschwerdeführerinnen keine selbständigen Eigentumsrechte entzogen. Die im Jahr 2002 und 2010 gewährten Reststrommengen sind keine gegenüber dem Anlageneigentum selbständig enteignungsfähigen Eigentumspositionen. Jedenfalls fehlt es für beide Eingriffsregelungen an dem für eine Enteignung unverzichtbaren Güterbeschaffungsvorgang. Weder die Befristung der Kraftwerkslaufzeiten noch die Streichung der im Jahr 2010 zusätzlich gewährten Reststrommengen führen zu einem Übergang der betroffenen Positionen auf den Staat oder einen Dritten.
4. Die angegriffenen Bestimmungen der 13. AtG-Novelle genügen im Wesentlichen den Anforderungen an eine Inhalts- und Schrankenbestimmung des Eigentums.
a) Der Gesetzgeber hat bei der Bestimmung von Inhalt und Schranken des Eigentums die schutzwürdigen Interessen des Eigentümers und die Belange des Gemeinwohls in einen gerechten Ausgleich zu bringen. Gestaltet der Gesetzgeber Inhalt- und Schranken unternehmerischen Eigentums durch Änderung der Rechtslage, muss er die Grundsätze der Verhältnismäßigkeit, des Vertrauensschutzes und des Gleichheitssatzes achten. Soweit es um den Investitionsschutz von Unternehmen geht, gewährt Art. 14 GG die gleichen Garantien wie anderen Eigentümern. Dabei hat der Gesetzgeber den Bestand von Betrieben und die im Vertrauen auf die Gesetzeslage getätigten Investitionen angemessen zu berücksichtigen.
b) Der Gesetzgeber verfolgt mit der Beschleunigung des Atomausstiegs und seinem dahinter stehenden Wunsch, das mit der Nutzung der Kernenergie verbundene Restrisiko nach Zeit und Umfang zu minimieren und so Leben und Gesundheit der Bevölkerung und die natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen, ein legitimes Regelungsziel. Die Festlegung fixer Abschalttermine und die Streichung der 2010 zugewiesenen Zusatzstrommengen sind auch geeignet, die endgültige Beendigung der Kernenergienutzung schneller als nach der bisherigen Rechtslage gesichert herbeizuführen.
c) Die Streichung der 2010 gewährten Zusatzstrommengen erweist sich als verhältnismäßig. Der Eingriff in Art. 14 GG ist in quantitativer Hinsicht allerdings äußerst umfangreich; der Gesetzgeber hat eine Stromproduktion von im Durchschnitt rund 12 Jahresleistungen je Kernkraftwerk gestrichen. Die Schutzwürdigkeit der betroffenen Eigentumspositionen ist aber mehrfach eingeschränkt, so dass sich der Eingriff in der Gesamtabwägung mit den dafür sprechenden Gemeinwohlbelangen als verhältnismäßig erweist. Über den ohnehin bestehenden starken Sozialbezug des Eigentums an den Kernenergieanlagen hinaus, ist der Eigentumsschutz in Bezug auf die Nutzung der Atomanlagen, soweit es die durch die 11. AtG-Novelle zugewiesenen Zusatzstrommengen betrifft, gegenüber staatlichen Einflussnahmen weiter eingeschränkt, weil die Zuweisung der Zusatzstrommengen nicht auf einer Eigenleistung der betroffenen Unternehmen beruht. Diese Zusatzstrommengen stellen, anders als die 2002 zugewiesenen Reststrommengen, keine Kompensation für anderweitige Einschränkungen des Eigentums der Beschwerdeführerinnen dar. Vielmehr waren diese das Ergebnis einer energie-, klima- und wirtschaftspolitischen Entscheidung von Bundesregierung und Gesetzgeber. Als politisch motivierte Gewährung durch den Gesetzgeber haben sie daher nur in geringem Maße Teil am eigentumsrechtlichen Bestandsschutz. Darüber hinaus ist der Zeitraum zwischen der 11. AtG-Novelle und der 13. AtG-Novelle zu kurz, um die generelle Annahme begründen zu können, dass die Kernkraftwerksbetreiber sich bereits nachhaltig auf die durchschnittlich zwölfjährige Laufzeitverlängerung eingerichtet hätten.
Demgegenüber sind die mit der 13. AtG-Novelle verfolgten Gemeinwohlbelange (Leben und Gesundheit der Bevölkerung, Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen) von hohem Wert und in der konkreten Umsetzung der Rücknahme der Laufzeitverlängerung von 2010 von großem Gewicht. Der Gesetzgeber wollte den 2002 beschlossen Ausstieg aus der friedlichen Nutzung der Kernenergie beschleunigen, indem er feste Abschalttermine einführte und die Ende 2010 erfolgte Verlängerung der Laufzeiten rückgängig machte. Hierdurch wurde eine Risikominderung von ganz erheblichem Ausmaß erreicht. Dabei ist auch nicht zu beanstanden, dass der Gesetzgeber auf die Ereignisse in Fukushima reagierte, obwohl hieraus keine neuen Gefährdungserkenntnisse abgeleitet werden konnten. Wie weit allein geänderte politische Wertungen oder gewachsene Befürchtungen und Ängste in der Bevölkerung auch Maßnahmen tragen können, die ‑ wie die Beschleunigung des Atomausstiegs ‑ erheblich in Grundrechte der Betroffenen eingreifen, und welches Gewicht ihnen beigemessen werden kann, lässt sich allerdings nicht allgemein bestimmen. Jedenfalls bei der Beurteilung einer Hochrisikotechnologie, deren Schadensrisiken in besonderem Maße von einer politischen Bewertung und einer öffentlichen Akzeptanz abhängig sind, kann auch Ereignissen ein eigenes Gewicht beigelegt werden, die allein das Bewusstsein der Öffentlichkeit für diese Risiken ändern, obwohl neue Gefährdungen nicht erkennbar sind.
d) Die Inhalts- und Schrankenbestimmung des Eigentums durch die 13. AtG-Novelle ist allerdings unzumutbar, soweit sie dazu führt, dass zwei Beschwerdeführerinnen angesichts der gesetzlich festgelegten Restlaufzeiten ihrer Anlagen substantielle Teile ihrer Reststrommengen von 2002 nicht konzernintern ausnutzen können. Zwar haben die Beschwerdeführerinnen, die Bundesregierung und auch andere Beteiligte der Prognose, ob und inwieweit die Reststrommengen innerhalb der nunmehr fest befristeten Laufzeiten verbraucht werden könnten, unterschiedliche Annahmen hinsichtlich der realistisch zu erwartenden Auslastungsgrade der einzelnen Kernkraftwerke zugrunde gelegt. Im Ergebnis bestand allerdings Übereinstimmung, dass zwei Beschwerdeführerinnen ein im Wesentlichen vollständiger Verbrauch der Reststrommengen in konzerneigenen Kernkraftwerken innerhalb der verbleibenden Laufzeiten nicht möglich sein werde. Auf die Möglichkeit der konzerneigenen Verstromung kommt es jedoch an, da für diese Beschwerdeführerinnen eine konzernüberschreitende Übertragung von Reststrommengen keine uneingeschränkt zumutbare Verwertungsoption darstellt.
Die Eigentumsbeeinträchtigung ist quantitativ erheblich und wiegt vor allem wegen des rechtlichen Hintergrundes der 2002 zugesprochenen Reststrommengen schwer. Die 2002 zugewiesenen Reststrommengen sind Teil einer Übergangsregelung, die nach Entstehung, Begründung und Konzeption des Ausstiegsgesetzes von 2002 einen besonderen Vertrauensschutz bezweckte. Den Eigentümern und Betreibern der Kernkraftwerke sollte mit der getroffenen Regelung, insbesondere mit der Konzeption der Reststrommengenkontingentierung, eine verlässliche Grundlage für die Restlaufzeit der Anlagen zur Verfügung gestellt werden. Das Vertrauen in die zeitlich grundsätzlich ungebundene und im Wesentlichen ungeschmälerte Verwertungsmöglichkeit der Reststrommengen aus dem Jahr 2002 ist auch wegen ihres Kompensationscharakters besonders schutzwürdig. Diese Reststrommengen sollten den durch das Ausstiegsgesetz herbeigeführten Verlust der bis dahin unbefristeten Nutzungsmöglichkeit der Kernkraftwerke ausgleichen und so die Verhältnismäßigkeit der Ausstiegsentscheidung wahren helfen. Dass ein Teil der Reststrommengen aus dem Jahr 2002 wegen der festen Abschaltfristen konzernintern nicht mehr verstromt werden kann, belastet zwei Beschwerdeführerinnen auch deshalb, weil sie insofern gegenüber den konkurrierenden Unternehmen benachteiligt werden, die ihre Reststrommengen innerhalb der Laufzeit ihrer Kraftwerke vollständig verwerten können, ohne dass dafür ein ausreichender Rechtfertigungsgrund vorliegt. Den Belastungen der Beschwerdeführerinnen stehen zwar gewichtige Gemeinwohlbelange gegenüber. Diese wären jedoch durch eine Regelung, die die Verstrombarkeitsdefizite vermiede, nur in relativ geringem Maße belastet. Der Gesetzgeber hat in der 13. AtG-Novelle durch die Summe der Restlaufzeiten selbst einen Rahmen für das von ihm angestrebte Gemeinwohlziel gesetzt. Aufgrund der gestaffelten Restlaufzeiten und der noch vorhandenen konzerneigenen Reststrommengen dürfte einigen Anlagen aller Voraussicht nach eine ungenutzte Verstromungskapazität verbleiben. Die Verstrombarkeitsdefizite hätten, auch ohne das erstrebte Gesamtausstiegsdatum in Frage zu stellen, durch eine andere Staffelung der kraftwerksbezogenen Endzeitpunkte vermieden werden können.
e) Die 13. AtG-Novelle verstößt darüber hinaus gegen Art. 14 Abs. 1 GG, soweit sie keine Übergangsfristen, Entschädigungsklauseln oder sonstige Ausgleichsregelungen für den Fall vorsieht, dass Investitionen in Kernkraftwerke durch die Streichung der 2010 zugeteilten Zusatzstrommengen entwertet worden sind.
aa) Das Eigentumsgrundrecht kann unter bestimmten Voraussetzungen im Falle sogenannter frustrierter Investitionen Schutz gewähren. Es schützt auch berechtigtes Vertrauen in den Bestand der Rechtslage als Grundlage von Investitionen in das Eigentum und seiner Nutzbarkeit; ob und inwieweit ein solches Vertrauen berechtigt ist, hängt von den Umständen des Einzelfalls ab. Eine Garantie der Erfüllung aller Investitionserwartungen besteht nicht. Insbesondere schützt Art. 14 Abs. 1 GG grundsätzlich nicht gegen Änderungen der rechtlichen Rahmenbedingungen wirtschaftlichen Handelns und deren Auswirkungen auf die Marktchancen. Die in berechtigtem Vertrauen auf eine Gesetzeslage getätigten Investitionen ins Eigentum erfordern jedoch nach Maßgabe des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes sowohl hinsichtlich des Ob als auch hinsichtlich des Wie eines Ausgleichs angemessene Berücksichtigung, wenn der Gesetzgeber die weitere Verwertbarkeit des Eigentums direkt unterbindet oder erheblich einschränkt. Dabei bleibt dem Gesetzgeber für die Überleitung bestehender Rechtslagen, Berechtigungen und Rechtsverhältnisse ein breiter Gestaltungsspielraum. Insbesondere ist der Gesetzgeber von Verfassungs wegen nicht gehalten, bei Systemwechseln und der Umstellung von Rechtslagen die Betroffenen von jeder Belastung zu verschonen oder jeglicher Sonderlast mit einer Übergangsregelung zu begegnen. Ein Ausgleich hinsichtlich entwerteter Investitionen in das Eigentum ist jedenfalls dann nicht erforderlich, wenn der Gesetzgeber die Einschränkung der Verwertbarkeit des Eigentums anderweitig ausgleicht; eine Doppelkompensation ist ausgeschlossen.
bb) Gemessen hieran ist die 13. AtG-Novelle insofern verfassungswidrig, als sie keinerlei Regelung über den Ausgleich für frustrierte Investitionen vorsieht, die in dem kurzen Zeitraum zwischen dem Beschluss des Bundestages über die 11. AtG-Novelle am 8. Dezember 2010 und dem Schreiben des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit vom 16. März 2011 über das Atommoratorium getätigt wurden. Der 11. AtG-Novelle lag die politische Entscheidung des Gesetzgebers zugrunde, die Kernenergie als Brückentechnologie für einen längeren Zeitraum weiter zu nutzen. Die Kraftwerkbetreiber durften sich hierdurch zu Investitionen in ihre Anlagen ermutigt fühlen und mussten nicht damit rechnen, dass der Gesetzgeber noch in derselben Legislaturperiode von der energiepolitischen Grundsatzentscheidung wieder Abstand nehmen würde. Auch die überragenden Gemeinwohlgründe für einen beschleunigten Atomausstieg können den Gesetzgeber nicht von den Folgen der von ihm selbst gesetzten Ursache berechtigten Vertrauens in Investitionen entbinden, die während der kurzen Geltung der 11. AtG-Novelle mit Blick auf die Laufzeitverlängerung vorgenommen wurden.
Dagegen mussten im Hinblick auf die 2002er-Reststrommengen keine Ausgleichsregelungen für frustrierte Investitionen vorgesehen werden. Insoweit muss der Gesetzgeber bereits für das Verstrombarkeitsdefizit eine angemessene Entschädigung, Laufzeitverlängerungen oder einen anderweitigen Ausgleich regeln.
5. Die festgestellten Verfassungsverstöße führen hier zur Feststellung der Unvereinbarkeit von § 7 Abs. 1a Satz 1 AtG mit dem Grundgesetz verbunden mit einer Fortgeltungsanordnung bis zu einer Neuregelung. Dies ist deshalb angezeigt, weil dem Gesetzgeber verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung stehen, die Verfassungsverstöße zu beseitigen. Die Rücknahme der Ende 2010 in großem Umfang zugeteilten Zusatzstrommengen, die Einführung fester Endtermine für den Betrieb der einzelnen Kernkraftwerke und die Staffelung der Abschaltfristen haben sich im Grundsatz als vereinbar mit dem Grundgesetz erwiesen. Die verfassungsrechtlich zu beanstandenden Defizite sind zwar für die Beschwerdeführerinnen nicht unerheblich, betreffen jedoch gemessen an der Gesamtregelung der 13. AtG-Novelle nur Randbereiche.
Die Befreiungsfestigkeit des besonderen Stilleschutzes am Karfreitag ist mit den Grundrechten unvereinbar
Pressemitteilung Nr. 87/2016 vom 30. November 2016
Beschluss vom 27. Oktober 2016
1 BvR 458/10
Die Regelungen des Bayerischen Gesetzes über den Schutz der Sonn- und Feiertage (FTG), die den Karfreitag als gesetzlichen Feiertag anerkennen und mit einem qualifizierten Ruhe- und Stillerahmen ausstatten, sind grundsätzlich verfassungsgemäß. Die Befreiungsfestigkeit dieses Tages, die eine Befreiung von den damit verbundenen Handlungsverboten selbst aus wichtigen Gründen von vornherein ausschließt (Art. 5 Halbsatz 2 FTG), erweist sich jedoch als unverhältnismäßig. Dies hat der Erste Senat des Bundesverfassungsgerichts mit heute veröffentlichtem Beschluss entschieden. Damit hat er der Verfassungsbeschwerde einer Weltanschauungsgemeinschaft gegen die teilweise Untersagung einer am Karfreitag geplanten öffentlichen Veranstaltung stattgegeben.
Sachverhalt:
Der Beschwerdeführer ist eine als Weltanschauungsgemeinschaft anerkannte Körperschaft des öffentlichen Rechts. Nach seinem Grundsatzprogramm versteht er sich als Gemeinschaft, die die Interessen und Rechte von Konfessionslosen auf der Basis der Aufklärung und des weltlichen Humanismus vertritt. Er tritt unter anderem für eine strikte Trennung von Kirche und Staat ein. Der Beschwerdeführer rief für den Karfreitag zu einer eintrittspflichtigen Veranstaltung in einem Münchener Theater auf. Diese stand unter dem Motto „Religionsfreie Zone München 2007“ und umfasste neben dem untersagten Veranstaltungsteil Filmvorführungen („Atheistische Filmnacht“/„Freigeister-Kino“), ein Pralinenbuffet sowie Erläuterungen der Anliegen und die Vorstellung der Ziele der Weltanschauungsgemeinschaft. Untersagt wurde die zum Abschluss der Veranstaltung vorgesehene „Heidenspaß-Party“, die der Beschwerdeführer als „Freigeister-Tanz“ mit einer Rockband angekündigt hatte.
Nach Ansicht der Ordnungsbehörde hätte der letzte Veranstaltungsteil gegen die Vorschriften des FTG verstoßen. Das FTG bestimmt den Karfreitag als „stillen Tag“, an dem über den allgemeinen Sonn- und Feiertagsschutz hinaus öffentliche Unterhaltungsveranstaltungen, die den ernsten Charakter des Tages nicht wahren, sowie musikalische Darbietungen jeder Art in Räumen mit Schankbetrieb verboten sind. Anders als für die übrigen stille Tage schließt es die Möglichkeit einer Befreiung von diesen Handlungsverboten für den Karfreitag aus (Art. 5 Halbsatz 2 FTG). Die vom Beschwerdeführer erhobenen Rechtsbehelfe gegen die Untersagung blieben erfolglos. Mit seiner Verfassungsbeschwerde rügt der Beschwerdeführer insbesondere eine Verletzung seiner Weltanschauungsfreiheit sowie der Versammlungsfreiheit (Art. 4 Abs. 1 und 2, Art. 8 GG).
Wesentliche Erwägungen des Senats:
Die zulässige Verfassungsbeschwerde ist begründet.
1. Die Anerkennung des Karfreitags als gesetzlicher Feiertag und seine Ausgestaltung als stiller Tag einschließlich des Verbots bestimmter öffentlicher Unterhaltungsveranstaltungen und musikalischer Darbietungen in Räumen mit Schankbetrieb greifen in die allgemeine Handlungsfreiheit sowie gegebenenfalls auch in die Berufsfreiheit und in die Kunstfreiheit ein. In besonders gelagerten Fällen kann sie auch die grundrechtlich geschützte Weltanschauungsfreiheit und die Versammlungsfreiheit berühren.
2. a) Diese Eingriffe rechtfertigen sich dem Grunde nach aus der verfassungsrechtlichen Garantie des Sonn- und Feiertagsschutzes sowie der dem Gesetzgeber von Verfassungs wegen verliehenen Befugnis, Feiertage anzuerkennen und die Art und das Ausmaß ihres Schutzes zu regeln (Art. 140 GG in Verbindung mit Art. 139 WRV). Der Sonntag und die staatlich anerkannten Feiertage bleiben als Tage der Arbeitsruhe und der seelischen Erhebung gesetzlich geschützt. An diesen Tagen soll grundsätzlich die Geschäftigkeit in Form der Erwerbsarbeit, insbesondere der Verrichtung abhängiger Arbeit, ruhen, damit der Einzelne diese Tage allein oder in Gemeinschaft ungehindert von werktäglichen Verpflichtungen und Beanspruchungen nutzen kann. Die soziale Bedeutung des Sonn- und Feiertagsschutzes im weltlichen Bereich resultiert wesentlich aus der synchronen Taktung des sozialen Lebens. Dabei verfolgt die Regelung zunächst die weltlich-sozialen Ziele der persönlichen Ruhe, Erholung und Zerstreuung. Daneben kommt der Vorschrift auch eine religiöse Bedeutung zu, indem sie auch auf die Möglichkeit der Religionsausübung sowie darauf abzielt, dass Gläubige diesen Tagen ein Gesamtgepräge geben können, wie es ihrem Glauben entspricht.
b) Nach diesen Grundsätzen ist die Auswahl des Karfreitags als gesetzlicher Feiertag verfassungsrechtlich nicht zu beanstanden. Sie lässt sich auf die gesetzgeberische Regelungsbefugnis stützen und ist weder neutralitäts- noch gleichheitswidrig. Dem Gesetzgeber ist es nicht verwehrt, im Rahmen seiner Gestaltungsfreiheit als Feiertage auch solche auszuwählen, die aufgrund von Traditionen, kultureller oder weltanschaulich-religiöser Prägung für große Bevölkerungsteile wichtig sind. Die Möglichkeit der Angehörigen anderer Religionen und Weltanschauungen, ihre Feiertage angemessen zu begehen, wird hierdurch nicht eingeschränkt.
c) Die Ausgestaltung des Karfreitags als ein besonderen Regelungen unterliegender stiller Tag und damit die Schaffung eines qualifizierten Ruheschutzes ist dem Grunde nach ebenfalls gerechtfertigt. Der Gesetzgeber kann das Ausmaß des Feiertagsschutzes gesetzlich ausgestalten. Insoweit steht es ihm frei, für bestimmte Tage einen über die bloße Arbeitsruhe hinausgehenden äußeren Ruhe- und Stilleschutz zu schaffen. Wie umfassend er diesen Schutz im Einzelnen fassen darf, ist eine Frage der Verhältnismäßigkeit der Regelung. Auch die Schaffung eines besonderen Schutzes, der der gefestigten Bedeutung des Karfreitags nach christlicher Überlieferung entspricht, begegnet im Grundsatz keinen durchgreifenden Bedenken mit Blick auf das grundgesetzliche Neutralitätsverständnis, solange sich der Gesetzgeber darauf beschränkt, einen geschützten Rahmen zur Verfügung zu stellen, der eine in religiöser oder anderer Weise qualifizierte Begehung solcher Tage nur ermöglicht. Die inhaltliche Ausfüllung dieses Freiraums obliegt hingegen den Einzelnen allein oder in Gemeinschaft. Es ist dabei Teil der demokratisch legitimierten Ausgestaltungsfreiheit des Gesetzgebers, über die Auswahl solcher Tage zu entscheiden, die nur für Teile der Bevölkerung eine spezifisch geprägte Rolle spielen. Auf die Frage, wie viele der Kirchenangehörigen den Karfreitag in seiner religiösen Bedeutung in Gemeinschaft oder zurückgezogen in Privatheit begehen, kommt es daher nicht an.
3. Die konkrete Ausgestaltung des Karfreitagsschutzes erweist sich jedoch als unverhältnismäßig. Der Ausschluss einer Befreiungsmöglichkeit lässt sich in dieser Strenge für Fallgestaltungen, bei denen der Schutz des Feiertages mit den Gewährleistungen der Versammlungsfreiheit oder der Glaubens- und Bekenntnisfreiheit anderer zusammentreffen, nicht mehr als angemessener Ausgleich der verfassungsrechtlichen Positionen begreifen. Der strikte Befreiungsausschluss des Art. 5 Halbsatz 2 FTG ist deshalb mit der Weltanschauungsfreiheit und der Versammlungsfreiheit unvereinbar und nichtig.
Zwar sind Unterhaltungsveranstaltungen und musikalische Darbietungen in Räumen mit Schankbetrieb in der Regel nicht als Versammlungen im Sinne des Art. 8 GG oder als Ausübung der Bekenntnisfreiheit zu qualifizieren, ebenso wie umgekehrt Versammlungen normalerweise nicht als Unterhaltungsveranstaltungen aufzufassen sind. Ist dies jedoch ausnahmsweise der Fall, kann dies zu einer vom Regelfall abweichenden Beurteilung der Angemessenheit von Verboten zum Schutz des stillen Charakters führen. Das Verbot stößt hier nicht allein auf ein schlichtes wirtschaftliches Erwerbsinteresse oder allein auf ein Vergnügungs- und Erholungsinteresse von Veranstaltern, Künstlern und potenziellen Besuchern, sondern betrifft wegen der besonderen Bedeutung der Versammlungsfreiheit als wesentliches Element „demokratischer Offenheit“ die Teilhabe am öffentlichen Meinungsbildungsprozess und damit eine ihrerseits für das Gemeinwesen gewichtige grundrechtliche Gewährleistung. Entsprechendes gilt für Veranstaltungen, die dem Schutz der Glaubens- und Bekenntnisfreiheit, insbesondere auch in der Ausprägung als Weltanschauungsfreiheit, unterfallen. Die Durchführung solcher Veranstaltungen stellt den grundsätzlichen Ruhe- und Stilleschutz am Karfreitag nicht gleichermaßen in Frage und hat ein anderes Gewicht, so dass sich der besondere Schutz der stillen Tage gegenüber den betroffenen Grundrechten in diesen Fällen nur nach Maßgabe einer Abwägung im Einzelfall durchsetzen kann. Werden solche Veranstaltungen von den Verbotsregeln des FTG erfasst, muss der Gesetzgeber daher einen Ausnahmetatbestand vorsehen, der es ermöglicht, Befreiungen von diesen Verboten zu erteilen. Der Erteilung von Befreiungen für Veranstaltungen bei derartigen Grundrechtskonflikten steht auch nicht etwa die Glaubens- und Bekenntnisfreiheit der christlichen Teile der Bevölkerung entgegen. Aus dieser lässt sich keine verfassungsrechtliche Position ableiten, die den strikten Befreiungsausschluss rechtfertigen könnte. Insbesondere schützt sie nicht vor der Konfrontation mit Bekundungen eines nicht geteilten Glaubens oder einer nicht geteilten Weltanschauung.
4. Die angegriffenen Entscheidungen der Behörden und tatsacheninstanzlichen Gerichte werden den verfassungsrechtlichen Anforderungen nicht gerecht und konnten diesen angesichts der Gesetzeslage auch nicht genügen. Sie verletzen den Beschwerdeführer in seiner Weltanschauungsfreiheit und Versammlungsfreiheit. Der untersagte Veranstaltungsteil ist dem Schutzbereich der Glaubens- und Bekenntnisfreiheit in ihrer Ausprägung als Weltanschauungsfreiheit zuzuordnen und als Ausübung der Weltanschauungsfreiheit zu beurteilen. Darüber hinaus konnte der Beschwerdeführer für die untersagte Veranstaltung auch den Schutz der Versammlungsfreiheit in Anspruch nehmen. Die Gesamtschau aller Umstände, die wegen ihrer unmittelbaren Grundrechtsrelevanz vom Bundesverfassungsgericht verfassungsrechtlich überprüfbar ist, führt hier zu dem Ergebnis, dass auch der untersagte Veranstaltungsteil dem Schutzbereich der Versammlungsfreiheit zuzuordnen ist.
Fällt die Veranstaltung des Beschwerdeführers unter den Schutz der Weltanschauungsfreiheit und der Versammlungsfreiheit, so durfte nach den dargelegten Maßstäben dem Feiertagsschutz nicht der unbedingte Vorrang gegeben werden. Vielmehr bedurfte es einer Abwägung im Einzelfall. Im Ergebnis dieser Abwägung wäre eine Befreiung im Sinne des Art. 5 FTG zu erteilen gewesen. Das Gewicht der Grundrechte des Beschwerdeführers und der nach den Umständen des Einzelfalls vergleichsweise geringere Einfluss auf den besonderen äußeren Ruheschutz des Karfreitags führen hier dazu, dass bei verfassungskonformem Verständnis vom Vorliegen wichtiger Gründe für eine Befreiung ausgegangen werden musste. Die Veranstaltung fand in einem geschlossenen Raum mit überschaubarer Teilnehmerzahl statt und sollte auch in ihrem zweiten Teil dort abgehalten werden. An dem konkreten Veranstaltungsort hatte sie vergleichsweise geringe Auswirkungen auf den öffentlichen Ruhe- und Stillecharakter des Tages. Angesichts ihres thematischen Bezuges zum Karfreitag kam es auch maßgeblich darauf an, die Veranstaltung gerade an diesem Tag abzuhalten. Schließlich hätte die Möglichkeit bestanden, dem Ruhe- und Stilleschutz durch Auflagen gerecht zu werden, welche die Auswirkungen für den Ruherahmen in seiner Bedeutung für den allgemein wahrnehmbaren Charakter des Tages als Ganzes gegebenenfalls weiter begrenzt hätten.
| Newsletter Dezember 2016 |
Wir stellen Ihnen in unserem aktuellen Newsletter wieder neue interessante und nützliche Urteile aus verschiedenen Rechtsgebieten vor.
Über unsere Homepage www.deutsche-anwaltshotline.de erhalten Sie sofort Rechtsberatung per Telefon und per E-Mail durch selbstständige Rechtsanwälte.
Neu: Ho! Ho! Ho! Auch dieses Jahr gibt es wieder den Adventskalender der Deutschen Anwaltshotline, prall gefüllt mit Geschenken. Zu gewinnen gibt's dieses Jahr unter anderem ein iPad mini 2 oder ein Samsung Galaxy Tab A. Des Weiteren gibt es fünf Exemplare des Cartoons „Juristen – Viel Spass!“ von Tim Feicke, fünf Exemplare des Hörspiels „Stimmt‘s oder hab ich Recht?“ von Volker Kitz, drei Exemplare des Buches „Gegen den Hass“ von der Friedenspreisträgerin des Deutschen Buchhandels, Carolin Emcke, sowie fünf Exemplare des Hörspiels „BGB“, gelesen von Christoph Maria Herbst. Außerdem werden zehn Rechtsberatungen und 30 Mal das Buch „Recht hat, wer trotzdem lacht“ von Dr. Dietrich Pätzold verlost.
Einfach jeden Tag fleißig sein, den Gegenstand des Tages suchen und die dazu gestellte rechtliche Frage beantworten. Danach
E-Mail-Adresse eintragen, Datenschutzerklärung und Teilnahmebedingungen lesen, akzeptieren und auf den „am Gewinnspiel teilnehmen“-Button klicken! Mit etwas
Glück steht der Postbote vor der Tür und überreicht Ihren Gewinn.
Nicht vergessen täglich mitzumachen! Jeder Tag steckt voller Gewinne!
Unseren Adventskalender finden Sie hier.
Viel Vergnügen beim Lesen unseres Newsletters und viel Erfolg bei unserem Gewinnspiel wünschen Ihnen die Kooperationsanwälte und die Geschäftsleitung der Deutschen Anwaltshotline!Inhalt:
Cannabisplätzchen auf Weihnachtsfeier: strafbar?
Nürnberg (D-AH/fk) – Wer auf einer Weihnachtsfeier den Gästen Cannabis-Plätzchen serviert, macht sich nicht strafbar. Das beschloss das Oberlandesgericht Zweibrücken (Az. 1 OLG 1 Ss 2/16).
Wie die telefonische Rechtsberatung der Deutschen Anwaltshotline berichtet, ist Weihnachten das Fest der Liebe. Aus diesem Grund lud eine Mutter aus Rheinland-Pfalz ihre Familie an Heiligabend
zu einem Weihnachtsfest. Einer der Söhne brachte selbst gebackene Cannabis-Plätzchen mit, um die „traditionell schlechte Stimmung“ auf der Feier aufzupeppen, wie er selbst erklärte. Die Familie griff
freudig zu – darunter auch seine minderjährigen Brüder. Einer der volljährigen Gäste erlitt daraufhin aber Schweißausbrüche, begann zu zittern und verlor zunehmend Farbe im Gesicht.
Das Amtsgericht Rockenhausen verurteilte den Hobbybäcker wegen vorsätzlicher Körperverletzung zu sechs Monaten Freiheitsstrafe auf Bewährung. Dagegen ging der Mann nun in Revision.
Das Oberlandesgericht Zweibrücken stellte sich aber auf die Seite des Mannes und hob das Urteil der Vorinstanz auf. Es handle sich nicht um vorsätzliche Körperverletzung, da der Bäcker nur
geringfügige Wirkung in Kauf nahm. „Körperliche Beschwerden der Gäste hatte er nicht beabsichtigt und nahm sie bei so geringen Mengen auch nicht vorsätzlich in Kauf“, erklärt Rechtsanwalt Frank
Böckhaus (telefonische Rechtsberatung unter 0900/1875000-0 für 1,99 Euro pro Minute).
Auch, dass seine minderjährigen Brüder von den Keksen kosteten, sei nicht strafbar. Der Plätzchenbäcker hat den Brüdern die Drogen nicht zur freien Verfügung gegeben, sondern nur in geringen Mengen
zum Verzehr. Das sei strafrechtlich nicht relevant, so das Gericht. Über den Drogenbesitz an sich und fahrlässige Körperlverletzung wird aber noch zu sprechen sein.
Unfall in der Fahrschule: Fahrlehrer schuld?
Nürnberg (D-AH/) – Verursacht ein Fahrschüler einen Verkehrsunfall, so ist nicht automatisch der Fahrlehrer in der Verantwortung. Denn er ist nicht prinzipiell auch der Führer des Autos. Das
beschloss das Amtsgericht Landstuhl (Az. 2 OWi 4286 Js 10115/16).
Wie die telefonische Rechtsberatung der Deutschen Anwaltshotline berichtet, fuhr ein Fahrschüler mit seinem Fahrlehrer durch die Stadt. Als er an eine Vorfahrtsstraße kam, übersah er das
heranfahrende vorfahrtsberechtigte Fahrzeug und es kam zum Zusammenstoß. Wegen der missachteten Vorfahrt sprach die zuständige Behörde dem Fahrlehrer ein Bußgeld von 120 Euro aus, weil er für den
Unfall als Fahrzeugführer verantwortlich sei. Das wollte dieser nicht auf sich sitzen lassen und ging gegen den Bußgeldbescheid vor.
Und das mit Erfolg: Denn das Amtsgericht Landstuhl erklärte den Bußgeldbescheid in diesem Einzelfall für unwirksam. Der Fahrlehrer war zum Unfallzeitpunkt nämlich nicht der Führer des Autos. Dafür
hätte er aktiv beeinflussen müssen, wie der Fahrschüler lenkt und bremst. „Wenn der Ausbildungsstand eines Schülers schon so weit fortgeschritten ist, dass eine normale Vorfahrtssituation keine
Herausforderung mehr darstellen sollte, musste der Lehrer hier nicht mit einem solchen Unfall rechnen“, erklärt Rechtsanwalt Frank Böckhaus (telefonische Rechtsberatung unter 0900/1875000-0 für 1,99
Euro pro Minute).
Zwar habe ein Fahrlehrer die Pflicht, Unfälle seines Schützlings zu vermeiden. Es könne aber nicht zweifelsfrei festgestellt werden, dass der Fahrlehrer nicht alles ihm Mögliche getan hat, um den
Unfall noch zu verhindern.
Wegen Krankheit gekündigt: rechtmäßig?
Nürnberg (D-AH/) – Eine krankheitsbedingte Kündigung ist gerechtfertigt, wenn keine Besserung der Erkrankung in Sicht ist und die Arbeitserleichterungen seitens des Arbeitgebers keine Früchte
tragen. So urteilte das Landesarbeitsgericht Köln (Az. 11 Sa 25/16).
Wie die telefonische Rechtsberatung der Deutschen Anwaltshotline berichtet, arbeitete ein Paketsortierer seit über zehn Jahren für seinen Betrieb. Seit 2007 allerdings fehlte er regelmäßig auch über
längere Zeiträume. So häufte er allein 2014 beinahe 200 Fehltage an. Der Mann litt an Depression und konnte daher seinen Arbeitsalltag nicht mehr bestreiten. Sein Arbeitgeber versetzte ihn daraufhin
an einen weniger anstrengenden Arbeitsplatz und schraubte das Arbeitspensum auf zwölf Wochenstunden herunter. Dies trug allerdings nicht zu einer besseren Situation bei und der Betrieb zog
schließlich die Reisleine und kündigte dem Mann.
Das Landesarbeitsgericht bestätigte nun die Kündigung und kassierte damit auch die Entscheidung der Vorinstanz. Die Kündigung sei deshalb wirksam, weil keine Besserung der Erkrankung nach sieben
Jahren in Sicht sei. Abzuwägen sei hier stets die Interessen des Arbeitgebers mit denen des Mitarbeiters, auch in Hinblick auf Lohnfortzahlungen im Krankheitsfall. „Eine weitere Beschäftigung ist dem
Arbeitgeber hier wirtschaftlich aber nicht mehr zuzumuten“, erklärt Rechtsanwalt Frank Böckhaus (telefonische Rechtsberatung unter 0900/1875000-0 für 1,99 Euro pro Minute).
Der Betrieb habe schließlich alles unternommen, um den Mitarbeiter zu halten. So versetzte er ihn an einen weniger anstrengenden Arbeitsplatz und drosselte seine Wochenarbeitszeit. Mehr könne dem
Arbeitgeber nicht zugemutet werden, so das Gericht.
Vermieter beleidigt: Kündigung rechtens?
Nürnberg (D-AH/fk) – Beschimpft ein Betreuer, der im selben Mietshaus wie seine demente Patientin wohnt, in einem Brief den Vermieter, so darf dieser beiden fristlos kündigen. Auch wenn es sich
bei der Patientin um eine 95-jährige Frau handelt. Das beschloss das Landgericht München (Az. 14 S 16950/15).
Wie die telefonische Rechtsberatung der Deutschen Anwaltshotline berichtet, wohnte eine demente 95-Jährige zusammen mit ihrem Pfleger in zwei verschiedenen Wohnungen. Sie hatte beide Wohnungen
angemietet. Allerdings litt das Verhältnis des Pflegers zum Vermieter wegen einer Mieterhöhung und Beschwerden der Nachbarn wegen Ruhestörungen. So schrieb er mehrere Briefe an Nachbarn und den
Vermieter selbst, in denen er ihn als „naziähnlichen braunen Misthaufen“ und „Terroristen“ beschimpfte. Das wollte sich dieser nicht gefallen lassen und kündigte die Wohnungen der älteren Frau und
des Pflegers fristlos. Als der nicht auszog, klagte der Vermieter auf Räumung.
Das Landgericht München gab dem Vermieter recht und kassierte dabei das Urteil der Vorinstanz. Auch wenn die Frau bereits die 90 Jahre überschritten hat und bettlägerig ist, so müsse der Vermieter
solche Beleidigungen von ihrem Stellvertreter nicht hinnehmen. „Wer gar mehrere Briefe mit solchem Inhalt verschickt, handelt überlegt und weiß genau, was er tut“, erklärt Rechtsanwalt Volker
Scheinert (telefonische Rechtsberatung unter 0900/1875000-0 für 1,99 Euro pro Minute). Das komme erschwerend hinzu, so das Gericht.
Auch wenn die Frau nicht selbst die Briefe verfasste oder billigte, sei sie als Mieterin beider Wohnungen dafür verantwortlich. Denn sie überließ dem Pfleger auch ihre Wohnung. Somit müssten beide
ihre Wohnungen räumen.
Escort-Dame hat Recht auf Diskretion
Nürnberg (D-AH/fk) – Wer sich als Escort-Dame mit Fotos auf einer Internetplattform anmeldet, der trägt einen Teil seiner Intimsphäre in die Öffentlichkeit. Das berechtigt aber niemanden, die
Verwandtschaft der Person über deren Aktivität zu informieren. So urteilte das Landgericht Frankfurt am Main (Az. 2-03 O 455/14).
Wie die telefonische Rechtsberatung der Deutschen Anwaltshotline berichtet, plante eine erwerbsunfähige Frau mittleren Alters, sich einen Nebenverdienst als Escort zu sichern. Sie ließ sich dafür
freizügig fotografieren und stellte die Bilder auf ihr Onlineprofil bei einer Escort-Agentur. Das Unterfangen wollte sie aber vor Freunden und Familie geheim halten und erzählte nur einem engen
Vertrauten davon. Dieser machte sich Sorgen und benachrichtigte die Mutter der Frau und weitere Bekannte per E-Mail. Den Mails fügte er Bilder hinzu, die er auf der Homepage der Escort-Agentur
gefunden hatte. Obwohl diese nur für registrierte Mitglieder sichtbar waren, verschaffte er sich Zugang dazu. Die Escort-Dame fühlte sich bloßgestellt und verlangte von ihrem ehemaligen Vertrauten
Schadensersatz.
Und das Landgericht Frankfurt am Main sprach ihr diesen auch zu. Der Bekannte habe Persönlichkeitsrechte der Frau verletzt, indem er Informationen in die Öffentlichkeit getragen hatte, die dazu
geeignet waren, als peinlich empfunden zu werden. Zwar hätte die Frau wissen müssen, dass eine derartige Selbstdarstellung im Internet auch auffliegen könne. „Aber das bedeutet nicht, dass es erlaubt
ist, Unbeteiligte gezielt darauf aufmerksam zu machen“, erklärt Rechtsanwältin Juliane Schneewolf (telefonische Rechtsberatung unter 0900/1875000-0 für 1,99 Euro pro Minute).
Auch dass der Bekannte Fotos der Frau mitgeschickt hat, komme erschwerend hinzu. Er habe die Frau damit zu einem „Coming-out“ gezwungen, so das Gericht. Er müsse deshalb eine Entschädigung von über
5.000 Euro bezahlen.
Informationen für Mitglieder der Deutschen Anwaltshotline:
Auf der Seite www.jura-ticker.de stellt die Deutsche Anwaltshotline Ihnen kostenlos einen dynamischen Ticker mit täglich wechselnden Rechtsnachrichten zur Verfügung. Sie können diesen von uns entwickelten Ticker in Ihre eigene Homepage einbinden und so den Besuchern Ihrer Website einen neuen und informativen Service bieten.
Alle juristisch interessierten Leser können auch auf der Jura-Ticker-Homepage täglich aktualisierte Rechtsmeldungen studieren.
Als Abonnent unseres Newsletters haben Sie übrigens auch kostenlosen Zugang zum Mitgliederbereich. Sie können dort kostenlos eine Auswahl an anwaltlich geprüften Verträgen und Dokumenten downloaden, z.B. Kfz-Kaufvertrag, Arbeitsvertrag, Patientenverfügung, usw. Sie erhalten dort auch kostenlos Zugriff auf hilfreiche Broschüren, wie etwa zum Thema „Grillen – was ist erlaubt?“ oder „Hartz IV – Alles was wichtig ist“.
Besuchen Sie unseren Mitgliederbereich unter http://www.deutsche-anwaltshotline.de/allgemein/mitglieder/index.php mit folgenden Zugangsdaten (Gross- und Kleinschreibung beachten):
Benutzer: Deutsche-Anwaltshotline
Passwort: rechtlich
Den Mitgliederbereich erreichen Sie auch über den Menüpunkt "für Mitglieder" auf unserer Homepage.
Für alle persönlichen Rechtsfragen stehen Ihnen selbstständige Anwälte über die Deutschen Anwaltshotline von Montag bis Sonntag von 7:00 Uhr morgens - 01:00 nachts Uhr zur Verfügung.
Rufnummer Rechtsberatung: 0900-1-875 000-10 (1,99 Eur/Min*)
*inklusive 19 % Mehrwertsteuer aus dem Festnetz der Deutschen Telekom; ggf. abweichende Preise aus Mobilfunknetzen.
Unter www.deutsche-anwaltshotline.de können Sie auch die direkten Durchwahlen zu über 50 Rechtsgebieten abfragen.
Impressum:
Deutsche Anwaltshotline AG, Am Plärrer 7, 90443 Nürnberg Tel.: +49 911 / 376569-0, Fax: +49 911 / 376569-99
Register und Registernummer: Amtsgericht Nürnberg HRB 24658
Umsatzsteuer-ID: DE261181671
vertreten durch: Johannes Goth, Volker Schwengler, Christian Ulshöfer
Aufsichtsrat: Hartmut Dicke (Vorsitzender), Alexander Keller, Reinhold Gleichmann
Verantwortlicher für journalistisch-redaktionelle Inhalte gem. § 55 II RstV: Engin Aydin
RTDeutsch
Meinung
Bananen-Republik Deutschland: Bundesverfassungsgericht legalisiert Überwachungsskandal

von Rainer Rupp
Selbst die wenigen Medien, die den technischen und juristischen Details des jüngsten höchstgerichtlichen Beschlusses etwas mehr an Zeit und Platz gewidmet hatten, haben die eigentliche Schande, die in dieser Entscheidung liegt, völlig ausgeblendet.
Das Bundesverfassungsgericht hat am gestrigen Mittwoch entschieden, dass das Schutzbedürfnis des US-Geheimdienstes NSA, in dessen illegale Aktivitäten in Deutschland derzeit ein Untersuchungsausschuss des Bundestages Licht bringen soll, hinsichtlich seiner Interessen über den Schutzinteressen des deutschen Volkes stehe. Um den Skandal auf die Spitze zu treiben, begrüßten die Regierungsparteien CDU und SPD diesen Beschluss auch noch ausdrücklich.
Im Detail handelt es sich bei den Elementen der so genannten "Selektorenliste" des US-Geheimdienstes NSA um wichtige Suchmerkmale wie Telefonnummern, E-Mail- oder IP-Adressen aus Deutschland. Unbestritten ist, dass die NSA diese Liste dem Bundesnachrichtendienst BND übergeben hat. Dieser hat anschließend als "Subunternehmer" für die Amerikaner auf der Basis der ihm übermittelten Selektoren deutsche Bürger, Politiker, Wissenschaftler, Unternehmen usw. elektronisch ausspioniert und die Ergebnisse an seine US-Auftraggeber weitergegeben.
Angeblich hat der BND die auf dieser Grundlage gewonnenen Ergebnisse und Daten deutscher Internet- und Telefonbenutzer in "rohem" Zustand, also ungesehen, nicht aufgearbeitet und nicht analysiert, an den ausländischen Dienst übergeben. Dies dürfte mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Schutzbehauptung sein, denn wenn der BND etwas anderes zugegeben hätte, dann hätte er damit eine strafbare Handlung eingestanden. Seine Tätigkeit darf nämlich von Gesetzes wegen nur gegen ausländische Ziele gerichtet sein und nicht gegen solche im Inland.
Es waren die Bundestagsfraktionen von Die Linke und Bündnis 90/Die Grünen, die gegen diese geheimdienstliche Mauschelei geklagt haben, im Zuge derer der BND Handlangerdienste für die USA-Spionage geleistet hat, nicht nur gegen Bürger und Firmen in Deutschland, sondern auch auf der Ebene der EU. Entsprechend groß sind das Unverständnis und die Empörung über die Entscheidung des Verfassungsgerichts. Dieses hat im Kern wie folgt argumentiert:
Die Bundesregierung muss die geheime Liste mit den NSA-Spionagezielen in Deutschland nicht an den NSA-Untersuchungsausschuss herausgeben. Eine Herausgabe ohne Einverständnis vonseiten der USA könnte die Funktionsfähigkeit der Nachrichtendienste und damit die außen- und sicherheitspolitische Handlungsfähigkeit Deutschlands beeinträchtigen. Das Geheimhaltungsinteresse der Regierung überwiege daher das Informationsinteresse des Bundestagsausschusses.
Was ist eigentlich los in unserem Land? Inzwischen ist doch auch unbestritten, dass mittels der NSA-Selektorenliste gar keine "Terrorismusbekämpfung" betrieben wurde. Vielmehr waren Bürger, Politiker, Wissenschaftler und Unternehmen im Visier der Dienste, gegen die von US-amerikanischer Seite Industrie- und Politspionage getrieben wurde. Für den Normalbürger ist dabei völlig unverständlich, dass der BND den USA dabei auch noch geholfen hat und dafür von den Regierungsparteien CDU und SPD sowie jetzt sogar auch noch vom Verfassungsgericht Rückendeckung bekommen hat. Sogar der CDU-Vorsitzende des Bundestagsuntersuchungsausschusses, der den BND-NSA-Skandal aufklären soll, begrüßte den Beschluss des Bundesverfassungsgerichts.
Man muss keine ausgeprägte Affinität zu so genannten "Verschwörungstheoretikern" aufweisen, um sich in Anbetracht dieses Sachverhalts Fragen zu stellen:
Hat all das womöglich damit zu tun, dass wir in Deutschland zwar ein Verfassungsgericht haben, aber keine Verfassung, sondern nur ein Grundgesetz? Das noch dazu damals hinter dem Vorhang von den West-Alliierten geschrieben wurde? Es ist auch inzwischen bekannt, dass es etliche Vorbehaltsrechte vonseiten der West-Alliierten gab, insbesondere den USA, die diesen weitreichende Befugnisse und Eingriffsmöglichkeiten in der BRD eingeräumt haben, vor allem, wenn es um die Sicherheitsbelange Washingtons ging. Diese standen im Zweifelsfall auch über den Garantien des Grundgesetzes, die deutsche Staatsorgane in ihren Rechten gegenüber den Bürgern einschränken sollten.
Angesichts der Tatsache, dass die NSA bis hinauf zur Kanzlerin auch die gesamte Bundesregierung abgehört hat und das vermutlich immer noch tut, drängt sich die Frage auf, ob der Beschluss des Verfassungsgerichts und das Verhalten der Bundesregierung nicht nahelegen, dass die Amerikaner nach wie vor der deutschen Souveränität enge Grenzen setzen? Hinsichtlich dieser Frage ist es übrigens völlig egal, ob die ominöse und umstrittene, so genannte "Kanzlerakte" aus dem Jahr 1949, die durch diverse Alternativmedien geistert, nun tatsächlich ein Fake war oder nicht.
Klar ist: Ein Land, dessen Verfassungsgericht die Schutzbedürfnisse eines ausländischen Nachrichtendienstes, der die eigene Bevölkerung und Industrie ausspioniert, über die Schutz- und Informationsbedürfnisse des eigenen Volkes stellt, und dessen Regierung und regierende Parteien dazu auch noch Beifall klatschen, ist weder souverän noch demokratisch.
Früher, zu Zeiten der absoluten Dominanz des US-Bananenimport-Konzerns "United Fruit Company" über Lateinamerika, konnte man in den unterwürfigen Vasallenstaaten ein ähnliches Verhalten beobachten. Auf dieses Niveau ist nun auch die Bananen-Republik Deutschland (BRD) herabgesunken.
RT Deutsch bemüht sich um ein breites Meinungsspektrum. Gastbeiträge und Meinungsartikel müssen nicht die Sichtweise der Redaktion widerspiegeln.
| Newsletter Oktober 2016 |
Wir stellen Ihnen in unserem aktuellen Newsletter wieder neue interessante und nützliche Urteile aus verschiedenen Rechtsgebieten vor.
Über unsere Homepage www.deutsche-anwaltshotline.de erhalten Sie sofort Rechtsberatung per Telefon und per E-Mail durch selbstständige Rechtsanwälte.
Viel Vergnügen beim Lesen unseres Newsletters wünschen Ihnen die Kooperationsanwälte und die Geschäftsleitung der Deutschen Anwaltshotline!
Inhalt:
Hat Croupier Anpruch auf rauchfreien Arbeitsplatz?
Nürnberg (D-AH/) – Wer in einer Spielhalle als Croupier arbeitet, der muss auch damit rechnen, an den Spieltischen im Raucherbereich arbeiten zu müssen. Denn rauchende
Kundschaft zähle ebenfalls zum Klientel einer Spielhalle, urteilte das Bundesarbeitsgericht (Az. 9 AZR 347/15).
Wie die telefonische Rechtsberatung der Deutschen Anwaltshotline (www.deutsche-anwaltshotline.de) berichtet, musste ein Croupier im Raucherbereich der Spielhalle arbeiten. Dies müssen dort alle Mitarbeiter etwa ein Drittel ihrer Arbeitszeit tun. Er
empfand dies aber als willkürlich und unzumutbar, als Nichtraucher im blauen Dunst zu arbeiten. Er bat seinen Arbeitgeber also darum, nur noch im Nichtraucherbereich arbeiten zu dürfen, da es seiner
Meinung nach genug Personal gäbe, das viel lieber als er im Raucherbereich arbeiten würde. Sein Arbeitgeber versagte ihm allerdings diesen Wunsch und so ging der Fall vor Gericht.
Das Bundesarbeitsgericht entschied nun zugunsten des Arbeitgebers und bestätigte dabei auch die Urteile der Vorinstanzen. Zwar habe ein Mitarbeiter ein Anrecht darauf, an einem Arbeitsplatz zu
arbeiten, der die Gesundheit nicht beeinträchtigt. Und es sei die Aufgabe des Arbeitgebers eine solche Gesundheitsgefährdung zu minimieren.
Allerdings gehöre die Spielhalle zu einem Arbeitsumfeld, in dem rauchende Kundschaft zum Tagesgeschäft gehört. „Da es sich hier um einen Arbeitsplatz mit Publikumsverkehr handelt, ist die
Schutzpflicht des Arbeitgebers eingeschränkt“, erklärt Rechtsanwalt Jörg-Matthias Bauer (telefonische Rechtsberatung unter 0900/1875000-0 für 1,99 Euro pro Minute). Ein generelles Rauchverbot für die
komplette Spielhalle sei ebenfalls keine Option. Denn das würde die unternehmerische Eigenheit der Spielothek verändern, urteilte das Bundesarbeitsgericht.
Reisemangel durch Dreharbeiten?
Nürnberg (D-AH/fk) – Dreharbeiten während einer Kreuzfahrt sind kein Grund, den Reisepreis zu mindern, wenn sie die vertraglich geregelten Reisebedingungen nicht
beeinträchtigen. So urteilte das Landgericht Bonn (Az. 8 S 5/16).
Wie die telefonische Rechtsberatung der Deutschen Anwaltshotline (www.deutsche-anwaltshotline.de) berichtet, hatte ein Mann eine dreiwöchige Kreuzfahrt in Südostasien gebucht. An Bord musste er allerdings feststellen, dass ein Filmteam das
Kreuzfahrtschiff während dieser drei Wochen als Schauplatz für eine TV-Produktion nutzte. So waren während der Kreuzfahrt unter anderem der Pool, das Restaurant oder das Sonnendeck außerhalb der
Hauptbesuchszeiten stundenweise gesperrt. Der Erholungssuchende empfand diesen Umstand als unzumutbar und er wollte seinen Reisepreis nachträglich um 40 Prozent mindern.
Utopisch, urteilte nun das Landgericht Bonn und kassierte dabei die Entscheidung der Vorinstanz. Diese hatte dem Urlauber zuvor 20 Prozent zugesprochen. Um den Reisepreis mindern zu können, müsse
zunächst ein Reisemangel vorliegen. Davon ist die Rede, wenn die Reise nicht das hält, was der Reisevertrag verspricht. „Ob es sich dabei allerdings um einen echten Reisemangel oder aber nur um eine
geringfügige Unannehmlichkeit handelt, ist vom Einzelfall abhängig“, erklärt Rechtsanwalt Karl Heinz Lehmann (telefonische Rechtsberatung unter 0900/1875000-0 für 1,99 Euro pro Minute). Die
gesperrten Areale dienten meist nur dann als Kulisse, wenn nicht mit Urlaubern zu rechnen war. So wurde das Restaurant außerhalb der Öffnungszeiten, die Bar am frühen Vormittag genutzt. Das reiche
für einen Reisemangel nicht aus.
Da die Dreharbeiten die Kreuzfahrt kaum spürbar beeinträchtigt haben, musste der Reiseveranstalter seine Gäste auch nicht vorab über das TV-Projekt informieren, urteilte das Gericht.
Fahren ab 17: Führerscheinentzug ohne Begleitperson?
Nürnberg (D-AH/fk) Einem Minderjährigen, der einen Führerschein für begleitetes Fahren ab 17 Jahren hat, kann dieser auch abgenommen werden, wenn er für seinen Verstoß
keinen Punkt in Flensburg kassiert hat. Das beschloss der Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg (Az. 10 S 1404/16).
Wie die telefonische Rechtsberatung der Deutschen Anwaltshotline (www.deutsche-anwaltshotline.de) berichtet, fuhr ein Siebzehnjähriger mit seiner Schwester auf einer wenig befahrenen Straße. Er hatte erfolgreich die Prüfung für einen Führerschein mit
begleitetem Fahren ab 17 abgelegt und dabei seine Eltern als mögliche Begleitpersonen angegeben. Da seine Schwester allerdings keine dieser Begleitpersonen war, wurde ihm der Führerschein wieder
abgenommen und ein Bußgeld von 50 Euro auferlegt. Da sich dies rund zwei Wochen vor seinem 18. Geburtstag ereignete, legte der Fahrer Widerspruch ein. Er habe nicht gewusst, dass es sich um eine
öffentliche Straße handle. Außerdem sei ein Führerscheinentzug nur mit Punkten in Flensburg möglich. Die Behörde sah das anders und der Fall ging vor Gericht.
Der Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg gab der Behörde recht. Zum einen bedürfe es nicht zwingend eines Bußgeldes, um den Führerschein in derartigen Fällen entziehen zu können. Zum anderen sei
die Schilderung des Teenagers unglaubwürdig. „Wer als Siebzehnjähriger ohne eingetragene Begleitung fährt, muss auch ohne Fahrfehler damit rechnen, seinen Führerschein zu verlieren“, erklärt
Rechtsanwalt Karl Heinz Lehmann (telefonische Rechtsberatung unter 0900/1875000-0 für 1,99 Euro pro Minute).
Für einen Führerscheinentzug seien nicht einmal eine Ordnungswidrigkeit oder gar Punkte in Flensburg notwendig. Der Jugendliche hätte schlicht nicht ohne eine der genannten Begleitpersonen fahren
dürfen, so das Gericht.
Verein als rassistsche Plattform bezeichent: Beleidigung?
Nürnberg (D-AH/fk) – Einen Verein als Sprachrohr für fremdenfeindliche Ideologien zu bezeichnen, ist keine falsche Tatsachenbehauptung, sondern vom Recht auf freie
Meinungsäußerung gedeckt. Denn die Aussage bezeichnet den Verein selbst nicht als rechtsextrem. So urteilte das Oberlandesgericht Frankfurt am Main (Az. 16 U 87/15).
Wie die telefonische Rechtsberatung der Deutschen Anwaltshotline (www.deutsche-anwaltshotline.de) berichtet, bezeichnete eine Broschüre einen Verein als „anerkanntes Sprachrohr“ für Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und Nationalismus. Das stand so in
einer Abhandlung, die den sozial anerkannten Rassismus in der deutschen Gesellschaft beleuchten sollte.
Das wollte der Verein sich aber nicht gefallen lassen. Denn das sei eine falsche Tatsachenbehauptung, die dem Leser der Broschüre suggeriere, der Verein vertrete Ideologien des Nationalsozialismus.
Eine solche Schmähkritik müsse der Verein nicht hinnehmen und die Verantwortlichen forderten den Produzenten der Broschüre zu einer Unterlassungserklärung auf. Als dieser sich weigerte, ging der Fall
vor Gericht.
Doch das Oberlandesgericht Frankfurt am Main gab dem Herausgeber der Broschüre recht und bestätigte auch das Urteil der Vorinstanz. Die in der Broschüre genannten Begriffe seien weder
gesellschaftlich klar definiert noch bezeichnete die Abhandlung den Verein selbst als rechtsextrem. „Es handelt sich also nicht um eine falsche Tatsachenbehauptung, sondern um eine freie
Meinungsäußerung“, erklärt Rechtsanwalt Karl-Heinz Lehmann (telefonische Rechtsberatung unter 0900/1875000-0 für 1,99 Euro pro Minute).
Auch von einer Schmähkritik könne keine Rede sein. Denn dabei müsste die Behauptung die sachliche Ebene verlassen und nur darauf abgezielt sein, den Verein herabzusetzen. Doch das sei hier nicht der
Fall, so das Gericht.
Zusammenrall mit Glaswand: Schmerzensgeld fällig?
Nürnberg (D-AH/fk) – Wer gegen eine Glaswand läuft, der hat keinen Anspruch auf Schmerzensgeld oder Schadensersatz. Denn in einem modernen Gebäude, das hauptsächlich aus
Glas besteht, muss man mit einer Glaswand rechnen. So urteilte das Landgericht Essen (Az. 18 O 270/14).
Wie die telefonische Rechtsberatung der Deutschen Anwaltshotline (www.deutsche-anwaltshotline.de) berichtet, reiste eine Frau zu einer Fachtagung. Der Tagungsort war ein Gebäude mit moderner Architektur und vielen Glaswänden. Als sie sich im Auditorium
aufhielt und auf Bekannte zuging, prallte sie gegen eine Glaswand. Sie hatte die polierte Doppelverglasung übersehen.
Sie zog sich eine Platzwunde an der Lippe und einen Haarriss in ihrem Schneidezahn zu. Dieser bestand aus einer Keramikprothese und musste daraufhin erneuert werden. Die Frau verlangte vom
Veranstalter Schadensersatz für den kaputten Zahn, da das Auditorium unzureichend beleuchtet gewesen sei. Der Fall ging vor Gericht.
Das Landgericht Essen versagte der Frau Schadensersatz und Schmerzensgeld. Dem Veranstalter sei keinerlei Rechtsverletzung vorzuwerfen. Die Tür zum Tagungsraum ist von der Glasfläche deutlich
sichtbar abgehoben, meint das Gericht. „Denn der Türrahmen war nicht aus Glas und darüber hing auch ein beleuchtetes Notausgangschild“, erklärt Rechtsanwalt Wolfgang Surhoff (telefonische
Rechtsberatung unter 0900/1875000-0 für 1,99 Euro pro Minute) den Richterspruch. Das Gebäude bestand zu einem Großteil aus Glas, daher habe die Frau mit einer Glaswand rechnen müssen.
Informationen für Mitglieder der Deutschen Anwaltshotline:
Auf der Seite www.jura-ticker.de stellt die Deutsche Anwaltshotline Ihnen kostenlos einen dynamischen Ticker mit täglich wechselnden Rechtsnachrichten zur Verfügung. Sie können diesen von uns entwickelten Ticker in Ihre eigene Homepage einbinden und so den Besuchern Ihrer Website einen neuen und informativen Service bieten.
Alle juristisch interessierten Leser können auch auf der Jura-Ticker-Homepage täglich aktualisierte Rechtsmeldungen studieren.
Als Abonnent unseres Newsletters haben Sie übrigens auch kostenlosen Zugang zum Mitgliederbereich. Sie können dort kostenlos eine Auswahl an anwaltlich geprüften Verträgen und Dokumenten downloaden, z.B. Kfz-Kaufvertrag, Arbeitsvertrag, Patientenverfügung, usw. Sie erhalten dort auch kostenlos Zugriff auf hilfreiche Broschüren, wie etwa zum Thema „Grillen – was ist erlaubt?“ oder „Hartz IV – Alles was wichtig ist“.
Besuchen Sie unseren Mitgliederbereich unter http://www.deutsche-anwaltshotline.de/allgemein/mitglieder/index.php mit folgenden Zugangsdaten (Gross- und Kleinschreibung beachten):
Benutzer: Deutsche-Anwaltshotline
Passwort: rechtlich
Den Mitgliederbereich erreichen Sie auch über den Menüpunkt "für Mitglieder" auf unserer Homepage.
Für alle persönlichen Rechtsfragen stehen Ihnen selbstständige Anwälte über die Deutschen Anwaltshotline von Montag bis Sonntag von 7:00 Uhr morgens - 01:00 nachts Uhr zur Verfügung.
Rufnummer Rechtsberatung: 0900-1-875 000-10 (1,99 Eur/Min*)
*inklusive 19 % Mehrwertsteuer aus dem Festnetz der Deutschen Telekom; ggf. abweichende Preise aus Mobilfunknetzen.
Unter www.deutsche-anwaltshotline.de können Sie auch die direkten Durchwahlen zu über 50 Rechtsgebieten abfragen.
Impressum:
Deutsche Anwaltshotline AG, Am Plärrer 7, 90443 Nürnberg Tel.: +49 911 / 376569-0, Fax: +49 911 / 376569-99
Register und Registernummer: Amtsgericht Nürnberg HRB 24658
Umsatzsteuer-ID: DE261181671
vertreten durch: Johannes Goth, Volker Schwengler, Christian Ulshöfer
Aufsichtsrat: Hartmut Dicke (Vorsitzender), Alexander Keller, Reinhold Gleichmann
Verantwortlicher für journalistisch-redaktionelle Inhalte gem. § 55 II RstV: Engin Aydin
Verfassungsbeschwerde gegen die Versagung von Eilrechtsschutz gegen die sofortige Vollziehung einer Besitzeinweisung erfolgreich
Pressemitteilung Nr. 73/2016 vom 19. Oktober 2016
Beschluss vom 14. September 2016
1 BvR 1335/13
Droht bei Versagung des einstweiligen Rechtsschutzes eine erhebliche Grundrechtsverletzung, die durch eine stattgebende Entscheidung in der Hauptsache nicht mehr beseitigt werden kann, so darf sich das Fachgericht im Eilverfahren grundsätzlich nicht auf eine bloße Folgenabwägung der widerstreitenden Interessen beschränken. Das Gebot effektiven Rechtsschutzes erfordert dann vielmehr regelmäßig eine über die sonst übliche, bloß summarische Prüfung des geltend gemachten Anspruchs hinausgehende, inhaltliche Befassung mit der Sach- und Rechtslage. Dies hat die 1. Kammer des Ersten Senats des Bundesverfassungsgerichts mit heute veröffentlichtem Beschluss entschieden und das Verfahren des einstweiligen Rechtsschutzes, mit dem sich die Beschwerdeführerin gegen die sofortige Vollziehung einer vorzeitigen Besitzeinweisung wendete, an das Oberverwaltungsgericht zurückverwiesen.
Sachverhalt:
Die Beschwerdeführerin ist Eigentümerin eines unbebauten, bewaldeten Grundstücks, das zwischenzeitlich für den Braunkohletagebau Cottbus-Nord in Anspruch genommen worden ist. Ende 2012 wurde der Beschwerdeführerin das Eigentum an ihrem Grundstück entzogen und zur bergbaulichen Nutzung auf die Betreiberin des Braunkohletagebaus übertragen; über die Klage der Beschwerdeführerin gegen diesen Grundabtretungsbeschluss wurde bislang noch nicht entschieden. Die Betreiberin wurde zudem unter Anordnung der sofortigen Vollziehung vorzeitig in den Besitz des Grundstücks eingewiesen.
Der Antrag der Beschwerdeführerin auf Gewährung vorläufigen Rechtsschutzes gegen die Anordnung der sofortigen Vollziehung der Besitzeinweisung blieb vor dem Verwaltungsgericht und dem Oberverwaltungsgericht erfolglos. Das Oberverwaltungsgericht führte im Wesentlichen aus, dass bei einer summarischen Prüfung die Erfolgsaussichten der Klage als offen angesehen werden müssten. Gleichwohl gehe die vor diesem Hintergrund vorzunehmende Interessenabwägung im Ergebnis zu Lasten der Beschwerdeführerin aus, da eine Stattgabe des Eilantrags voraussichtlich zu einem mehrmonatigen Stillstand des Tagebaus führen würde.
Mit ihrer Verfassungsbeschwerde rügt die Beschwerdeführerin eine Verletzung ihres Grundrechts auf Gewährleistung effektiven Rechtsschutzes aus Art. 19 Abs. 4 Satz 1 GG.
Wesentliche Erwägungen der Kammer:
Die Verfassungsbeschwerde ist erfolgreich, soweit sie sich gegen den Beschluss des Oberverwaltungsgerichts richtet. Die Entscheidung verletzt die Beschwerdeführerin in ihrem Grundrecht aus Art. 19 Abs. 4 Satz 1 GG.
1. Das Grundrecht des Art. 19 Abs. 4 Satz 1 GG garantiert jedem den Rechtsweg, der geltend macht, durch die öffentliche Gewalt in eigenen Rechten verletzt zu sein. Damit wird sowohl der Zugang zu den Gerichten als auch die Wirksamkeit des Rechtsschutzes gewährleistet. Dieser Anspruch des Bürgers auf eine möglichst wirksame gerichtliche Kontrolle umfasst die effektive Gewährung vorläufigen Rechtsschutzes. Art. 19 Abs. 4 Satz 1 GG kommt dabei auch die Aufgabe zu, irreparable Entscheidungen, wie sie durch die sofortige Vollziehung einer hoheitlichen Maßnahme eintreten können, soweit als möglich auszuschließen.
Grundsätzlich ist bei der Entscheidung über die Gewährung vorläufigen Rechtsschutzes eine summarische Prüfung verfassungsrechtlich unbedenklich; die notwendige Prüfungsintensität steigt jedoch mit der drohenden Rechtsverletzung, die bis dahin reichen kann, dass die Gerichte unter besonderen Umständen dazu verpflichtet sein können, die Sach- und Rechtslage nicht nur summarisch, sondern abschließend zu prüfen. Droht einem Antragsteller bei Versagung des fachgerichtlichen, einstweiligen Rechtsschutzes eine erhebliche, über Randbereiche hinausgehende Verletzung in seinen Grundrechten, die durch eine der Klage stattgebende Entscheidung in der Hauptsache nicht mehr beseitigt werden kann, so ist erforderlichenfalls unter eingehender tatsächlicher und rechtlicher Prüfung des im Hauptsacheverfahren geltend gemachten Anspruchs einstweiliger Rechtsschutz zu gewähren, es sei denn, dass ausnahmsweise überwiegende, besonders gewichtige Gründe entgegenstehen. Denn in diesen Fällen kann das Fachgericht nur im einstweiligen Rechtsschutz eine endgültige Grundrechtsverletzung verhindern. Ausschließlich auf eine sorgfältige und hinreichend substantiierte Folgenabwägung kommt es nur an, soweit eine Rechtmäßigkeitsprüfung nicht möglich ist.
2. Diese Anforderungen an die Gewährung einstweiligen Rechtsschutzes hat das Oberverwaltungsgericht in seiner Entscheidung nicht beachtet. Das Gericht hat sich auf eine Folgenabwägung zurückgezogen, ohne zuvor zu versuchen, dem verfassungsrechtlichen Gebot der tatsächlichen und rechtlichen Durchdringung des Falles gerecht zu werden. Nur durch sein Eingreifen im einstweiligen Rechtsschutz hätte die endgültige Grundrechtsverletzung vermieden werden können.
a) Das Oberverwaltungsgericht hat keinen Versuch unternommen, die Rechtmäßigkeit der vorzeitigen Besitzeinweisung zu überprüfen, obwohl es erkannt hat, dass durch deren Vollzug ein Zustand geschaffen wird, der zulasten der Beschwerdeführerin die Hauptsache vorwegnimmt. Eine inhaltliche Annäherung an die Lösung der vom Gericht in seinem Beschluss selbst aufgeworfenen offenen Fragen und deren Auswirkungen auf die Rechtmäßigkeit der vorzeitigen Besitzeinweisung erfolgte nicht.
Dass eine eingehendere Prüfung der Sach- und Rechtslage für das Oberverwaltungsgericht unmöglich gewesen wäre, ist nicht erkennbar. Die Sach- und Rechtslage erweist sich zwar als komplex; ein weitgehendes Durchdringen der Problemkreise im vorliegenden Fall im Verfahren des einstweiligen Rechtsschutzes erscheint jedoch nicht ausgeschlossen, zumal das Oberverwaltungsgericht nicht gehalten war, innerhalb des von ihm festgelegten, knapp bemessenen Zeitrahmens zu entscheiden. Die Notwendigkeit der gleichzeitigen Bearbeitung anderer Verfahren ist kein verfassungsrechtlich tragfähiger Grund für eine Reduzierung der Prüfungsintensität. Dies gilt umso mehr, weil die Betreiberin des Braunkohletagebaus das Grundabtretungs- und das Besitzeinweisungsverfahren erst sehr spät eingeleitet hat, obwohl ihr die ablehnende Haltung der Beschwerdeführerin seit langem bekannt war. Je mehr ein Vorhabenträger durch ihm zurechenbares Verhalten die besondere Eilbedürftigkeit einer Entscheidung selbst zu verantworten hat, desto eher sind ihm die aufgrund einer angemessenen, dem Anspruch effektiven Rechtsschutzes gerecht werdenden Dauer des einstweiligen Rechtsschutzverfahrens entstehende Belastungen zuzumuten.
b) Die Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts beruht auf der unzureichenden Beachtung der sich aus Art. 19 Abs. 4 Satz 1 GG ergebenden Anforderungen. Denn es ist nicht ausgeschlossen, dass das Oberverwaltungsgericht bei einer verfassungsrechtlich gebotenen Befassung mit dem Begehren von Eilrechtsschutz zu einem für die Beschwerdeführerin günstigeren Ergebnis gelangt wäre.
Eilanträge in Sachen „CETA“ erfolglos
Pressemitteilung Nr. 71/2016 vom 13. Oktober 2016
Urteil vom 13. Oktober 2016 - 2 BvR 1368/16, 2 BvR 1444/16, 2 BvR 1823/16, 2 BvR 1482/16, 2 BvE 3/16
Mit heute verkündetem Urteil hat der Zweite Senat des Bundesverfassungsgerichts mehrere Anträge auf Erlass einer einstweiligen Anordnung abgelehnt, die sich gegen eine Zustimmung des deutschen Vertreters im Rat der Europäischen Union zur Unterzeichnung, zum Abschluss und zur vorläufigen Anwendung des Freihandelsabkommens zwischen der Europäischen Union und Kanada (Comprehensive Economic and Trade Agreement - CETA) richteten, über die der Rat der Europäischen Union voraussichtlich am 18. Oktober 2016 entscheiden wird. Die Bundesregierung muss allerdings sicherstellen,
- dass ein Ratsbeschluss über die vorläufige Anwendung nur die Bereiche von CETA umfassen wird, die unstreitig in der Zuständigkeit der Europäischen Union liegen,
- dass bis zu einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts in der Hauptsache eine hinreichende demokratische Rückbindung der im Gemischten CETA-Ausschuss gefassten Beschlüsse gewährleistet ist, und
- dass die Auslegung des Art. 30.7 Abs. 3 Buchstabe c CETA eine einseitige Beendigung der vorläufigen Anwendung durch Deutschland ermöglicht.
Bei Einhaltung dieser Maßgaben bestehen für die Rechte der Beschwerdeführer sowie für die Mitwirkungsrechte des Deutschen Bundestages keine schweren Nachteile, die im Rahmen einer Folgenabwägung den Erlass einer einstweiligen Anordnung geboten erscheinen ließen.
Sachverhalt:
Im April 2009 ermächtigte der Rat der Europäischen Union die Europäische Kommission zur Aufnahme von Verhandlungen über ein Wirtschafts- und Handelsabkommen mit Kanada. Das Abkommen sollte das gemeinsame Ziel einer beiderseitigen schrittweisen Liberalisierung praktisch aller Bereiche des Waren- und Dienstleistungshandels und der Niederlassung bekräftigen und die Einhaltung internationaler Umwelt- und Sozialabkommen sicherstellen und erleichtern. Nach Abschluss der Verhandlungen unterbreitete die Europäische Kommission dem Rat der Europäischen Union im Juli 2016 den Vorschlag, die Unterzeichnung von CETA zu genehmigen, die vorläufige Anwendung zu erklären, bis die für seinen Abschluss erforderlichen Verfahren abgeschlossen sind, und das Abkommen abzuschließen.
Die Antragsteller zu I. - IV. machen im Wesentlichen geltend, dass ein Beschluss des Rates der Europäischen Union über die Genehmigung der Unterzeichnung von CETA, dessen vorläufige Anwendung und den Abschluss des Abkommens sie in ihren Rechten aus Art. 38 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 79 Abs. 3 und Art. 20 Abs. 1 und Abs. 2 GG verletze. Die Fraktion Die LINKE im Deutschen Bundestag trägt im Organstreitverfahren vor, dass sie in Prozessstandschaft Rechte des Deutschen Bundestages geltend mache, namentlich sein Gestaltungsrecht aus Art. 23 Abs. 1 Satz 2 in Verbindung mit Art. 59 Abs. 2 GG.
Wesentliche Erwägungen des Senats:
Die zulässigen Anträge sind unbegründet.
1. Das Bundesverfassungsgericht kann einen Zustand durch einstweilige Anordnung vorläufig regeln, wenn dies zur Abwehr schwerer Nachteile, zur Verhinderung drohender Gewalt oder aus einem anderen wichtigen Grund zum gemeinen Wohl dringend geboten ist (§ 32 Abs. 1 BVerfGG). Bei der Prüfung, ob die Voraussetzungen des § 32 Abs. 1 BVerfGG gegeben sind, ist regelmäßig ein strenger Maßstab anzulegen. Dieser wird noch weiter verschärft, wenn eine Maßnahme mit völkerrechtlichen oder außenpolitischen Auswirkungen in Rede steht. Die Erfolgsaussichten in der Hauptsache haben außer Betracht zu bleiben, es sei denn, die in der Hauptsache begehrte Feststellung oder der in der Hauptsache gestellte Antrag erwiese sich als von vornherein unzulässig oder offensichtlich unbegründet. Bei offenem Ausgang des Hauptsacheverfahrens muss das Bundesverfassungsgericht eine Folgenabwägung vornehmen.
2. Die Anträge auf Erlass einer einstweiligen Anordnung bleiben ungeachtet offener Fragen der Zulässigkeit und Begründetheit der Verfassungsbeschwerden und des Organstreitverfahrens jedenfalls aufgrund der gebotenen Folgenabwägung ohne Erfolg.
3. Erginge die einstweilige Anordnung, erwiese sich die Mitwirkung der Bundesregierung an der Beschlussfassung des Rates über die vorläufige Anwendung von CETA später aber als verfassungsrechtlich zulässig, drohten der Allgemeinheit mit hoher Wahrscheinlichkeit schwere Nachteile.
a) Dabei lägen die wesentlichen Folgen eines auch nur vorläufigen, erst recht aber eines endgültigen Scheiterns von CETA weniger auf wirtschaftlichem als vielmehr auf politischem Gebiet. Eine einstweilige Anordnung, durch die die Bundesregierung an einer Zustimmung zur vorläufigen Anwendung von CETA gehindert würde, würde in erheblichem Maße in die - grundsätzlich weite - Gestaltungsfreiheit der Bundesregierung im Rahmen der Europa-, Außen- und Außenwirtschaftspolitik eingreifen. Dies gälte in vergleichbarer Weise auch für die Europäische Union. Ein - auch nur vorläufiges - Scheitern von CETA dürfte über eine Beeinträchtigung der Außenhandelsbeziehungen zwischen der Europäischen Union und Kanada hinaus weit reichende Auswirkungen auf die Verhandlung und den Abschluss künftiger Außenhandelsabkommen haben. Insofern erscheint es naheliegend, dass sich der Erlass einer einstweiligen Anordnung negativ auf die europäische Außenhandelspolitik und die internationale Stellung der Europäischen Union insgesamt auswirken würde. Die mit dem Erlass einer einstweiligen Anordnung bei späterer Erfolglosigkeit der Hauptsache verbundenen Nachteile könnten sich mit hoher Wahrscheinlichkeit als irreversibel erweisen. Die zu erwartende Einbuße an Verlässlichkeit sowohl der Bundesrepublik Deutschland - als Veranlasser einer derartigen Entwicklung - als auch der Europäischen Union insgesamt könnte sich dauerhaft negativ auf den Handlungs- und Entscheidungsspielraum aller europäischen Akteure bei der Gestaltung der globalen Handelsbeziehungen auswirken.
b) Demgegenüber wiegen die Nachteile weniger schwer, die entstünden, wenn die einstweilige Anordnung nicht erlassen würde, sich die Mitwirkung der Bundesregierung an der Beschlussfassung des Rates später aber als unzulässig erwiese. Zwar enthält CETA Bestimmungen, die den Beschluss des Rates über die vorläufige Anwendung im Hauptsacheverfahren als Ultra-vires-Akt qualifizieren könnten. Auch ist eine Berührung der durch Art. 79 Abs. 3 GG geschützten Verfassungsidentität nicht ausgeschlossen.
aa) Allerdings hat die Bundesregierung dargelegt, dass durch die endgültige Fassung des streitgegenständlichen Ratsbeschlusses und entsprechende eigene Erklärungen (Art. 30.7 Abs. 3 Buchstabe b CETA) Ausnahmen von der vorläufigen Anwendung bewirkt werden, die es jedenfalls im Ergebnis sichergestellt erscheinen lassen, dass der bevorstehende Beschluss des Rates über die vorläufige Anwendung von CETA nicht als Ultra-vires-Akt zu qualifizieren sein dürfte. Soweit diese Vorbehalte reichen, dürften auch etwaige Bedenken gegen die in Rede stehende Regelung unter dem Gesichtspunkt der grundgesetzlichen Verfassungsidentität entkräftet sein. Die Bundesregierung hat darüber hinaus deutlich gemacht, dass sie im Rat nur denjenigen Teilen von CETA zustimmen wird, die sich zweifellos auf eine primärrechtliche Kompetenz der Europäischen Union stützen lassen. Sie wird ihrem Vorbringen nach nicht der vorläufigen Anwendung für Sachmaterien zustimmen, die in der Zuständigkeit der Bundesrepublik Deutschland verblieben sind. Dies betrifft insbesondere Regelungen zum Investitionsschutz, einschließlich des Gerichtssystems (Kapitel 8 und 13 CETA), zu Portfolioinvestitionen (Kapitel 8 und 13 CETA), zum internationalen Seeverkehr (Kapitel 14 CETA), zur gegenseitigen Anerkennung von Berufsqualifikationen (Kapitel 11 CETA) sowie zum Arbeitsschutz (Kapitel 23 CETA).
bb) Einer etwaigen Berührung der Verfassungsidentität (Art. 79 Abs. 3 GG) durch Kompetenzausstattung und Verfahren des Ausschusssystems kann - jedenfalls im Rahmen der vorläufigen Anwendung - auf unterschiedliche Weise begegnet werden. Es könnte etwa durch eine interinstitutionelle Vereinbarung sichergestellt werden, dass Beschlüsse des Gemischten CETA-Ausschusses nach Art. 30.2 Abs. 2 CETA nur auf Grundlage eines gemeinsamen Standpunktes (Art. 218 Abs. 9 AEUV) gefasst werden, der im Rat einstimmig angenommen worden ist.
cc) Sollte sich entgegen der Annahme des Senats ergeben oder abzeichnen, dass die Bundesregierung die von ihr angekündigten Handlungsoptionen zur Vermeidung eines möglichen Ultra-vires-Aktes oder einer Verletzung der Verfassungsidentität des Grundgesetzes (Art. 79 Abs. 3 GG) nicht realisieren kann, verbleibt ihr in letzter Konsequenz die Möglichkeit, die vorläufige Anwendung des Abkommens für die Bundesrepublik Deutschland durch schriftliche Notifizierung zu beenden (Art. 30.7 Abs. 3 Buchstabe c CETA). Zwar erscheint die Auslegung der genannten Norm nicht zwingend. Sie ist aber von der Bundesregierung als zutreffend vorgetragen worden. Dieses Verständnis hat sie in völkerrechtlich erheblicher Weise zu erklären und ihren Vertragspartnern zu notifizieren.
Nichtzulassung der Einbeziehung von Investitionskosten in die Abrechnung gegenüber Pflegebedürftigen nach alter Rechtslage verfassungsgemäß
Pressemitteilung Nr. 56/2016 vom 16. August 2016
Beschluss vom 13. Juli 2016
1 BvR
617/12, 1 BvR 618/12
Es ist verfassungsrechtlich nicht zu beanstanden, auf Grundlage des § 82 Abs. 2 und 3 SGB XI in der bis zum 27. Dezember 2012 geltenden Fassung gegenüber Pflegebedürftigen die kalkulatorische Berechnung von Eigenkapitalzinsen, von Rückstellungen für spätere Investitionen sowie von Pauschalen für Instandhaltungsmaßnahmen neben den tatsächlich angefallenen Kosten nicht zuzulassen. Dies hat die 1. Kammer des Ersten Senats des Bundesverfassungsgerichts mit heute veröffentlichtem Beschluss entschieden.
Sachverhalt:
Die Beschwerdeführerin betreibt in mehreren Bundesländern Einrichtungen der Behinderten- und Altenpflege und beantragte ohne Erfolg, den Pflegebedürftigen Investitionsaufwendungen in Form von Erbbauzinsen, Eigenkapitalzinsen und Rückstellungen für künftige Investitionen sowie Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen kalkulatorisch statt nach den tatsächlichen Kosten jeden Jahres berechnen zu dürfen. Mit den angegriffenen Entscheidungen vom 8. September 2011 hat das Bundessozialgericht lediglich die gesonderte Berechnung von Investitionsaufwendungen für Erbbauzinsen anerkannt und im Übrigen die Klagen abgewiesen. Mit Wirkung zum 28. Dezember 2012 hat der Bundesgesetzgeber die Umlagefähigkeit von Kapitalkosten (§ 82 Abs. 3 Satz 1 in Verbindung mit Abs. 2 Nr. 1 SGB XI) sowie die Umlagefähigkeit von Erbbauzinsen (§ 82 Abs. 3 Satz 1 SGB XI) explizit aufgenommen. Außerdem hat der Gesetzgeber die Möglichkeit für den Landesgesetzgeber geschaffen, bei der Berechnung von Aufwendungen pauschalierte Instandhaltungs- und Instandsetzungsaufwendungen zu berücksichtigen (§ 82 Abs. 3 Satz 3 Halbsatz 2 SGB XI). Mit ihren Verfassungsbeschwerden macht die Beschwerdeführerin im Wesentlichen geltend, dass die Auslegung des § 82 Abs. 3 SGB XI a.F. durch das Bundessozialgericht eine gänzliche Abkehr von sonst im Wirtschaftsverkehr üblichen und auch gesetzlich vorgesehenen Gepflogenheiten darstelle.
Wesentliche Erwägungen der Kammer:
Die Verfassungsbeschwerden werden nicht zur Entscheidung angenommen.
1. Auslegung und Anwendung des einfachen Rechts sind Sache der Fachgerichte; das Bundesverfassungsgericht beanstandet nur die Verletzung von Verfassungsrecht. Die hier angegriffenen Entscheidungen des Bundessozialgerichts lassen einen Verfassungsverstoß nicht erkennen.
2. Beide Entscheidungen kommen zum Ergebnis, dass auf Grundlage einer methodisch einwandfreien Auslegung des Wortlauts des § 82 SGB XI a.F. nur tatsächlich angefallene Kosten, die weder durch Vergütungen oder Entgelte noch mittels Förderung durch das Land abgegolten sind, dem Pflegebedürftigen berechnet werden können. Kalkulatorische Kosten in Form von Rücklagen für künftige Investitionen und Instandhaltungen, Abschreibungen und Eigenkapitalzinsen dürfen nicht umgelegt werden. Das ist verfassungsrechtlich nicht zu beanstanden. Ob deren Ergebnis für die alltägliche Verwaltungspraxis praktikabel ist oder unnötigen weiteren Verwaltungsaufwand verursacht, bleibt für die hier allein am Maßstab des Verfassungsrechts vorzunehmende Kontrolle der Urteile unerheblich.
3. Die Entscheidungen des Bundessozialgerichts entsprechen auch im Übrigen den Vorschriften des Grundgesetzes. Entgegen dem Vortrag der Beschwerdeführerin wird Art. 14 GG nicht durch die von ihr beanstandete Auslegung des damaligen Gesetzeswortlauts verletzt, denn dadurch wird keines ihrer konkreten Eigentumsrechte geschmälert, sondern allenfalls bilanziell anders bewertet. Eine Verletzung von Art. 12 GG ist ebenfalls nicht ersichtlich. Die beiden Urteile des Bundessozialgerichts erlauben an anderer Stelle eine Einbeziehung aller drei streitbefangenen Aufwendungen und berühren insoweit die Berufsausübung nicht. Ein Verstoß gegen Art. 3 Abs. 1 GG ist ebenfalls nicht zu erkennen. Zur denkbaren Ungleichbehandlung von Eigen- und Fremdkapital oder zwischen geförderten und nicht geförderten Pflegeeinrichtungen haben die Verfassungsbeschwerden weder hinreichend vorgetragen noch deren sachliche Rechtfertigung durch das Ziel der Vermeidung einer Doppelfinanzierung erwogen.
Wahre Tatsachenbehauptungen über Vorgänge aus der Sozialsphäre sind grundsätzlich hinzunehmen
Pressemitteilung Nr. 50/2016 vom 4. August 2016
Beschluss vom 29. Juni 2016
1 BvR 3487/14
Mit heute veröffentlichtem Beschluss hat die 3. Kammer des Ersten Senats des Bundesverfassungsgerichts einer Verfassungsbeschwerde gegen eine zivilgerichtliche Verurteilung stattgegeben, mit der dem Beschwerdeführer die Behauptung wahrer Tatsachen über einen drei Jahre zurückliegenden Rechtsstreit auf Internet-Portalen untersagt worden war. Die Fachgerichte haben die Bedeutung und Tragweite der Meinungsfreiheit nicht hinreichend gewürdigt. Die Schwelle zur Persönlichkeitsrechtsverletzung wird bei der Mitteilung wahrer Tatsachen über die Sozialsphäre regelmäßig erst überschritten, wo sie einen Persönlichkeitsschaden befürchten lässt, der außer Verhältnis zu dem Interesse an der Verbreitung der Wahrheit steht.
Sachverhalt:
Der Beschwerdeführer führte mit dem Kläger des Ausgangsverfahrens einen Rechtsstreit um Rückzahlungsansprüche aus einem gewerblichen Mietverhältnis. Der Kläger verpflichtete sich in einem Vergleich zur Zahlung von 1.100 € an den Beschwerdeführer. Nachdem der Beschwerdeführer das Ratenzahlungsangebot des Klägers abgelehnt hatte, erfolgte die vollständige Zahlung erst nach Stellung einer Strafanzeige und Erteilung eines Zwangsvollstreckungsauftrags. Drei Jahre später berichtete der Beschwerdeführer unter namentlicher Nennung des Klägers über diesen Vorgang auf Internet-Portalen, welche die Möglichkeit bieten, Firmen zu suchen und eine Bewertung abzugeben. Der Kläger begehrte im Ausgangsverfahren die Unterlassung dieser Äußerungen. Das Landgericht verurteilte den Beschwerdeführer antragsgemäß; das Oberlandesgericht wies die Berufung des Beschwerdeführers zurück. Mit seiner Verfassungsbeschwerde rügt der Beschwerdeführer die Verletzung seines Rechts auf freie Meinungsäußerung (Art. 5 Abs. 1 GG).
Wesentliche Erwägungen der Kammer:
Die angegriffenen Entscheidungen verletzen die Meinungsfreiheit des Beschwerdeführers aus Art. 5 Abs. 1 Satz 1 GG.
1. Die Gerichte legen zunächst zutreffend dar, dass die Behauptung wahrer Tatsachen über die Sozialsphäre grundsätzlich hingenommen werden müsse. Die Schwelle zur Persönlichkeitsrechtsverletzung wird in diesen Fällen regelmäßig erst überschritten, wo sie einen Persönlichkeitsschaden befürchten lässt, der außer Verhältnis zu dem Interesse an der Verbreitung der Wahrheit steht. Die Gerichte gehen weiter zutreffend davon aus, dass auch die Nennung des Namens im Rahmen einer solchen der allgemeinen Öffentlichkeit zugänglichen Bewertung das Persönlichkeitsrecht des Klägers berührt. Hierbei darf der Einbruch in die persönliche Sphäre nicht weiter gehen, als eine angemessene Befriedigung des Informationsinteresses dies erfordert. Die für den Genannten entstehenden Nachteile müssen im rechten Verhältnis zur Schwere des geschilderten Verhaltens oder der sonstigen Bedeutung für die Öffentlichkeit stehen.
2. Eine ausreichend schwere Beeinträchtigung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts des Klägers zeigen die angegriffenen Entscheidungen nicht auf und begründen nicht in tragfähiger Weise, dass der Kläger die unbestritten wahren Äußerungen ausnahmsweise nicht hinnehmen muss. Sie lassen nicht erkennen, dass dem Kläger ein unverhältnismäßiger Verlust an sozialer Achtung droht. Auch die namentliche Nennung des Klägers, der seine Firma unter diesem Namen führt, steht nicht außer Verhältnis zum geschilderten Verhalten. Es ist verfassungsrechtlich nicht zu beanstanden, wenn die Gerichte hier ein öffentliches Informationsinteresse möglicher Kundinnen und Kunden des Klägers bejahen.
3. Soweit die Gerichte darauf abstellen, dass sich der Beschwerdeführer erst drei Jahre nach dem Rechtsstreit äußert, führt dies nicht zu einem Überwiegen des allgemeinen Persönlichkeitsrechts des Klägers. Es würde den Beschwerdeführer unverhältnismäßig in seiner Meinungsfreiheit einschränken, wenn er nach einer solchen Zeitspanne von ihm erlebte unstreitig wahre Tatsachen nicht mehr äußern dürfte.
Die falsche Einordnung einer Äußerung als Tatsache verkürzt den grundrechtlichen Schutz der Meinungsfreiheit
Pressemitteilung Nr. 49/2016 vom 3. August 2016
Beschluss vom 29. Juni 2016
1 BvR 2732/15
Wird eine Äußerung unzutreffend als Tatsachenbehauptung eingestuft, liegt darin eine Verkürzung des Grundrechts auf freie Meinungsäußerung, da die Vermutung zugunsten der freien Rede für Tatsachenbehauptungen nicht in gleicher Weise gilt wie für Meinungsäußerungen im engeren Sinne. Dies hat die 3. Kammer des Ersten Senats des Bundesverfassungsgerichts mit heute veröffentlichtem Beschluss entschieden. Sie hat damit einer Verfassungsbeschwerde gegen die strafgerichtliche Verurteilung des Beschwerdeführers wegen übler Nachrede stattgegeben und die Sache zur erneuten Entscheidung an das Amtsgericht zurückverwiesen.
Sachverhalt:
Der Beschwerdeführer wurde mehrfach vom selben Polizeibeamten kontrolliert. An einem Abend im November 2013 bemerkte er diesen Polizeibeamten in einem Polizeifahrzeug vor seinem Haus, als er in der Einfahrt gegenüber wendete und dabei das vom Beschwerdeführer bewohnte Gebäude anleuchtete. Nachdem er dasselbe Fahrzeug im späteren Verlauf des Abends nochmals gesehen hatte, veröffentlichte er hierzu einen Eintrag auf seiner Facebook-Seite. Er warf dem namentlich genannten Polizeibeamten vor, er habe nichts Besseres zu tun als in irgendwelchen Einfahrten mit Auf- und Abblendlicht zu stehen und in die gegenüberliegenden Häuser zu leuchten und bezeichnete ihn als „Spanner“. Das Amtsgericht verurteilte den Beschwerdeführer wegen übler Nachrede (§ 186 StGB) zu einer Geldstrafe. Die Sprungrevision zum Oberlandesgericht blieb erfolglos. Mit seiner Verfassungsbeschwerde rügt der Beschwerdeführer die Verletzung seines Rechts auf freie Meinungsäußerung (Art. 5 Abs. 1 GG).
Wesentliche Erwägungen der Kammer:
Die angegriffenen Entscheidungen verletzen den Beschwerdeführer in seinem Grundrecht auf Meinungsfreiheit aus Art. 5 Abs. 1 Satz 1 GG.
1. Die Gerichte verkürzen den Schutzgehalt des Grundrechts hinsichtlich der gegenständlichen Äußerungen insofern, als sie in verfassungsrechtlich nicht mehr tragbarer Art und Weise annehmen, dass es sich um eine nicht erweislich wahre, ehrverletzende Tatsachenbehauptung im Sinne von § 186 StGB handelt.
Bei der Frage, ob eine Äußerung ihrem Schwerpunkt nach als Meinungsäußerung oder als Tatsachenbehauptung anzusehen ist, kommt es entscheidend auf den Gesamtzusammenhang dieser Äußerung an. Die isolierte Betrachtung eines umstrittenen Äußerungsteils wird den Anforderungen an eine zuverlässige Sinnermittlung regelmäßig nicht gerecht. Anders als bei Meinungen im engeren Sinne, bei denen insbesondere im öffentlichen Meinungskampf im Rahmen der regelmäßig vorzunehmenden Abwägung eine Vermutung zugunsten der freien Rede gilt, gilt dies für Tatsachenbehauptungen nicht in gleicher Weise. Bedeutung und Tragweite der Meinungsfreiheit sind deshalb auch dann verkannt, wenn eine Äußerung unzutreffend als Tatsachenbehauptung, Formalbeleidigung oder Schmähkritik eingestuft wird mit der Folge, dass sie dann nicht im selben Maß am Schutz des Grundrechts teilnimmt wie Äußerungen, die als Werturteil ohne beleidigenden oder schmähenden Charakter anzusehen sind.
2. Diesen verfassungsrechtlichen Anforderungen werden die angegriffenen Entscheidungen nicht gerecht. Die Gerichte gehen zu Unrecht vom Vorliegen einer Tatsachenbehauptung aus und verkürzen damit den grundrechtlichen Schutz der Meinungsfreiheit. Der Beschwerdeführer schildert zwar ein tatsächliches Geschehen, nämlich den Wendevorgang des Polizeibeamten. Die Äußerung „Spanner“ war in vorliegendem Zusammenhang keine Tatsachenbehauptung, sondern eine Bewertung des Beobachteten, die dem Beweis nicht zugänglich ist. Bereits die falsche Einordnung der Äußerung als Tatsache führt zur Aufhebung der angegriffenen Entscheidungen.
3. Damit ist nicht entschieden, dass die Bezeichnung des Polizeibeamten als „Spanner“ im Ergebnis von der Meinungsfreiheit gedeckt war, und schon gar nicht, dass der Beschwerdeführer den Polizeibeamten künftig beliebig als „Spanner“ bezeichnen könnte. Soweit es sich bei der Äußerung nicht um eine Tatsachenbehauptung, sondern naheliegender Weise um ein Werturteil handeln sollte, läge hierin eine Herabsetzung des Polizeibeamten und damit eine Beeinträchtigung seines allgemeinen Persönlichkeitsrechts, die nicht ohne weiteres zulässig ist. Wieweit diese Äußerung durch die Meinungsfreiheit gerechtfertigt sein kann, entscheidet sich grundsätzlich nach Maßgabe einer Abwägung, die freilich nicht Gegenstand vorliegenden Verfahrens ist, das sich mit der Verbreitung von Tatsachenbehauptungen (Üble Nachrede nach § 186 StGB), nicht aber mit dem Tatbestand der Beleidigung nach § 185 StGB befasst.
|
Newsletter Juli 2016 |
Liebe Mandanten und Interessenten!
Wir stellen Ihnen in unserem aktuellen Newsletter wieder neue interessante und nützliche Urteile aus verschiedenen Rechtsgebieten vor.
Über unsere Homepage www.deutsche-anwaltshotline.de erhalten Sie sofort Rechtsberatung per Telefon und per E-Mail durch selbstständige Rechtsanwälte.
Viel Vergnügen beim Lesen unseres Newsletters wünschen Ihnen die Kooperationsanwälte und die Geschäftsleitung der Deutschen Anwaltshotline!
Inhalt:
- Kaputter Helm nach Unfall: muss Hersteller haften?
- Zeitung veröffentlicht Facebook-Hetzer: erlaubt?
- Verspätetes Gepäck: Wer haftet für nötige Ersatzkäufe?
- Pornoseiten im Büro besucht: fristlose Kündigung?
- Blasphemie auf der Heckscheibe: strafbar?
Kaputter Helm nach Unfall: muss Hersteller
haften?
Nürnberg (D-AH/fk) – Wer sich bei einem Motorradunfall verletzt, der kann nur dann den Hersteller des Helms dafür
verantwortlich machen, wenn bewiesen ist, dass der Helm einen Mangel hatte. Die schlichte Behauptung reicht jedenfalls nicht aus, urteilte das Oberlandesgericht Brandenburg (Az. 1 U 8/13).
Wie die telefonische Rechtsberatung der Deutschen Anwaltshotline (www.deutsche-anwaltshotline.de) berichtet, kaufte sich ein Mopedfahrer einen Helm, mit der Norm ECE 22.05. Helme dieser Norm werden besonders streng auf ihre Sicherheit getestet. Der
Mann hatte einige Monate später einen Unfall mit seinem Moped, bei dem er stürzte und mit dem Kopf gegen eine Straßenlaterne prallte. Dabei ging der Helm zu Bruch und er verletzte sich schwer. Der
Unfallfahrer war der Meinung, der Helm hätte einen Mangel gehabt und ihn besser vor Verletzungen schützen müssen. Er verlangte Schmerzensgeld vom Hersteller, doch dieser weigerte sich. Denn der Helm
sei unter den geforderten Bedingungen für die Sicherheitsnorm getestet worden. Der Fall ging vor Gericht.
Das Oberlandesgericht Brandenburg gab dem Hersteller recht und bestätigte damit auch die Entscheidung der Vorinstanz. Es gebe keine Hinweise darauf, dass der Helm zum Unfallzeitpunkt einen Sachmangel
hatte. „Dieser muss nicht unbedingt vorgelegen haben, nur weil der Helm zu Bruch ging“, erklärt Rechtsanwalt Wolfgang Surhoff (telefonische Rechtsberatung unter 0900/1875000-0 für 1,99 Euro pro
Minute). Denn bei einem solchen Unfall nicht zu brechen sei keine Anforderung für die Sicherheitsnorm, so das Gericht.
Ein Sachverständiger hatte zusätzlich die Funktionalität des Helms bestätigt. Zunächst hat der Helm die Aufgabe, seinen Träger vor Verletzungen bestmöglich zu schützen. Der Helm hat das erfüllt,
indem er den Schaden möglichst klein gehalten hat. Dem Hersteller sei hier somit kein Vorwurf zu machen und der Mann habe damit auch keinen Anspruch auf Schmerzensgeld.
Zeitung veröffentlicht Facebook-Hetzer: erlaubt?
Nürnberg (D-AH/fk) – Wer bei Facebook ein Bild von sich hochlädt, der erteilt nicht automatisch eine Erlaubnis, es
außerhalb davon zu verbreiten. So urteilte das Oberlandesgericht München (Az. 29 U 368/16).
Wie die telefonische Rechtsberatung der Deutschen Anwaltshotline (www.deutsche-anwaltshotline.de) berichtet, war eine Frau mit der Flüchtlingspolitik in Deutschland unzufrieden und machte ihrem Ärger auf Facebook Luft. Sie bezeichnete Flüchtlinge als
„Tiere“, die nur zum „gut gefüllten Futternapf“ rennen würden. Die Bild-Zeitung fasste in ihrem Online-Auftritt mehrere solcher Kommentare zusammen unter dem Titel: „Hass auf Flüchtlinge – Bild
stellt die Hetzer an den Pranger“. Darunter befand sich auch besagter Beitrag sowie erkennbar Profilbild und Name der “Hetzerin“. Das wollte sie sich nicht gefallen lassen und forderte die Zeitung
auf, beides unkenntlich zu machen. Die Zeitung weigerte sich und der Fall ging vor Gericht.
Das Oberlandesgericht München gab der Frau recht und kassierte damit das Urteil der Vorinstanz. Zwar hatte die Frau ihr Profilbild öffentlich einsehbar auf Facebook hochgeladen. Das gebe Dritten aber
nicht das Recht, dieses auch zu verbreiten. „Denn dazu wäre eine ausdrückliche oder stillschweigende Genehmigung erforderlich“, erklärt Rechtsanwalt Karl-Heinz Lehmann (telefonische Rechtsberatung
unter 0900/1875000-0 für 1,99 Euro pro Minute). Doch weder hatte die Frau ihr ausdrückliches Einverständnis gegeben, noch waren ihr Zweck, Art und Umfang der Verwendung des Bildes bekannt. Das
schließe eine stillschweigende Genehmigung aus.
Die Bild-Zeitung verletze die Frau zudem in ihren Persönlichkeitsrechten. Das Blatt dürfe zwar in seiner Rolle als Massenmedium die Stimmung innerhalb der Bevölkerung einfangen – auch durch
Facebook-Posts. Aber es gebe keinen Grund, warum dies mit identifizierbarem Bild und Namen geschehen müsse, urteilte das Gericht.
Verspätetes Gepäck: Wer haftet für nötige Ersatzkäufe?
Nürnberg (D-AH/fk) – Wer im Urlaub sein Gepäck erst Tage nach seiner Ankunft erhält, dem muss der Reiseveranstalter
nicht die vollen Kosten der Ersatzkäufe zurückerstatten. So urteilte das Amtsgericht Köln (Az. 142 C 392/14).
Wie die telefonische Rechtsberatung der Deutschen Anwaltshotline (www.deutsche-anwaltshotline.de) berichtet, verreiste eine Frau zusammen mit einem Ehepaar nach Spanien. Ihr Flug hatte dabei 24 Stunden Verspätung. Damit nicht genug, befand sich das
Hotelzimmer gegenüber einer lauten Baustelle und sie erhielt ihren Koffer erst drei Tage nach ihrer Ankunft. Die Urlauberin zog daraufhin los und besorgte sich Ersatzkleidung im Wert von 465 Euro.
Wegen der Lärmbelästigung und des verspäteten Gepäcks wollte sie im Nachhinein ihren Reisepreis mindern und die Kosten für die Neueinkäufe erstattet haben – insgesamt ca. 900 Euro. Der
Reiseveranstalter bot ihr ca. 340 Euro an, doch das war der Frau zu wenig. Sie ging deshalb vor Gericht.
Das Amtsgericht Köln gab ihr nur teilweise recht. Die Lärmbelästigung und die Unannehmlichkeiten wegen des verspäteten Gepäcks schmälerten zweifellos die erhoffte Erholung. “Entspricht der Urlaub
nicht der beschriebenen Leistung, muss der Veranstalter den Preis nachträglich mindern“, erklärt Rechtsanwalt Karl Heinz Lehmann (telefonische Rechtsberatung unter 0900/1875000-0 für 1,99 Euro pro
Minute).
Die Ersatzkäufe muss der Veranstalter aber nicht voll zurückzahlen. Auch wenn die wegen des verschwundenen Koffers nötig waren. Denn die Kleidung durfte die Urlauberin ja schließlich auch dann
behalten, als sie den Koffer verspätet wiederbekam. Das Gericht sprach der Frau deswegen nur ca. 560 Euro zu.
Pornoseiten im Büro besucht: fristlose Kündigung?
Nürnberg (D-AH/fk) – Wer gegen das Verbot, während der Arbeit privat im Internet zu surfen, massiv verstößt, dem kann
der Arbeitgeber fristlos kündigen. Den Browserverlauf zu verfolgen, ist außerdem verhältnismäßig, wenn keine andere Möglichkeit besteht, das private Surfen nachzuweisen. So urteilte das
Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg (Az. 5 Sa 657/15).
Wie die telefonische Rechtsberatung der Deutschen Anwaltshotline (www.deutsche-anwaltshotline.de) berichtet, arbeitete ein Mann als Gruppenleiter mit eigenem Büro im Betrieb. Dem Arbeitgeber fiel auf, dass das Datenvolumen des Angestellten ungewöhnlich
hoch war. Daraufhin wurde sein Surfverhalten näher überprüft und festgestellt, dass er während der Arbeitszeit privat surfte. Sein Arbeitsvertrag erlaubte das ausdrücklich nur in Ausnahmefällen
während der Pause.
Der Gruppenleiter aber nutzte das Internet, um private Mails zu lesen, sich auf Fetisch-Seiten herumzutreiben und um Sextreffen zu arrangieren. Das tat er in einem solchen Ausmaß, dass er innerhalb
von zwei Monaten ca. 40 Stunden privat im Internet verbrachte. Der Arbeitgeber kündigte seinem Mitarbeiter daraufhin fristlos. Das wollte dieser nicht hinnehmen und der Fall ging vor Gericht.
Das Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg erklärte die fristlose Kündigung für rechtens. Wer das Internet während seiner Arbeitszeit privat nutzt, der verletze seine Arbeitspflicht. Denn das
private Surfen in einem solchen Umfang beeinträchtigte seine Arbeitsleistung immens. „Wegen des begründeten Anfangsverdachts war es auch angemessen, den Browserverlauf des Mitarbeiters zu
überprüfen“, erklärt Rechtsanwalt Frank Böckhaus (telefonische Rechtsberatung unter 0900/1875000-0 für 1,99 Euro pro Minute). Zwar handelt es sich hierbei um personenbezogene Daten, doch es sei die
beste Möglichkeit gewesen, den Internetmissbrauch aufzudecken.
Blasphemie auf der Heckscheibe: strafbar?
Nürnberg (D-AH/fk) – Wer sich mit Sprüchen auf der Autoheckscheibe über die Kirche lustig macht oder gar zum Mord am
Papst aufruft, der stört den öffentlichen Frieden. So urteilte das Amtsgericht Lüdinghausen (Az. Ds-81 Js 3303/15-174/15).
Wie die telefonische Rechtsberatung der Deutschen Anwaltshotline (www.deutsche-anwaltshotline.de) berichtet, hat ein pensionierter Lehrer so seine Schwierigkeiten mit der Kirche. Er ist zwar in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen, meinte jedoch
mit fortschreitendem Alter, dass Religion Humbug sei. Seiner Meinung verlieh er auf der Heckscheibe seines Autos Ausdruck. So schrieb er sich „Jesus – 2000 Jahre rumhängen und immer noch kein Krampf“
auf die Heckscheibe und rief mit einem anderen Slogan offen zum Mord am Papst auf. Er wollte damit provozieren und aufklären. Damit erregte damit neben dem Interesse von Passanten und Autofahrern
auch das der Staatsanwaltschaft. Der Gotteslästerer musste sich also nun vor Gericht für seine beleidigenden Heckscheibenaufschriften verantworten.
Das Amtsgericht Lüdinghausen verurteilte ihn wegen Störung des öffentlichen Friedens. Er habe mit seinen Beschimpfungen die religiöse Überzeugung Gläubiger beeinträchtigt. „Außerdem hat er die
Intoleranz gegenüber der Kirche und ihrer Anhänger gefördert“, erklärt Rechtsanwalt Frank Böckhaus (telefonische Rechtsberatung unter 0900/1875000-0 für 1,99 Euro pro Minute). Der pensionierte Lehrer
nahm eine solche Störung durch sein Verhalten billigend in Kauf.
Auch auf Kunstfreiheit könne sich der Mann nicht berufen. Weder könne das Amtsgericht selbst einen künstlerischen Hintergrund bei den Heckscheibensprüchen feststellen noch sei dieser für unbeteiligte
zu erkennen. Das Gericht verurteilte den Aufklärer zu 30 Tagessätzen zu je 100 Euro.
Informationen für Mitglieder der Deutschen Anwaltshotline:
Auf der Seite www.jura-ticker.de stellt die Deutsche Anwaltshotline Ihnen kostenlos einen dynamischen Ticker mit täglich wechselnden Rechtsnachrichten zur Verfügung. Sie können diesen von uns entwickelten Ticker in Ihre eigene Homepage einbinden und so den Besuchern Ihrer Website einen neuen und informativen Service bieten.
Alle juristisch interessierten Leser können auch auf der Jura-Ticker-Homepage täglich aktualisierte Rechtsmeldungen studieren.
Als Abonnent unseres Newsletters haben Sie übrigens auch kostenlosen Zugang zum Mitgliederbereich. Sie können dort kostenlos eine Auswahl an anwaltlich geprüften Verträgen und Dokumenten downloaden, z.B. Kfz-Kaufvertrag, Arbeitsvertrag, Patientenverfügung, usw. Sie erhalten dort auch kostenlos Zugriff auf hilfreiche Broschüren, wie etwa zum Thema „Grillen – was ist erlaubt?“ oder „Hartz IV – Alles was wichtig ist“.
Besuchen Sie unseren Mitgliederbereich unter http://www.deutsche-anwaltshotline.de/allgemein/mitglieder/index.php mit folgenden Zugangsdaten (Gross- und Kleinschreibung beachten):
Benutzer: Deutsche-Anwaltshotline
Passwort:
rechtlich
Den Mitgliederbereich erreichen Sie auch über den Menüpunkt "für Mitglieder" auf unserer Homepage.
Für alle persönlichen Rechtsfragen stehen Ihnen selbstständige Anwälte über die Deutschen Anwaltshotline von Montag bis Sonntag von 7:00 Uhr morgens - 01:00 nachts Uhr zur Verfügung.
Rufnummer Rechtsberatung: 0900-1-875 000-10 (1,99 Eur/Min*)
*inklusive 19 % Mehrwertsteuer aus dem Festnetz der Deutschen Telekom; ggf. abweichende Preise aus Mobilfunknetzen.
Unter www.deutsche-anwaltshotline.de können Sie auch die direkten Durchwahlen zu über 50 Rechtsgebieten abfragen.
Impressum:
Deutsche Anwaltshotline AG, Am Plärrer 7, 90443 Nürnberg Tel.: +49 911 / 376569-0, Fax: +49 911 / 376569-99
Register und Registernummer: Amtsgericht Nürnberg HRB 24658
Umsatzsteuer-ID: DE261181671
vertreten durch: Johannes Goth, Volker Schwengler, Christian Ulshöfer
Aufsichtsrat: Hartmut Dicke (Vorsitzender), Alexander Keller, Reinhold Gleichmann
Verantwortlicher für journalistisch-redaktionelle Inhalte gem. § 55 II RstV: Engin Aydin, Manuel Christa
Erfolglose Verfassungsbeschwerde gegen die Einführung des „Bestellerprinzips“ bei Maklerprovisionen für Wohnraummietverträge
Pressemitteilung Nr. 46/2016 vom 21. Juli 2016
Beschluss vom 29. Juni 2016
1 BvR 1015/15
Die mit dem Mietrechtsnovellierungsgesetz vorgenommene Normierung des Bestellerprinzips für Wohnungsvermittlungen, das Maklern den Erhalt einer Provision von Mietinteressierten weitgehend verstellt, genügt den verfassungsrechtlichen Anforderungen. Dies hat der Erste Senat des Bundesverfassungsgerichts mit heute veröffentlichtem Beschluss entschieden. Der Gesetzgeber bringt die sich gegenüberstehenden Interessen von Wohnungssuchenden und Wohnungsvermittlern in einen Ausgleich, der Verhältnismäßigkeitsanforderungen gerecht wird. Mit der Verfassungsbeschwerde gegen das Mietrechtsnovellierungsgesetz hatten zwei Immobilienmakler die Bedrohung ihrer wirtschaftlichen Existenz und ein Wohnungsmieter die Verletzung seines Rechts auf Vertragsfreiheit gerügt.
Sachverhalt:
Der Gesetzgeber hat durch das Mietrechtsnovellierungsgesetz vom 21. April 2015 das Bestellerprinzip bei der
Wohnungsvermittlung eingeführt. Danach darf ein Wohnungsvermittler für die Vermittlung oder den Nachweis der Gelegenheit zum Abschluss von Mietverträgen über Wohnräume vom Wohnungssuchenden kein
Entgelt fordern, sich versprechen lassen oder annehmen, es sei denn, der Wohnungsvermittler holt ausschließlich wegen des Vermittlungsvertrags mit dem Wohnungssuchenden vom Vermieter den Auftrag ein,
die Wohnung anzubieten. Auch Vereinbarungen, durch die Wohnungsuchende verpflichtet werden, ein vom Vermieter oder einem Dritten geschuldetes Vermittlungsentgelt zu zahlen, sind unwirksam. Verstöße
können mit Bußgeldern bis zu 25.000 Euro gegenüber dem Wohnungsvermittler verfolgt werden.
Hierdurch soll gewährleistet werden, dass diejenige Partei, in deren wirtschaftlichem Interesse der Wohnungsvermittler vorwiegend tätig wird, auch dessen Vertragspartner im rechtlichen Sinne wird und bleibt.
Die Beschwerdeführer zu 1) und 2) sind Immobilienmakler und rügen mit ihrer Verfassungsbeschwerde im Wesentlichen eine Verletzung ihrer Berufsfreiheit (Art. 12 Abs. 1 GG). Der Beschwerdeführer zu 3) ist Wohnungsmieter und rügt im Wesentlichen die Verletzung seiner durch Art. 2 Abs. 1 GG geschützten Vertragsfreiheit.
Wesentliche Erwägungen des Senats:
Die Verfassungsbeschwerde des Beschwerdeführers zu 3) ist unzulässig. Die Verfassungsbeschwerde der Beschwerdeführer
zu 1) und 2) ist zulässig, jedoch nicht begründet.
1. Die Beschwerdeführer zu 1) und 2) können ihre Verfassungsbeschwerde unmittelbar gegen die gesetzlichen Bestimmungen richten, weil sie als Immobilienmakler durch die Neuregelung unmittelbar betroffen sind. Ohne dass hierfür noch ein besonderer Vollziehungsakt erforderlich ist, können sie nicht mehr in der bisher üblichen, nach Form und Inhalt freien vertraglichen Gestaltung ein Vermittlungsentgelt von Wohnungssuchenden verlangen.
2. Die angegriffenen Regelungen beschränken zwar die Berufsfreiheit (Art. 12 Abs. 1 GG) der Beschwerdeführer zu 1) und 2); dies ist aber verfassungsrechtlich gerechtfertigt.
a) Der Gesetzgeber darf die durch Art. 12 Abs. 1 GG geschützte Freiheit, ein Entgelt für berufliche Leistungen einzelvertraglich zu vereinbaren, durch zwingendes Gesetzesrecht begrenzen, um sozialen oder wirtschaftlichen Ungleichgewichten entgegenzuwirken. Wie auch bei sonstigen privatrechtlichen Regelungen, die der freien Vertragsgestaltung Grenzen setzen, geht es um den Ausgleich widerstreitender Interessen, bei dem die Freiheit der einen mit der Freiheit der anderen in Einklang zu bringen ist. Für die Herstellung eines solchen Ausgleichs verfügt der Gesetzgeber über einen weiten Beurteilungs- und Gestaltungsspielraum. Eine Grundrechtsverletzung kann in einer solchen Lage nur festgestellt werden, wenn eine Grundrechtsposition den Interessen des anderen Vertragspartners in einer Weise untergeordnet wird, dass in Anbetracht der Bedeutung und Tragweite des betroffenen Grundrechts von einem angemessenen Ausgleich nicht mehr gesprochen werden kann.
b) Daran gemessen genügt die Normierung des Bestellerprinzips den verfassungsrechtlichen Anforderungen. Sie bringt die sich gegenüberstehenden Interessen in einen Ausgleich, der Verhältnismäßigkeitsanforderungen gerecht wird, insbesondere der dem Gesetzgeber zustehenden sozialstaatlichen Gestaltungsbefugnis entspricht. Er hat nachvollziehbar festgestellt, dass auf dem Mietwohnungsmarkt zu Lasten der Wohnungssuchenden soziale und wirtschaftliche Ungleichgewichte bestehen und eine Regelung getroffen, die einen angemessenen Ausgleich schaffen soll. Dieser Ausgleich ist durch das legitime Ziel des Verbraucherschutzes sozialstaatlich gerechtfertigt, um zu verhindern, dass die Wohnungssuchenden Kosten tragen müssen, die vorrangig im Interesse des Vermieters entstanden sind.
Ob aufgrund der gesetzlichen Regelung Provisionsansprüche gegen Wohnungssuchende auch in den - vom Bundesrat im Gesetzgebungsverfahren problematisierten - Fällen der Mehrfachbeauftragung und der Vorbefassung des Maklers ausgeschlossen sind, bleibt grundsätzlich einer Klärung durch die fachgerichtliche Rechtsprechung überlassen. Selbst bei weiter Auslegung im Sinne eines umfassenden Ausschließlichkeitsprinzips, das mit einer am tiefsten greifende Beeinträchtigung der Berufsfreiheit verbunden ist, lässt sich ein Verfassungsverstoß nicht feststellen; deswegen ist jedenfalls eine restriktive verfassungskonforme Auslegung nicht geboten.
Die angegriffenen Regelungen führen zu einem angemessenen Ausgleich widerstreitender Interessen. Die Wohnungsvermittler werden nicht zu einer grundlegenden Veränderung ihrer geschäftlichen Aktivitäten und Angebote in der Weise gezwungen, dass sie die berufliche Tätigkeit, die bisher ihre Lebensgrundlage bildete, völlig aufgeben und sich eine ganz neue berufliche Existenz aufbauen müssten. Da provisionspflichtige Aufträge zur Wohnungsvermittlung weiterhin möglich sind, können Makler auf diesem Geschäftsfeld tätig bleiben.
Den grundrechtlich geschützten Interessen der Beschwerdeführer zu 1) und 2) an der freien Berufsausübung stehen die gleichfalls berechtigten Interessen der Wohnungssuchenden gegenüber. Durch die gesetzliche Regelung des Bestellerprinzips sollen für sie Hindernisse bei einer Anmietung von Wohnräumen beseitigt werden. Ziel ist es, eine Überforderung - insbesondere wirtschaftlich schwächerer - Wohnungssuchender zu vermeiden. Dies und der Schutz vor Nachteilen aufgrund der Nachfragesituation auf dem Wohnungsmarkt rechtfertigen es zudem, auf Seiten der Wohnungssuchenden das Sozialstaatsprinzip (Art. 20 Abs. 1, Art. 28 Abs. 1 GG) in die Abwägung einzubeziehen.
Unter Berücksichtigung des weiten Beurteilungs- und Gestaltungsspielraums, über den der Gesetzgeber hier verfügt, wird das Ziel eines angemessenen Ausgleichs nicht verfehlt. Der Gesetzgeber trägt einem Ungleichgewicht Rechnung, das durch ein gegenüber dem Bedarf knappes Angebot an Mietwohnungen entsteht. Hierzu hat er mit der Belastung der Wohnungssuchenden durch Maklercourtage einen nicht unwesentlichen Kostenfaktor aufgegriffen und eine Regelung geschaffen, die diese Kosten den Vermietern als denjenigen zuweist, in deren Interesse die Aufwendungen typischerweise entstehen. Seine Entscheidung, hierfür als Mittel eine Einschränkung der vertraglichen Möglichkeiten und damit der Berufsfreiheit der Wohnungsvermittler zu wählen, bewegt sich innerhalb des weiten Gestaltungsspielraums des Gesetzgebers. Dass der Ausgleich zwangsläufig mit Einnahmeeinbußen der Wohnungsvermittler einhergeht, steht insgesamt der Angemessenheit der gewählten Lösung nicht entgegen; denn diese Belastung ist dadurch gerechtfertigt, dass Wohnungsvermittler - weil sie im Interesse der Vermieter beauftragt werden - mit Provisionsforderungen an diese verwiesen werden dürfen.
3. Für eine Verletzung anderer Grundrechte durch die Einführung des Bestellerprinzips ist nichts ersichtlich. Insbesondere haben die Beschwerdeführer zu 1) und 2) keine eigentumsfähige Position geltend gemacht, die dem Schutz des Art. 14 GG unterfallen könnte.
4. Auch das gleichzeitig eingeführte Textformerfordernis für Wohnungsvermittlungsverträge (§ 2 Abs. 1 Satz 2 WoVermRG) verletzt die Beschwerdeführer zu 1) und 2) nicht in ihrer Berufsfreiheit. Das Textformerfordernis dient dem legitimen Zweck, die Beteiligten zuverlässig über den Inhalt und die rechtlichen Folgen ihrer Erklärungen zu informieren und hiermit Rechtssicherheit und Rechtsklarheit zu fördern. Zur Erreichung dieses Zwecks ist die Textform nicht nur geeignet und erforderlich, sondern auch angemessen. Die textliche Dokumentation verdeutlicht die Tatsache einer vertraglichen Verpflichtung und kann zugleich Beweisschwierigkeiten hinsichtlich des Zustandekommens wie hinsichtlich der Person des Verpflichteten entgegenwirken.
<< Neues Textfeld >>
Erfolglose Verfassungsbeschwerde gegen Bayerisches Polizeiaufgabengesetz und Bayerisches Verfassungsschutzgesetz
Pressemitteilung Nr. 38/2016 vom 5. Juli 2016
Beschluss vom 15. Juni 2016
1 BvR 2544/08
Der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zum Bundeskriminalamtgesetz vom 20. April 2016 (1 BvR 966/09, 1 BvR 1140/09) folgend hat die 3. Kammer des Ersten Senats des Bundesverfassungsgerichts mit heute veröffentlichtem Beschluss eine Verfassungsbeschwerde gegen verschiedene Befugnisse von Polizei und Verfassungsschutz nach dem Bayerischen Polizeiaufgabengesetz und dem Bayerischen Verfassungsschutzgesetz nicht zur Entscheidung angenommen. Die wesentlichen von den Beschwerdeführern aufgeworfenen Fragen sind durch das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Bundeskriminalamtgesetz geklärt. Im Übrigen ist die Verfassungsbeschwerde mangels Beschwer und gegenwärtiger Selbstbetroffenheit der Beschwerdeführer nicht zur Entscheidung anzunehmen.
Sachverhalt:
Die Verfassungsbeschwerde betrifft verschiedene Normen, die in das Bayerische Polizeiaufgabengesetz und das Bayerische Verfassungsschutzgesetz eingefügt wurden oder die hierdurch novelliert wurden.
Die Beschwerdeführer sind ehemalige und gegenwärtige Abgeordnete des Bayerischen Landtags. Sie wenden sich im Wesentlichen gegen Befugnisse von Polizei und Verfassungsschutz zum verdeckten Zugriff auf informationstechnische Systeme. Darüber hinaus bemängeln sie einen unzureichend normierten Schutz des Kernbereichs privater Lebensgestaltung.
Die Beschwerdeführer rügen eine Verletzung des Grundrechts auf Gewährleistung der Vertraulichkeit und Integrität informationstechnischer Systeme nach Art. 2 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 1 Abs. 1 GG, des Grundrechts auf Unverletzlichkeit der Wohnung nach Art. 13 Abs. 1 GG und des Art. 1 Abs. 1 GG durch die erfolgten Gesetzesänderungen.
Wesentliche Erwägungen der Kammer:
Die Verfassungsbeschwerde ist nicht zur Entscheidung anzunehmen. Soweit die angegriffenen Normen zwischenzeitlich ohne Anwendung ersatzlos gestrichen wurden oder soweit mit Blick auf die Verfassungsbeschwerde relevante Streichungen und Änderungen des Gesetzeswortlauts erfolgt sind, fehlt es an einer Beschwer der Beschwerdeführer.
Darüber hinaus ergibt sich aus der Darlegung der Beschwerdeführer keine gegenwärtige Selbstbetroffenheit durch die von ihnen gerügten Normen. Sie führen nicht aus, inwiefern der gesetzlich normierte besondere Schutz der Abgeordnetenkommunikation den Beschwerdeführern, die sich ganz wesentlich darauf berufen, aufgrund ihrer politischen Arbeit und ihrer Abgeordnetentätigkeit mit Dritten, die von der Polizei und dem Verfassungsschutz beobachtet werden, in Kontakt zu stehen, nicht genügen soll. Dies gilt sowohl für die angegriffenen Befugnisse zum Zugriff auf informationstechnische Systeme als auch für den als unzureichend gerügten Schutz des Kernbereichs privater Lebensgestaltung. Schließlich sind die wesentlichen von den Beschwerdeführern aufgeworfenen Fragen auch durch das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Bundeskriminalamtgesetz vom 20. April 2016 (1 BvR 966/09, 1 BvR 1140/09) geklärt
Newsletter Juni 2016
Liebe Mandanten und Interessenten!
Wir stellen Ihnen in unserem aktuellen Newsletter wieder neue interessante und nützliche Urteile aus verschiedenen Rechtsgebieten vor.
Über unsere Homepage www.deutsche-anwaltshotline.de erhalten Sie sofort Rechtsberatung per Telefon und per E-Mail durch selbstständige Rechtsanwälte.
Viel Vergnügen beim Lesen unseres Newsletters wünschen Ihnen die Kooperationsanwälte und die Geschäftsleitung der Deutschen Anwaltshotline!
Inhalt:
- Weiterbeschäftigung trotz Hausverbot im Büro?
- Ist ein Terrorist ein schlechter Fahrlehrer?
- Bild-Zeitung verbreitet Facebook-Bild ohne Erlaubnis
- Cannabisplätzchen auf Weihnachtsfeier: Strafbar?
- Männer verdienen mehr: Diskriminierung?
Weiterbeschäftigung trotz Hausverbot im Büro?
Nürnberg (D-AH/fk) – Bei einer fristlosen Kündigung muss es dem Arbeitgeber unzumutbar sein, den Arbeitnehmer noch
während einer Kündigungsfrist zu beschäftigen. Das ist nicht der Fall, wenn er den Gekündigten während einer solchen Frist lediglich freistellt. So urteilte das Landesarbeitsgericht Rheinland-Pfalz
(Az. 6 Sa 30/15).
Wie die telefonische Rechtsberatung der Deutschen Anwaltshotline berichtet, arbeitete eine Frau als angestellte Steuerberaterin und Buchprüferin. Ihr Arbeitgeber kündigte der 49-jährigen fristgerecht
in der Probezeit, weil er mit ihrem Arbeitstempo nicht zufrieden war. Während der Kündigungsfrist geriet die Frau mit ihrem Arbeitgeber in Streit und im Laufe der Auseinandersetzung erteilte der Chef
ihr ein Hausverbot. Sie aber weigerte sich, das Gebäude während ihrer Arbeitszeit zu verlassen und verlangte eine schriftliche Bestätigung, um nicht später wegen Arbeitsverweigerung Probleme zu
bekommen. Ihr Arbeitgeber stellte sie daraufhin mit sofortiger Wirkung frei und sicherte ihr eine Bestätigung zu. Erst dann verließ die Frau das Gebäude. Ihr Arbeitgeber kündigte ihr daraufhin
erneut, diesmal aber fristlos. Dagegen wehrte sich die Frau nun vor Gericht.
Das Landesarbeitsgericht Rheinland-Pfalz gab ihr recht. Zwar hätte die Mitarbeiterin das Büro gleich verlassen müssen. Doch müssten stets die Interessen des Arbeitgebers mit denen des Arbeitnehmers
abgewogen werden. Diese Abwägung falle hier zu Gunsten der Buchprüferin aus. „Daher ist es dem Arbeitgeber auch zuzumuten, die Mitarbeiterin auch noch bis zum Ende der Kündigungsfrist zu
beschäftigen“, erklärt Rechtsanwalt Detlef Vollmari (telefonische Rechtsberatung unter 0900/1875000-0 für 1,99 Euro pro Minute).
Mit der Freistellung zeige der Arbeitgeber , dass er durchaus in der Lage sei, das Arbeitsverhältnis auch während der Kündigungsfrist beizubehalten. Die außerordentliche Kündigung sei deshalb nicht
rechtens, so das Gericht.
Ist ein Terrorist ein schlechter Fahrlehrer?
Nürnberg (D-AH/fk) – Wer vor hat, in Syrien in den Heiligen Krieg zu ziehen, dem kann die Fahrlehrererlaubnis entzogen
werden. Denn dieses Vorhaben widerspricht der nötigen Vorbildfunktion, beschloss das Verwaltungsgericht Düsseldorf (Az. 6 L 3816/15).
Wie die telefonische Rechtsberatung der Deutschen Anwaltshotline berichtet, kündigte ein Fahrlehrer seine Stelle, weil er Deutschland für längere Zeit verlassen wollte. Der Mann war in Afghanistan
geboren und wurde 1998 eingebürgert. Er hatte vor, sich dem Kampf einer islamisch-terroristischen Organisation in Syrien anzuschließen. Bevor der Gotteskrieger in spe Deutschland gen Nahen Osten
allerdings verlassen konnte, wurden er und einer seiner Mitstreiter festgenommen. Er verbüßte eine zweijährige Haftstrafe, die nach einiger Zeit zur Bewährung ausgesetzt wurde. Dazu bekam er die
Auflage, als Fahrlehrer einem geregelten Tagesablauf nachzugehen. Zu seinem Pech entzog ihm die zuständige Behörde allerdings die Fahrlehrererlaubnis. Er sei wegen seiner Straffälligkeit als
Fahrlehrer ungeeignet. Das wollte der ertappte Extremist aber nicht hinnehmen und ging vor Gericht.
Doch das Verwaltungsgericht Düsseldorf stellte sich auf die Seite der Behörde. Durch seine Nähe zur islamistischen Szene sei der Mann als Fahrlehrer ungeeignet. „Ein Fahrlehrer hat nämlich auch eine
allgemeine Vorbildfunktion“, erklärt Rechtsanwalt Tim Vlachos (telefonische Rechtsberatung unter 0900/1875000-0 für 1,99 Euro pro Minute). Und die meist jugendlichen Führerscheinanwärter seien in
ihrem Alter noch leicht zu beeinflussen.
Es sei für die Allgemeinheit und nicht zuletzt für die Fahrschüler selbst gefährlich, verfassungsfeindlichen Ansichten ausgesetzt zu sein, ohne sich diesen entziehen zu können. Es liegt zunächst an
dem Mann selbst, zu beweisen, dass er mit der islamistischen Szene nichts mehr zu tun hat.
Bild-Zeitung verbreitet Facebook-Bild ohne Erlaubnis
Nürnberg (D-AH/fk) – Wer bei Facebook ein Bild von sich hochlädt, der erteilt nicht automatisch eine Erlaubnis, es
außerhalb davon zu verbreiten. So urteilte das Oberlandesgericht München (Az. 29 U 368/16).
Wie die telefonische Rechtsberatung der Deutschen Anwaltshotline berichtet, war eine Frau mit der Flüchtlingspolitik in Deutschland unzufrieden und machte ihrem Ärger auf Facebook Luft. Sie
bezeichnete Flüchtlinge als „Tiere“, die nur zum „gut gefüllten Futternapf“ rennen würden. Die Bild-Zeitung fasste in ihrem Online-Auftritt mehrere solcher Kommentare zusammen unter dem Titel: „Hass
auf Flüchtlinge – Bild stellt die Hetzer an den Pranger“. Darunter befand sich auch besagter Beitrag sowie erkennbar Profilbild und Name der “Hetzerin“. Das wollte sie sich nicht gefallen lassen und
forderte die Zeitung auf, beides unkenntlich zu machen. Die Zeitung weigerte sich und der Fall ging vor Gericht.
Das Oberlandesgericht München gab der Frau recht und kassierte damit das Urteil der Vorinstanz. Zwar hatte die Frau ihr Profilbild öffentlich einsehbar auf Facebook hochgeladen. Das gebe Dritten aber
nicht das Recht, dieses auch zu verbreiten. „Denn dazu wäre eine ausdrückliche oder stillschweigende Genehmigung erforderlich“, erklärt Rechtsanwalt Karl-Heinz Lehmann (telefonische Rechtsberatung
unter 0900/1875000-0 für 1,99 Euro pro Minute). Doch weder hatte die Frau ihr ausdrückliches Einverständnis gegeben, noch waren ihr Zweck, Art und Umfang der Verwendung des Bildes bekannt. Das
schließe eine stillschweigende Genehmigung aus.
Die Bild-Zeitung verletze die Frau zudem in ihren Persönlichkeitsrechten. Das Blatt dürfe zwar in seiner Rolle als Massenmedium die Stimmung innerhalb der Bevölkerung einfangen – auch durch
Facebook-Posts. Aber es gebe keinen Grund, warum dies mit identifizierbarem Bild und Namen geschehen müsse, urteilte das Gericht.
Cannabisplätzchen auf Weihnachtsfeier: Strafbar?
Nürnberg (D-AH/fk) – Wer auf einer Weihnachtsfeier den Gästen Cannabis-Plätzchen serviert, macht sich nicht strafbar.
Das beschloss das Oberlandesgericht Zweibrücken (Az. 1 OLG 1 Ss 2/16).
Wie die telefonische Rechtsberatung der Deutschen Anwaltshotline berichtet, ist Weihnachten das Fest der Liebe. Aus diesem Grund lud eine Mutter aus Rheinland-Pfalz ihre Familie an Heiligabend zu
einem Weihnachtsfest. Einer der Söhne brachte selbst gebackene Cannabis-Plätzchen mit, um die „traditionell schlechte Stimmung“ auf der Feier aufzupeppen, wie er selbst erklärte. Die Familie griff
freudig zu – darunter auch seine minderjährigen Brüder. Einer der volljährigen Gäste erlitt daraufhin aber Schweißausbrüche, begann zu zittern und verlor zunehmend Farbe im Gesicht.
Das Amtsgericht Rockenhausen verurteilte den Hobbybäcker wegen vorsätzlicher Körperverletzung zu sechs Monaten Freiheitsstrafe auf Bewährung. Dagegen ging der Mann nun in Revision.
Das Oberlandesgericht Zweibrücken stellte sich aber auf die Seite des Mannes und hob das Urteil der Vorinstanz auf. Es handle sich nicht um vorsätzliche Körperverletzung, da der Bäcker nur
geringfügige Wirkung in Kauf nahm. „Körperliche Beschwerden der Gäste hatte er nicht beabsichtigt und nahm sie bei so geringen Mengen auch nicht vorsätzlich in Kauf“, erklärt Rechtsanwalt Frank
Böckhaus (telefonische Rechtsberatung unter 0900/1875000-0 für 1,99 Euro pro Minute).
Auch, dass seine minderjährigen Brüder von den Keksen kosteten, sei nicht strafbar. Der Plätzchenbäcker hat den Brüdern die Drogen nicht zur freien Verfügung gegeben, sondern nur in geringen Mengen
zum Verzehr. Das sei strafrechtlich nicht relevant, so das Gericht. Über den Drogenbesitz an sich und fahrlässige Körperlverletzung wird aber noch zu sprechen sein.
Männer verdienen mehr: Diskriminierung?
Nürnberg (D-AH/fk) – Verdient eine Angestellte aufgrund ihres Geschlechts für dieselbe Arbeit weniger als ihre männliche
Kollegen, so hat sie Anspruch auf eine Entschädigung. So urteilte das Landesarbeitsgericht Rheinland-Pfalz (Az. 4 Sa 12/14).
Wie die telefonische Rechtsberatung der Deutschen Anwaltshotline berichtet, arbeitete eine 56-jährige Mitarbeiterin in der Produktion einer Schuhfabrik. Bei einer Betriebsversammlung kam ans Licht,
dass die angestellten Frauen für die gleiche Arbeit weniger verdienten. Über einen Zeitraum von drei Jahren häufte sich so eine Differenz von durchschnittlich 11.000 Euro an. Damit war die
Angestellte nicht einverstanden. Sie wollte von der Firma die Differenz erstattet bekommen und dazu noch eine Entschädigung erhalten.
Ihr Arbeitgeber sah die Sache aber anders. Es sei betriebsintern stets offen kommuniziert worden, dass weibliche Arbeiterinnen weniger Geld erhalten. Das soll nicht ganz so schlimm sein wie eine
heimliche Diskriminierung. Der Fall ging schließlich vor Gericht.
Das Landesarbeitsgericht Rheinland-Pfalz gab der Angestellten recht und bestätigte auch das Urteil der Vorinstanz. Dabei bezifferte das Gericht die Entschädigung auf 6.000 Euro – wegen der langen und
schweren Ungleichbehandlung. Es liege auf der Hand, dass der einzige Grund für den Verdienstunterschied das Geschlecht ist. „Dabei handelt es sich um eine offensichtliche Diskriminierung der
angestellten Frauen“, erklärt Rechtsanwältin Christina Bethke (telefonische Rechtsberatung unter 0900/1875000-0 für 1,99 Euro pro Minute). Der Betrieb muss der Angestellten also den Differenzbetrag
erstatten. Dass der unterschiedliche Lohn angeblich offen kommuniziert wurde, entlaste den Arbeitgeber dabei nicht, so das Gericht.
Informationen für Mitglieder der Deutschen Anwaltshotline:
Auf der Seite www.jura-ticker.de stellt die Deutsche Anwaltshotline Ihnen kostenlos einen dynamischen Ticker mit täglich wechselnden Rechtsnachrichten zur Verfügung. Sie können diesen von uns entwickelten Ticker in Ihre eigene Homepage einbinden und so den Besuchern Ihrer Website einen neuen und informativen Service bieten.
Alle juristisch interessierten Leser können auch auf der Jura-Ticker-Homepage täglich aktualisierte Rechtsmeldungen studieren.
Als Abonnent unseres Newsletters haben Sie übrigens auch kostenlosen Zugang zum Mitgliederbereich. Sie können dort kostenlos eine Auswahl an anwaltlich geprüften Verträgen und Dokumenten downloaden, z.B. Kfz-Kaufvertrag, Arbeitsvertrag, Patientenverfügung, usw. Sie erhalten dort auch kostenlos Zugriff auf hilfreiche Broschüren, wie etwa zum Thema „Grillen – was ist erlaubt?“ oder „Hartz IV – Alles was wichtig ist“.
Besuchen Sie unseren Mitgliederbereich unter http://www.deutsche-anwaltshotline.de/allgemein/mitglieder/index.php mit folgenden Zugangsdaten (Gross- und Kleinschreibung beachten):
Benutzer: Deutsche-Anwaltshotline
Passwort:
rechtlich
Den Mitgliederbereich erreichen Sie auch über den Menüpunkt "für Mitglieder" auf unserer Homepage.
Für alle persönlichen Rechtsfragen stehen Ihnen selbstständige Anwälte über die Deutschen Anwaltshotline von Montag bis Sonntag von 7:00 Uhr morgens - 01:00 nachts Uhr zur Verfügung.
Rufnummer Rechtsberatung: 0900-1-875 000-10 (1,99 Eur/Min*)
*inklusive 19 % Mehrwertsteuer aus dem Festnetz der Deutschen Telekom; ggf. abweichende Preise aus Mobilfunknetzen.
Unter www.deutsche-anwaltshotline.de können Sie auch die direkten Durchwahlen zu über 50 Rechtsgebieten abfragen.
Impressum:
Deutsche Anwaltshotline AG, Am Plärrer 7, 90443 Nürnberg Tel.: +49 911 / 376569-0, Fax: +49 911 / 376569-99
Register und Registernummer: Amtsgericht Nürnberg HRB 24658
Umsatzsteuer-ID: DE261181671
vertreten durch: Johannes Goth, Volker Schwengler, Christian Ulshöfer
Aufsichtsrat: Hartmut Dicke (Vorsitzender), Alexander Keller, Reinhold Gleichmann
Verantwortlicher für journalistisch-redaktionelle Inhalte gem. § 55 II RstV: Engin Aydin, Manuel Christa
Erfolgreiche Verfassungsbeschwerde gegen die Versagung der nachträglichen Einrichtung einer Begräbnisstätte in einer Kirche
Pressemitteilung Nr. 33/2016 vom 17. Juni 2016
Beschluss vom 09. Mai 2016
1 BvR 2202/13
Das Gewicht einer religiösen Verhaltensvorgabe ist eine genuin religiöse Frage, die der selbständigen Beurteilung durch die staatlichen Gerichte entzogen ist. Dies hat die 2. Kammer des Ersten Senats des Bundesverfassungsgerichts mit heute veröffentlichtem Beschluss bekräftigt und ein Urteil des Verwaltungsgerichtshofs Baden-Württemberg aufgehoben, mit dem einer Glaubensgemeinschaft die Einrichtung einer Begräbnisstätte für Gemeindepriester in ihrer Kirche versagt worden war. Bei der Anwendung der Ausnahme- und Befreiungsvorschriften des Baugesetzbuchs und der Auslegung der darin enthaltenen unbestimmten Rechtsbegriffe hat der Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg die Glaubens- und Bekenntnisfreiheit (Art. 4 Abs. 1 und 2 GG) nicht hinreichend berücksichtigt. Insbesondere kann der von der Beschwerdeführerin angeführten Glaubensregel der zwingende Charakter nicht ohne Inanspruchnahme sachverständiger Hilfe abgesprochen werden.
Sachverhalt:
Die Beschwerdeführerin ist eine vereinsrechtlich organisierte Glaubensgemeinschaft und gehört der Erzdiözese der Syrisch-Orthodoxen Kirche von Antiochien in Deutschland an. Im Jahr 1994 errichtete sie auf einem Grundstück in einem Industriegebiet ein Kirchengebäude. Im Jahr 2005 beantragte die Beschwerdeführerin die Genehmigung zur Umnutzung eines Lagerraums im Untergeschoss des Kirchengebäudes in eine Krypta mit zehn Begräbnisplätzen, was von den zuständigen Behörden abgelehnt wurde.
Das verwaltungsgerichtliche Verfahren gegen die Versagung der Genehmigung blieb ohne Erfolg. Mit ihrer Verfassungsbeschwerde rügt die Beschwerdeführerin im Wesentlichen eine Verletzung ihrer Grundrechte aus Art. 4 Abs. 1 und 2 GG.
Wesentliche Erwägungen der Kammer:
Die Beschwerdeführerin ist in ihrem Grundrecht aus Art. 4 Abs. 1 und 2 GG verletzt. Im Ausgangsverfahren wurden die Schutzbereiche der widerstreitenden Grundrechte teilweise unrichtig bestimmt und ihrem Gewicht nach im Rahmen der Abwägung nicht hinreichend in Einklang gebracht.
1. Der einer Religionsgemeinschaft zukommende Grundrechtsschutz umfasst das Recht zu eigener weltanschaulicher oder religiöser Betätigung, zur Verkündigung des Glaubens sowie zur Pflege und Förderung des Bekenntnisses. Für die Eröffnung des Schutzbereichs der Glaubens- und Bekenntnisfreiheit kommt es nicht darauf an, welche konkrete Bedeutung dem in Rede stehenden Verhalten nach den Glaubenslehren beigemessen wird. Denn das Recht, sein gesamtes Verhalten an den Lehren seines Glaubens auszurichten und seiner inneren Glaubensüberzeugung gemäß zu handeln, betrifft nicht nur imperative Glaubenssätze, sondern auch solche religiösen Überzeugungen, die ein Verhalten als das zur Bewältigung einer Lebenslage richtige bestimmen. Ausgehend hiervon zählen auch die Bestattung kirchlicher Würdenträger nach bestimmten glaubensgeleiteten Riten und die dementsprechende Totensorge zu den geschützten Betätigungen.
2. Der in der Versagung der Einrichtung einer Krypta liegende Eingriff erweist sich verfassungsrechtlich als nicht gerechtfertigt. Die Glaubensfreiheit ist nicht schrankenlos gewährleistet. Einschränkungen müssen sich jedoch aus der Verfassung selbst ergeben. Hierzu zählen die Grundrechte Dritter sowie Gemeinschaftswerte von Verfassungsrang.
a) Der postmortale Achtungsanspruch scheidet als verfassungsimmanente Schranke der Glaubens- und Bekenntnisfreiheit der Beschwerdeführerin aus. Denn bei der Beantwortung der Frage, ob eine Beeinträchtigung vorliegt, ist dem - gegebenenfalls auch nur mutmaßlichen - Willen des Verstorbenen hinlängliches Gewicht beizumessen. Dessen personale Würde kann seinem freiwilligen und eigenverantwortlichen Handeln - jedenfalls außerhalb des Kernbereichs - nicht entgegengehalten werden, weil andernfalls die Menschenwürdegarantie zu einer staatlichen Eingriffsermächtigung verkehrt würde. Aufgrund der konkreten Umstände wird hier anzunehmen sein, dass Geistliche im Dienste der Beschwerdeführerin ihre personale Würde gerade im untrennbaren Zusammenhang mit den ihrem Glauben zugrunde liegenden Regeln sehen.
b) Auch die Totenruhe kommt als verfassungsimmanente Schranke hier nicht in Betracht. Denn sie ist subjektiven Bestimmungskategorien gegenüber gleichermaßen offen wie der postmortale Achtungsanspruch. Folglich können Maßnahmen die Totenruhe dann nicht verletzen, wenn mit ihnen die Würde des Verstorbenen gewahrt und seinem mutmaßlichen Willen Rechnung getragen wird.
c) Ebenso wenig steht der Verwirklichung der Glaubens- und Bekenntnisfreiheit der Beschwerdeführerin das Pietätsempfinden der Hinterbliebenen oder der Allgemeinheit im Wege. Soweit infolge industriegebietstypischer Immissionen ein würdiges Totengedenken der Hinterbliebenen vereitelt zu werden droht, muss bei einem freiheitlich orientierten Verständnis Raum für eine individuelle Definition würdigen Totengedenkens bleiben. Der Staat hat sich demzufolge jedenfalls in Grenzfällen bei der Frage Zurückhaltung aufzuerlegen, welche Form von Totengedenken noch pietätvoll ist und welche nicht mehr.
d) Grundsätzlich kollisionsfähig mit der Glaubens- und Bekenntnisfreiheit der Beschwerdeführerin ist demgegenüber das Eigentumsgrundrecht (Art. 14 Abs. 1 Satz 1 GG) ebenso wie die Berufsfreiheit (Art. 12 Abs. 1 GG) der Grundstücksnachbarn.
Das Eigentumsgrundrecht umfasst auch das Recht, die benachbarten Produktionsanlagen umfassend zu nutzen. Auf den Fortbestand dieses Freiraums eigenverantwortlicher Lebensgestaltung im privaten und wirtschaftlichen Bereich kann der Eigentümer auch vertrauen. Eine Begrenzung der Nutzung des Grundeigentums - etwa durch von der Beschwerdeführerin initiierte oder eingeforderte Auflagen - wäre als rechtfertigungsbedürftiger Eingriff in das Eigentum zu qualifizieren.
Als Betätigungsgrenzen würden etwa zu besorgende Auflagen, die den Betriebsinhabern aufgeben, ihre Maschinen nur unter bestimmten Lärmschutzvorkehrungen oder gar nur zu bestimmten Zeiten zu betreiben, auch unmittelbar in die durch Art. 12 Abs. 1 GG geschützte Berufsausübungsfreiheit eingreifen.
3. Der danach verbleibende Grundrechtskonflikt zwischen der Glaubens- und Bekenntnisfreiheit der Beschwerdeführerin einerseits und dem Grundrecht auf Eigentum sowie der Berufsausübungsfreiheit der angrenzenden Betriebsinhaber andererseits ist unter Abwägung aller Umstände nach dem Grundsatz der praktischen Konkordanz aufzulösen. Das erfordert, dass nicht eine der widerstreitenden Rechtspositionen bevorzugt und maximal behauptet wird, sondern alle einen möglichst schonenden Ausgleich erfahren.
a) Diesen Anforderungen wird der Verwaltungsgerichtshof in seiner Entscheidung nicht gerecht. Er hat der Glaubens- und Bekenntnisfreiheit der Beschwerdeführerin nicht hinreichend Rechnung getragen. So fehlt es an Feststellungen dazu, wie die bestehende Kirche gegenwärtig im Einzelnen genutzt wird, an welchen Tagen in den umliegenden Industriebetrieben gearbeitet wird und wie sich im Hinblick darauf gerade durch die Zulassung der Krypta im Einzelnen eine zusätzliche Belastung ergeben könnte. Den Feststellungen des Verwaltungsgerichtshofs lässt sich auch nicht entnehmen, inwieweit die gewöhnliche Nutzung der geplanten Krypta - wenn überhaupt - über den reinen Gottesdienstbetrieb hinaus einen Nutzungskonflikt nennenswerten Ausmaßes begründen könnte.
Der Verwaltungsgerichtshof wird dem Gewährleistungsgehalt des Art. 4 Abs. 1 und 2 GG auch nicht gerecht, soweit er annimmt, die Glaubensregeln der Beschwerdeführerin stellten zwar einen anerkennungsfähigen Belang des Wohls der Allgemeinheit dar, geböten aber vernünftigerweise nicht die Genehmigung der Einrichtung der Krypta. Er überschreitet damit die Grenzen der - verfassungsrechtlich im Grundsatz zulässigen - gerichtlichen Plausibilitätsprüfung, wenn er der Beschwerdeführerin einen - für sie - zwingenden Charakter des Gebots einer „Hauskirchenbestattung“ für Priester abspricht. Bei der Frage, welchen Grad an Bedeutung eine Glaubensgemeinschaft einer Glaubensregel zumisst, handelt es sich zunächst um eine genuin religiöse, die als solche der selbständigen Beurteilung durch die staatlichen Gerichte entzogen ist. Zum Beleg der Existenz einer zwingenden Glaubensregel genügt die substantiierte und nachvollziehbare Darlegung, dass die in Rede stehende Verhaltensweise nach gemeinsamer Glaubensüberzeugung als verpflichtend empfunden wird. Dabei ist Bezugspunkt nicht notwendigerweise die jeweilige Religion im Ganzen. Ist für die betreffende Glaubensgruppe das Bestehen verpflichtender Vorgaben dargelegt, hat sich der Staat, der ein solches religiöses Selbstverständnis nicht unberücksichtigt lassen darf, einer Bewertung dieser Glaubenserkenntnis zu enthalten. Nach diesen Maßstäben ist es nicht zulässig, der Beschwerdeführerin den zwingenden Charakter der angeführten Glaubensregel der „Hauskirchenbestattung“ für Priester ohne Inanspruchnahme sachverständiger Hilfe abzusprechen.
b) Schließlich misst der Verwaltungsgerichtshof den nachbarlichen Interessen ein überwiegendes Gewicht bei, ohne sich mit den in Betracht kommenden Möglichkeiten zur Herstellung praktischer Konkordanz zureichend auseinander zu setzen. Nicht ersichtlich ist bereits, worin konkret der graduelle Unterschied im Ausmaß der nachbarlichen Rücksichtnahmepflichten zwischen einer Kirche mit und ohne Krypta liegen soll. Soweit er nur geplante künftige Betriebserweiterungen anführt, dürfte es zudem an der hinreichend konkreten Verfestigung einer eigentumsrechtlichen Position fehlen. Des Weiteren bezieht der Verwaltungsgerichtshof eigene Abhilfemöglichkeiten der Beschwerdeführerin nicht in die Betrachtung mit ein.
Deutsche Telekom AG darf beamteten Mitarbeiter bei Tochtergesellschaft einsetzen
Pressemitteilung Nr. 32/2016 vom 8. Juni 2016
Beschluss vom 02. Mai 2016
2 BvR 1137/14
Mit heute veröffentlichtem Beschluss hat die 1. Kammer des Zweiten Senats des Bundesverfassungsgerichts die Verfassungsbeschwerde eines beamteten Beschwerdeführers gegen die dauerhafte Zuweisung einer Tätigkeit bei einer Tochtergesellschaft der Deutschen Telekom AG nicht zur Entscheidung angenommen. Die Wahrnehmung der Dienstherrnbefugnisse bei den Postnachfolgeunternehmen durch Nichtbeamte stellt keine Verletzung von Art. 33 Abs. 5 GG dar. Zudem ergibt sich aus Art. 33 Abs. 5 GG kein Anspruch des Beschwerdeführers auf eine Tätigkeit unmittelbar bei einem Postnachfolgeunternehmen. Vielmehr sind mit der Zuweisung einer Tätigkeit bei einer Tochtergesellschaft eines Postnachfolgeunternehmens die beamtenrechtlichen Statusrechte des Beschwerdeführers gewahrt.
Sachverhalt:
Der Beschwerdeführer ist Technischer Fernmeldeamtsrat bei der Deutschen Telekom AG. Im Jahr 2010 wurde ihm dauerhaft eine Tätigkeit als Senior Referent Support Voice in einer Tochtergesellschaft der Deutschen Telekom AG zugewiesen. Die Zuweisung erfolgte auf der Grundlage von § 4 Abs. 4 Satz 2 Postpersonalrechtsgesetz (PostPersRG).
Der Widerspruch des Beschwerdeführers gegen die Zuweisung blieb erfolglos. Nachdem das Verwaltungsgericht die Zuweisung auf seine Klage hin zunächst aufgehoben hatte, wies der Bayerische Verwaltungsgerichtshof die Klage im Berufungsverfahren ab. Die Beschwerde gegen die Nichtzulassung der Revision zum Bundesverwaltungsgericht blieb ohne Erfolg.
Mit seiner Verfassungsbeschwerde macht der Beschwerdeführer eine Verletzung seiner Rechte aus Art. 33 Abs. 5 GG geltend.
Wesentliche Erwägungen der Kammer:
Die Verfassungsbeschwerde ist unzulässig und zudem unbegründet.
1. Die Ausübung von Dienstherrnbefugnissen durch Nichtbeamte stellt keine Verletzung von Art. 33 Abs. 5 GG dar.
a) Die Postnachfolgeunternehmen üben im Wege der Beleihung Dienstherrnbefugnisse aus (Art. 143b Abs. 3 Satz 2 GG), was auch die Möglichkeit der Wahrnehmung der Dienstherrnbefugnisse durch Nichtbeamte als Dienstvorgesetzte beinhaltet. Dies ergibt sich insbesondere daraus, dass der Gesetzgeber im Zusammenhang mit der Einfügung von Art. 143b Abs. 3 Satz 2 GG entschieden hat, dass der Vorstand eines Postnachfolgeunternehmens, dessen Mitglieder naturgemäß keine Beamten sind, die Befugnisse der obersten Dienstbehörde sowie des obersten Dienstvorgesetzten und des obersten Vorgesetzten wahrnimmt (§ 1 Abs. 2 PostPersRG). Zudem ist zu berücksichtigen, dass die Beschäftigung von Beamten in den Postnachfolgeunternehmen vorübergehender Natur ist, da nach der Privatisierung eine Ernennung von Beamten bei den Postnachfolgeunternehmen nicht mehr möglich ist. Wären die Aktiengesellschaften gezwungen als Dienstvorgesetzte lediglich Beamte einzusetzen, könnte dies zu erheblichen organisatorischen Problemen führen, insbesondere dann, wenn keine geeigneten Beamten (mehr) zur Verfügung stünden.
b) Auch Art. 33 Abs. 5 GG gebietet keine andere Auslegung von Art. 143b Abs. 3 Satz 2 GG. Zwar sind auch bei Beamten der Postnachfolgeunternehmen die hergebrachten Grundsätze des Berufsbeamtentums zu berücksichtigen. Hierbei handelt es sich um einen Kernbestand von Strukturprinzipien, der allerdings die Ausübung von Dienstherrnbefugnissen allein durch beamtete Dienstvorgesetzte nicht (mehr) umfasst. Auch wenn Dienstherrnbefugnisse im klassischen hierarchischen Behördenaufbau grundsätzlich von anderen Beamten als Dienstvorgesetzten ausgeübt werden, handelt es sich bei einer abweichenden Regelung für die Postnachfolgeunternehmen auf Verfassungsebene zumindest um eine zulässige Fortentwicklung des Beamtenrechts. Die Strukturentscheidung des Art. 33 Abs. 5 GG belässt ausreichend Raum, die geschichtlich gewachsene Institution in den Rahmen des heutigen Staatslebens einzufügen und den Funktionen anzupassen. Veränderungen verstoßen nur dann gegen Art. 33 Abs. 5 GG, wenn Grundsätze angetastet werden, die nicht hinweggedacht werden können, ohne dass damit zugleich die Einrichtung selbst verändert würde.
c) Schließlich folgt auch nicht aus Art. 33 Abs. 4 GG, dass Dienstherrnbefugnisse gegenüber Beamten nur durch andere Beamte ausgeübt werden können. Die aus Art. 33 Abs. 4 GG erwachsene Verpflichtung, die ständige Ausübung hoheitsrechtlicher Befugnisse in der Regel Angehörigen des öffentlichen Dienstes, die in einem öffentlich-rechtlichen Dienst- und Treueverhältnis stehen, zu übertragen, wird für die Ausübung von Dienstherrnbefugnissen im Bereich der Postnachfolgeunternehmen beschränkt (Art. 143b Abs. 3 Satz 2 GG).
2. Die Zuweisung eines abstrakten und konkreten Aufgabenbereichs bei einer Tochterfirma eines Postnachfolgeunternehmens stellt keine Verletzung von Art. 33 Abs. 5 GG oder Art. 143b Abs. 3 Satz 1 GG dar. Aus Art. 33 Abs. 5 GG ergibt sich kein Anspruch des Beschwerdeführers darauf, dass ihm ein abstrakt-funktionelles Amt oder ein abstrakter Aufgabenbereich unmittelbar bei einem Postnachfolgeunternehmen oder einer Behörde des Bundes verliehen wird.
a) Bei den privatrechtlich organisierten Postnachfolgeunternehmen gibt es mangels hoheitlicher Aufgaben keine Ämterstruktur. Den Beamten der Postnachfolgeunternehmen können daher keine Ämter im funktionellen Sinne zugewiesen werden. An die Stelle von abstrakt-funktionellen und konkret-funktionellen Ämtern treten bei den Postnachfolgeunternehmen und ihren Tochter- und Enkelunternehmen abstrakte und konkrete Aufgabenbereiche. Dies ist mit den Vorgaben von Art. 33 Abs. 5 GG und Art. 143b Abs. 3 Satz 1 GG vereinbar, da damit in ausreichender Weise der Anspruch auf eine amtsangemessene Beschäftigung gewahrt werden kann.
b) Der Beschwerdeführer wird auch nicht dadurch in seinen Grundrechten verletzt, dass ihm eine Tätigkeit bei einer Tochtergesellschaft der Deutschen Telekom AG und nicht bei einem Postnachfolgeunternehmen direkt zugewiesen worden ist. Die Möglichkeit der dauerhaften Zuweisung von Tätigkeiten bei Tochterunternehmen der Postnachfolgeunternehmen und damit eine vollständige Eingliederung in diese Unternehmen ist mit Art. 33 Abs. 5 GG und Art. 143b Abs. 3 Satz 1 GG vereinbar.
Insofern enthält die Privatisierungsentscheidung eine Verpflichtung sowohl der Postnachfolgeunternehmen als auch des Gesetzgebers, eine Weiterentwicklung der Strukturen der Postnachfolgeunternehmen und eine Anpassung der Unternehmen an die Anforderungen des Wettbewerbs zu fördern. Art. 143b Abs. 3 Satz 1 GG kommt dabei die Aufgabe zu, im Rahmen dieses Prozesses der Privatisierung zwischen den Anforderungen an die Postnachfolgeunternehmen und den Interessen der Beamten an der Bewahrung ihres erworbenen beamtenrechtlichen Status einen Ausgleich zu schaffen. Dabei ist den Postnachfolgeunternehmen für ihren Auftrag auch organisatorisch so weit wie möglich unternehmerische Freiheit einzuräumen. Es entspricht daher der Zielsetzung von Art. 143b Abs. 3 Satz 1 GG, einen flexiblen Einsatz der Beamten unter Wahrung ihrer Statusrechte zu ermöglichen. Vor diesem Hintergrund ist nicht ersichtlich, dass die in Art. 143b Abs. 3 Satz 1 GG garantierte Weiterbeschäftigung der Beamten nur durch die unmittelbaren Postnachfolgeunternehmen erfolgen kann. Vielmehr schließt Art. 143b Abs. 3 Satz 1 GG die Möglichkeit ein, dass der Weiterbeschäftigungsgarantie durch die Übertragung einer amtsangemessenen Beschäftigung bei Tochtergesellschaften der Postnachfolgeunternehmen nachgekommen wird.
Die Beamten der ehemaligen Deutschen Bundespost werden durch diese Maßnahme auch nicht in ihren garantierten Rechten unangemessen benachteiligt. Sie bleiben weiterhin Beamte des Bundes. Ihre Statusrechte werden nicht berührt. Die Postnachfolgeunternehmen haben allerdings dafür zu sorgen, dass sie wirksam die Einhaltung der beamtenrechtlichen Erfordernisse, insbesondere den Anspruch auf eine amtsangemessene Beschäftigung durch die Tochterunternehmen, sicherstellen können.
Aus Art. 143b Abs. 3 Satz 1 GG ergibt sich auch nicht die Verpflichtung, den Beamten, dem eine Tätigkeit bei einer Tochtergesellschaft zugewiesen worden ist, über einen unmittelbar bei den Postnachfolgeunternehmen angesiedelten abstrakten Aufgabenbereich an die Muttergesellschaft anzubinden. Die notwendige Anbindung an die mit Dienstherrnbefugnissen ausgestatteten Muttergesellschaften erfolgt über deren Mehrheitsbeteiligung an den Tochtergesellschaften.
Unzulässige Richtervorlage zur Verfassungswidrigkeit von Arbeitslosengeld II-Sanktionen
Pressemitteilung Nr. 31/2016 vom 2. Juni 2016
Beschluss vom 06. Mai 2016
1 BvL 7/15
Mit heute veröffentlichtem Beschluss hat die 3. Kammer des Ersten Senats des Bundesverfassungsgerichts die Unzulässigkeit einer Richtervorlage des Sozialgerichts Gotha festgestellt. Das Verfahren der konkreten Normenkontrolle betrifft die Minderung von Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts aufgrund von Pflichtverletzungen der leistungsberechtigten Person. Das Vorlagegericht war der Auffassung, dass die Sanktionsregelung nach dem Sozialgesetzbuch Zweites Buch (SGB II) mit Art. 1 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 20 Abs. 1, Art. 12 Abs.1 GG sowie mit Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG unvereinbar sei. Der Vorlagebeschluss entspricht jedoch nur teilweise den Begründungsanforderungen. Er wirft zwar durchaus gewichtige verfassungsrechtliche Fragen auf. Doch setzt er sich nicht hinreichend damit auseinander, ob diese auch entscheidungserheblich sind, da unklar ist, ob die Rechtsfolgenbelehrungen zu den Sanktionsbescheiden den gesetzlichen Anforderungen genügen. Wären die angegriffenen Bescheide bereits aufgrund fehlerhafter Rechtsfolgenbelehrungen rechtswidrig, käme es auf die Verfassungsgemäßheit der ihnen zugrunde liegenden Normen nicht mehr an.
Sachverhalt:
Das Jobcenter minderte dem Kläger des Ausgangsverfahrens das Arbeitslosengeld II für die Zeit vom 1. Juli bis 30. September 2014 um 30 % des Regelbedarfs und hob die Leistungsbewilligung teilweise auf. Der Kläger habe verhindert, dass ein zumutbares Beschäftigungsverhältnis als Lager- und Transportarbeiter zustande kam, obwohl er über die Rechtsfolgen einer Pflichtverletzung schriftlich belehrt worden sei.
Mit einem weiteren Bescheid minderte das Jobcenter dem Kläger wegen wiederholter Pflichtverletzung das Arbeitslosengeld II für die Zeit vom 1. Oktober bis 31. Dezember 2014 um monatlich 60 % des Regelbedarfs und hob den Bewilligungsbescheid für diesen Zeitraum teilweise auf. Der Kläger habe bei einem Arbeitgeber einen Aktivierungs- und Vermittlungsgutschein einzulösen gehabt. Das habe der Kläger trotz Belehrung über die Rechtsfolgen der Vereinbarung nicht getan.
Die gegen die Sanktionsbescheide eingelegten Widersprüche blieben erfolglos, woraufhin der Kläger Anfechtungsklage zum Sozialgericht Gotha erhob. Mit Beschluss vom 26. Mai 2015 hat dieses das Verfahren ausgesetzt und dem Bundesverfassungsgericht die Frage der Verfassungsmäßigkeit von § 31a in Verbindung mit § 31 und 31b SGB II zur Entscheidung vorgelegt.
Wesentliche Erwägungen der Kammer:
1. Die Vorlage ist unzulässig, weil sie nicht den Darlegungsanforderungen des § 80 Abs. 2 Satz 1 BVerfGG genügt. Das Gericht muss in der Begründung der Vorlage insbesondere hinreichend deutlich machen, dass und aus welchen Gründen es im Falle der Gültigkeit der in Frage gestellten Normen zu einem anderen Ergebnis käme als im Falle ihrer Ungültigkeit. Für die Beurteilung der Entscheidungserheblichkeit ist grundsätzlich die Rechtsauffassung des vorlegenden Gerichts maßgeblich, die jedoch zumindest nachvollziehbar sein muss. Dazu gehört es, sich eingehend mit der einfachrechtlichen Rechtslage anhand der in Rechtsprechung und Literatur vertretenen Auffassungen auseinanderzusetzen und zu unterschiedlichen Auslegungsmöglichkeiten Stellung zu nehmen, soweit sie für die Entscheidungserheblichkeit maßgeblich sein können. Desgleichen muss das vorlegende Gericht unter Ausschöpfung der ihm verfügbaren prozessualen Mittel auch alle tatsächlichen Umstände aufklären, die für die Vorlage Bedeutung erlangen können. Die ungeprüfte Übernahme von Parteivorbringen reicht dafür grundsätzlich nicht aus.
2. Diesen Anforderungen wird die Vorlage nur zum Teil gerecht.
Zwar wirft der Vorlagebeschluss durchaus gewichtige verfassungsrechtliche Fragen auf. So legt das Sozialgericht seine Überzeugung von der Verfassungswidrigkeit der §§ 31 ff. SGB II hinsichtlich Art. 1 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 20 Abs. 1 GG ausführlich dar. Es fehlt jedoch an einer hinreichenden Begründung, warum die Verfassungswidrigkeit der §§ 31 ff. SGB II im Ausgangsverfahren entscheidungserheblich sein soll. Dem Vorlagebeschluss ist nicht hinreichend nachvollziehbar zu entnehmen, ob der Kläger des Ausgangsverfahrens vom Jobcenter vor Erlass der Sanktionsbescheide nach § 31 Abs. 1 Satz 1 SGB II den gesetzlichen Anforderungen entsprechend über die Rechtsfolgen einer Pflichtverletzung belehrt wurde, obwohl Ausführungen hierzu geboten sind. Fehlte es bereits an dieser Tatbestandsvoraussetzung für eine Sanktion, wären die angegriffenen Bescheide rechtswidrig und es käme auf die Verfassungsgemäßheit der ihnen zugrunde liegenden Normen nicht mehr an.
Hinsichtlich des ersten Sanktionsbescheids trifft das vorlegende Gericht keine eigenen Feststellungen zu einer der sanktionierten Pflichtverletzung vorausgegangenen Rechtsfolgenbelehrung. Weder anhand der Vorlage selbst noch anhand des in Bezug genommenen Widerspruchbescheides lässt sich feststellen, welchen Inhalt die Rechtsfolgenbelehrung hatte und ob sie den fachrechtlich differenzierten und strengen Anforderungen genügt. Auch im Hinblick auf den zweiten Sanktionsbescheid ist nicht erkennbar, ob dem damit sanktionierten Verstoß eine ordnungsgemäße Rechtsfolgenbelehrung vorausging. Die Richtigkeit und Verständlichkeit der dem Eingliederungsverwaltungsakt beigefügten Belehrung können jedenfalls in Zweifel gezogen werden, da sie über die Minderung in Höhe von 30 % bei erstmaligem Verstoß nur informiert und auf die Folgen eines wiederholten Verstoßes nur „vorsorglich“ hinweist. Ausführungen zum Vorliegen einer ordnungsgemäßen Rechtsfolgenbelehrung liegen auch nahe, weil die Fehleranfälligkeit von Rechtsfolgenbelehrungen der Fachöffentlichkeit bekannt ist. Darauf hat der Gesetzgeber im Jahr 2011 mit einer Ergänzung von § 31 Abs. 1 Satz 1 SGB II reagiert; das vorlegende Gericht hat jedoch auch zu dieser Tatbestandsalternative keinerlei Ausführungen gemacht.
<< Neues Textfeld >>
Die Verwendung von Samples zur künstlerischen Gestaltung kann einen Eingriff in Urheber- und Leistungsschutzrechte rechtfertigen
Pressemitteilung Nr. 29/2016 vom 31. Mai 2016
Urteil vom 31. Mai 2016
1 BvR 1585/13
Steht der künstlerischen Entfaltungsfreiheit ein Eingriff in das Tonträgerherstellerrecht gegenüber, der die Verwertungsmöglichkeiten nur geringfügig beschränkt, können die Verwertungsinteressen des Tonträgerherstellers zugunsten der Freiheit der künstlerischen Auseinandersetzung zurückzutreten haben. Dies hat der Erste Senat des Bundesverfassungsgerichts mit heute verkündetem Urteil entschieden. Er hat damit einer Verfassungsbeschwerde stattgegeben, die sich gegen die fachgerichtliche Feststellung wendete, dass die Übernahme einer zweisekündigen Rhythmussequenz aus der Tonspur des Musikstücks „Metall auf Metall“ der Band „Kraftwerk“ in den Titel „Nur mir“ im Wege des sogenannten Sampling einen Eingriff in das Tonträgerherstellerrecht darstelle, der nicht durch das Recht auf freie Benutzung (§ 24 Abs. 1 UrhG) gerechtfertigt sei. Das vom Bundesgerichtshof für die Anwendbarkeit des § 24 Abs. 1 UrhG auf Eingriffe in das Tonträgerherstellerrecht eingeführte zusätzliche Kriterium der fehlenden gleichwertigen Nachspielbarkeit der übernommenen Sequenz ist nicht geeignet, einen verhältnismäßigen Ausgleich zwischen dem Interesse an einer ungehinderten künstlerischen Fortentwicklung und den Eigentumsinteressen der Tonträgerproduzenten herzustellen.
Sachverhalt:
Die Verfassungsbeschwerde betrifft die Frage, inwieweit sich Musikschaffende bei der Übernahme von Ausschnitten aus fremden Tonträgern im Wege des sogenannten Sampling gegenüber leistungsschutzrechtlichen Ansprüchen der Tonträgerhersteller auf die Kunstfreiheit berufen können.
Auf die Pressemitteilung Nr. 77/2015 vom 28. Oktober 2015 wird ergänzend verwiesen.
Wesentliche Erwägungen des Senats:
Die angegriffenen Entscheidungen verletzen drei der insgesamt zwölf Beschwerdeführer in ihrer Freiheit der künstlerischen Betätigung (Art. 5 Abs. 3 Satz 1 GG).
1. Die den angegriffenen Urteilen zugrunde gelegten gesetzlichen Vorschriften über das Tonträgerherstellerrecht (§ 85 Abs. 1 Satz 1 UrhG) und das Recht auf freie Benutzung (§ 24 Abs. 1 UrhG) sind mit der Kunstfreiheit aus Art. 5 Abs. 3 Satz 1 GG und dem Eigentumsschutz aus Art. 14 Abs. 1 GG vereinbar. Sie geben den mit ihrer Auslegung und Anwendung betrauten Gerichten hinreichende Spielräume, um zu einer der Verfassung entsprechenden Zuordnung der künstlerischen Betätigungsfreiheit einerseits und des eigentumsrechtlichen Schutzes des Tonträgerherstellers andererseits zu gelangen. Die grundsätzliche Anerkennung eines Leistungsschutzrechts zugunsten des Tonträgerherstellers, das den Schutz seiner wirtschaftlichen, organisatorischen und technischen Leistung zum Gegenstand hat, ist auch mit Blick auf die Beschränkung der künstlerischen Betätigungsfreiheit verfassungsrechtlich unbedenklich. Umgekehrt führt allein die Möglichkeit von Künstlerinnen und Künstlern, sich unter näher bestimmten Umständen auf ein Recht auf freie Benutzung von Tonträgern zu berufen, nicht schon grundsätzlich zu einer unverhältnismäßigen Beschränkung des durch Art. 14 Abs. 1 GG geschützten Kerns des Tonträgerherstellerrechts.
Mit den Anforderungen des Art. 14 Abs. 1 GG vereinbar ist auch, dass § 24 Abs. 1 UrhG durch den Verzicht auf eine entsprechende Vergütungsregelung auch das Verwertungsrecht der Urheber oder Tonträgerhersteller beschränkt. Die Entscheidung des Gesetzgebers, die enge Ausnahmeregelung nicht durch eine Vergütungspflicht zu ergänzen, die den Urheber oder Tonträgerhersteller an den Einnahmen teilhaben ließe, die im Rahmen der freien Benutzung seines Werks oder Tonträgers erst in Verbindung mit der schöpferischen Leistung eines anderen entstehen könnten, hält sich in den Grenzen des dem Gesetzgeber zustehenden Gestaltungsspielraums. Dem Gesetzgeber wäre es allerdings zur Stärkung der Verwertungsinteressen nicht von vornherein verwehrt, das Recht auf freie Benutzung mit einer Pflicht zur Zahlung einer angemessenen Vergütung zu verknüpfen. Hierbei könnte er der Kunstfreiheit beispielsweise durch nachlaufende, an den kommerziellen Erfolg eines neuen Werks anknüpfende Vergütungspflichten Rechnung tragen.
2. Dagegen verletzen die angegriffenen Entscheidungen die beiden Komponisten und die Musikproduktionsgesellschaft des Titels „Nur mir“ in ihrer durch Art. 5 Abs. 3 Satz 1 GG garantierten Freiheit der künstlerischen Betätigung.
a) Die Zivilgerichte haben bei der Auslegung und Anwendung des Urheberrechts die im Gesetz zum Ausdruck kommende Interessenabwägung zwischen dem Eigentumsschutz der Tonträgerhersteller und den damit konkurrierenden Grundrechtspositionen nachzuvollziehen und dabei unverhältnismäßige Grundrechtsbeschränkungen zu vermeiden. Die Schwelle eines Verstoßes gegen Verfassungsrecht, den das Bundesverfassungsgericht zu korrigieren hat, ist erst dann erreicht, wenn die Auslegung der Zivilgerichte Fehler erkennen lässt, die auch in ihrer materiellen Bedeutung für den konkreten Rechtsfall von einigem Gewicht sind.
b) Bei der rechtlichen Bewertung der Nutzung von urheberrechtlich geschützten Werken steht dem Interesse der Urheberrechtsinhaber, die Ausbeutung ihrer Werke zu fremden kommerziellen Zwecken ohne Genehmigung zu verhindern, das durch die Kunstfreiheit geschützte Interesse anderer Künstler gegenüber, ohne finanzielle Risiken oder inhaltliche Beschränkungen in einen Schaffensprozess im künstlerischen Dialog mit vorhandenen Werken treten zu können. Steht der künstlerischen Entfaltungsfreiheit ein Eingriff in die Urheberrechte gegenüber, der die Verwertungsmöglichkeiten nur geringfügig beschränkt, so können die Verwertungsinteressen der Urheberrechtsinhaber zugunsten der Freiheit der künstlerischen Auseinandersetzung zurückzutreten haben. Diese Grundsätze gelten auch für die Nutzung von nach § 85 Abs. 1 Satz 1 UrhG geschützten Tonträgern zu künstlerischen Zwecken.
c) Die Annahme des Bundesgerichtshofs, die Übernahme selbst kleinster Tonsequenzen stelle einen unzulässigen Eingriff in das Tonträgerherstellerrecht der Kläger dar, soweit der übernommene Ausschnitt gleichwertig nachspielbar sei, trägt der Kunstfreiheit nicht hinreichend Rechnung. Wenn der Musikschaffende, der unter Einsatz von Samples ein neues Werk schaffen will, nicht völlig auf die Einbeziehung des Sample in das neue Musikstück verzichten will, stellt ihn die enge Auslegung der freien Benutzung durch den Bundesgerichtshof vor die Alternative, sich entweder um eine Samplelizenzierung durch den Tonträgerhersteller zu bemühen oder das Sample selbst nachzuspielen. In beiden Fällen würden jedoch die künstlerische Betätigungsfreiheit und damit auch die kulturelle Fortentwicklung eingeschränkt.
Der Verweis auf die Lizenzierungsmöglichkeit bietet keinen gleichwertigen Schutz der künstlerischen Betätigungsfreiheit: Auf die Einräumung einer Lizenz zur Übernahme des Sample besteht kein Anspruch; sie kann von dem Tonträgerhersteller aufgrund seines Verfügungsrechts ohne Angabe von Gründen und ungeachtet der Bereitschaft zur Zahlung eines Entgelts für die Lizenzierung verweigert werden. Für die Übernahme kann der Tonträgerhersteller die Zahlung einer Lizenzgebühr verlangen, deren Höhe er frei festsetzen kann. Besonders schwierig gestaltet sich der Prozess der Rechteeinräumung bei Werken, die viele verschiedene Samples benutzen und diese collagenartig zusammenstellen. Die Existenz von Sampledatenbanken sowie von Dienstleistern, die Musikschaffende beim Sampleclearing unterstützen, beseitigen diese Schwierigkeiten nur teilweise und unzureichend.
Das eigene Nachspielen von Klängen stellt ebenfalls keinen gleichwertigen Ersatz dar. Der Einsatz von Samples ist eines der stilprägenden Elemente des Hip-Hop. Die erforderliche kunstspezifische Betrachtung verlangt, diese genrespezifischen Aspekte nicht unberücksichtigt zu lassen. Hinzu kommt, dass sich das eigene Nachspielen eines Sample als sehr aufwendig gestalten kann und die Beurteilung der gleichwertigen Nachspielbarkeit für die Kunstschaffenden zu erheblicher Unsicherheit führt.
d) Diesen Beschränkungen der künstlerischen Betätigungsfreiheit steht hier bei einer erlaubnisfreien Zulässigkeit des Sampling nur ein geringfügiger Eingriff in das Tonträgerherstellerrecht der Kläger ohne erhebliche wirtschaftliche Nachteile gegenüber. Eine Gefahr von Absatzrückgängen für die Kläger des Ausgangsverfahrens durch die Übernahme der Sequenz in die beiden streitgegenständlichen Versionen des Titels „Nur mir“ ist nicht ersichtlich. Eine solche Gefahr könnte im Einzelfall allenfalls dann entstehen, wenn das neu geschaffene Werk eine so große Nähe zu dem Tonträger mit der Originalsequenz aufwiese, dass realistischerweise davon auszugehen wäre, dass das neue Werk mit dem ursprünglichen Tonträger in Konkurrenz treten werde. Dabei sind der künstlerische und zeitliche Abstand zum Ursprungswerk, die Signifikanz der entlehnten Sequenz, die wirtschaftliche Bedeutung des Schadens für den Urheber des Ausgangswerks sowie dessen Bekanntheit einzubeziehen. Allein der Umstand, dass § 24 Abs. 1 UrhG dem Tonträgerhersteller die Möglichkeit einer Lizenzeinnahme nimmt, bewirkt ebenfalls nicht ohne weiteres - und insbesondere nicht im vorliegenden Fall - einen erheblichen wirtschaftlichen Nachteil des Tonträgerherstellers. Der Schutz kleiner und kleinster Teile durch ein Leistungsschutzrecht, das im Zeitablauf die Nutzung des kulturellen Bestandes weiter erschweren oder unmöglich machen könnte, ist jedenfalls von Verfassungs wegen nicht geboten.
e) Insoweit haben die Verwertungsinteressen der Tonträgerhersteller in der Abwägung mit den Nutzungsinteressen für eine künstlerische Betätigung zurückzutreten. Das vom Bundesgerichtshof für die Anwendbarkeit des § 24 Abs. 1 UrhG auf Eingriffe in das Tonträgerherstellerrecht eingeführte zusätzliche Kriterium der fehlenden gleichwertigen Nachspielbarkeit der übernommenen Sequenz ist nicht geeignet, einen verhältnismäßigen Ausgleich zwischen dem Interesse an einer ungehinderten künstlerischen Fortentwicklung und den Eigentumsinteressen der Tonträgerproduzenten herzustellen.
3. Der Bundesgerichtshof kann bei der erneuten Entscheidung die hinreichende Berücksichtigung der Kunstfreiheit im Rahmen einer entsprechenden Anwendung von § 24 Abs. 1 UrhG sicherstellen. Hierauf ist er aber nicht beschränkt. Eine verfassungskonforme Rechtsanwendung, die hier und in vergleichbaren Konstellationen eine Nutzung von Tonaufnahmen zu Zwecken des Sampling ohne vorherige Lizenzierung erlaubt, könnte beispielsweise auch durch eine einschränkende Auslegung von § 85 Abs. 1 Satz 1 UrhG erreicht werden. Soweit Nutzungshandlungen ab dem 22. Dezember 2002, auf welche die Urheberrechtsrichtlinie der Europäischen Union anwendbar ist, betroffen sind, hat der Bundesgerichtshof als zuständiges Fachgericht zunächst zu prüfen, inwieweit durch vorrangiges Unionsrecht noch Spielraum für die Anwendung des deutschen Rechts bleibt. Erweist sich das europäische Richtlinienrecht als abschließend, ist der Bundesgerichtshof verpflichtet, effektiven Grundrechtsschutz zu gewährleisten, indem er die Richtlinienbestimmungen mit den europäischen Grundrechten konform auslegt und bei Zweifeln über die Auslegung oder Gültigkeit der Urheberrechtsrichtlinie das Verfahren dem Gerichtshof der Europäischen Union gemäß Art. 267 AEUV vorlegt. Das Bundesverfassungsgericht überprüft, ob das Fachgericht drohende Grundrechtsverletzungen auf diese Weise abgewehrt hat und ob der unabdingbare grundrechtliche Mindeststandard des Grundgesetzes gewahrt ist.
Erfolglose Verfassungsbeschwerden gegen präventive Ingewahrsamnahmen
Pressemitteilung Nr. 30/2016 vom 1. Juni 2016
Beschluss vom 18. April 2016
2 BvR 1833/12, 2 BvR 1945/12
Mit heute veröffentlichtem Beschluss hat die 2. Kammer des Zweiten Senats des Bundesverfassungsgerichts zwei Verfassungsbeschwerden gegen präventive Ingewahrsamnahmen zur Verhinderung von Straftaten nicht zur Entscheidung angenommen. Die angegriffenen Entscheidungen des Landgerichts verletzen die Beschwerdeführer nicht in ihrem Recht auf Freiheit der Person (Art. 2 Abs. 2 Satz 2 in Verbindung mit Art. 104 Abs. 1 und 2 GG), da die zur Rechtfertigung präventiver Freiheitsentziehung gebotene strikte Beachtung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes vom Landgericht ausreichend berücksichtigt wurde. Ein anderes Ergebnis ergibt sich auch nicht unter Berücksichtigung der Wertungen der Europäischen Menschenrechtskonvention.
Sachverhalt:
Während eines Castortransports traf die Polizei am 26. November 2011 gegen 11:32 Uhr auf dem Gleisbett in der Nähe des niedersächsischen Ortes Dannenberg eine Gruppe von 30 Personen beim sogenannten „Schottern“ an. 14 Personen, darunter die Beschwerdeführer, wurden von der Polizei einer Identitätsfeststellung unterzogen, festgenommen und in die Gefangenensammelstelle verbracht. Am frühen Morgen des 27. November 2011 ordnete das Amtsgericht - nach Anhörung der Beschwerdeführer - jeweils die Ingewahrsamnahme bis zum Eintreffen des Castortransports im Verladebahnhof Dannenberg an. Am 28. November 2011 um 03:47 Uhr, nachdem der Castortransport den Verladebahnhof Dannenberg erreicht hatte, wurden die Beschwerdeführer aus dem Gewahrsam entlassen.
Die von den Beschwerdeführern zum Landgericht erhobenen Beschwerden gegen die amtsgerichtlichen Beschlüsse blieben erfolglos. Mit ihren Verfassungsbeschwerden wenden sich die Beschwerdeführer gegen die Beschlüsse des Amts- und des Landgerichts und rügen im Wesentlichen die Verletzung ihres Rechts auf Freiheit der Person (Art. 2 Abs. 2 Satz 2 in Verbindung mit Art. 104 Abs. 1 und 2 GG).
Wesentliche Erwägungen der Kammer:
Die Verfassungsbeschwerden sind nicht zur Entscheidung anzunehmen. Soweit die Beschwerdeführer die amtsgerichtlichen Beschlüsse angreifen, sind die Verfassungsbeschwerden unzulässig. Die landgerichtlichen Entscheidungen verletzen die Beschwerdeführer nicht in ihren Grundrechten auf Freiheit der Person.
1. Die Freiheit der Person ist unverletzlich (Art. 2 Abs. 2 Satz 2 GG). Diese verfassungsrechtliche Grundentscheidung kennzeichnet das Freiheitsrecht als ein besonders hohes Rechtsgut, das nur aus besonders gewichtigem Grund angetastet werden darf. Die Einschränkung dieser Freiheit ist stets der strengen Prüfung am Grundsatz der Verhältnismäßigkeit zu unterziehen. Dies gilt in besonderem Maße für präventive Eingriffe, die nicht dem Schuldausgleich dienen.
In die Freiheit der Person darf nur aufgrund eines förmlichen Gesetzes und nur unter Beachtung der darin vorgeschriebenen Formen eingegriffen werden. Für die Freiheitsentziehung fügt Art. 104 Abs. 2 GG dem Vorbehalt des Gesetzes den verfahrensrechtlichen Vorbehalt einer richterlichen Entscheidung hinzu. Die Freiheitsentziehung verlangt danach grundsätzlich eine vorherige richterliche Anordnung. Eine nachträgliche richterliche Entscheidung genügt nur, wenn der mit der Freiheitsentziehung verfolgte verfassungsrechtlich zulässige Zweck nicht erreichbar wäre. In diesen Fällen ist die richterliche Entscheidung unverzüglich nachzuholen.
2. Die Anforderungen an die Rechtfertigung von Freiheitsentziehungen werden durch die Wertungen von Art. 5 EMRK verstärkt. Demnach hat jede Person das Recht auf Freiheit und Sicherheit. Zur Rechtfertigung des präventiven Gewahrsams zur Verhinderung einer Straftat kommt nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte - anders als von einigen Fachgerichten angenommen - nur Art. 5 Abs. 1 Satz 2 b) EMRK in Betracht. Demnach ist die Freiheitsentziehung zur „Erzwingung der Erfüllung einer gesetzlichen Verpflichtung“ zulässig. Nicht ausreichend ist die allgemeine Verpflichtung, sich an Gesetze zu halten. Geht es um die Verpflichtung, keine Straftat zu begehen, muss diese Straftat bereits hinreichend bestimmt sein und der Betroffene muss sich unwillig gezeigt haben, sie zu unterlassen. Diesen Anforderungen ist genügt, wenn Ort und Zeit der bevorstehenden Tatbegehung sowie das potentielle Opfer hinreichend konkretisiert sind und der Betroffene, nachdem er auf die konkret zu unterlassende Handlung hingewiesen worden ist, eindeutige und aktive Schritte unternommen hat, die darauf hindeuten, dass er der konkretisierten Verpflichtung nicht nachkommen wird.
3. Ungeachtet des hohen Ranges des Freiheitsgrundrechts ist die Auslegung von Inhalt und Reichweite eines freiheitsbeschränkenden Gesetzes und seiner Formvorschriften in erster Linie Aufgabe der Fachgerichte. Das Bundesverfassungsgericht kann erst korrigierend eingreifen, wenn das fachgerichtliche Auslegungsergebnis über die vom Grundgesetz gezogenen Grenzen hinausgreift.
Die Einschätzung des Landgerichts, die angeordnete Ingewahrsamnahme der Beschwerdeführer sei unerlässlich gewesen, um die mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit in allernächster Zeit bevorstehende Begehung einer Straftat zu verhindern, wird der zur Rechtfertigung präventiver Freiheitsentziehungen gebotenen strikten Beachtung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes angesichts der festgestellten Gesamtumstände jedenfalls noch gerecht. Die Beschwerdeführer hatten sich bereits der Begehung eines gleichartigen Delikts hinreichend verdächtig gemacht. Die Störung des Castortransports durch die Begehung von Straftaten war ihnen sowohl im Zeitpunkt der Ingewahrsamnahme als auch im Zeitpunkt der amtsgerichtlichen Anordnung weiter möglich. Unter diesen Umständen bedurfte keiner weiteren Prüfung, ob nicht ein milderes Mittel - etwa die Erteilung eines Platzverweises oder Aufenthaltsverbotes nach der erkennungsdienstlichen Behandlung - ausgereicht hätte, um die Beschwerdeführer von der Begehung weiterer Straftaten abzuhalten.
Auch mit den Wertungen aus Art. 5 Abs. 1 Satz 2 b) EMRK waren die Ingewahrsamnahmen der Beschwerdeführer vereinbar. Insbesondere dienten sie nicht der Durchsetzung der allgemeinen Pflicht, sich an Gesetze zu halten, sondern der spezifischen und konkreten Verpflichtung, während der Dauer des Castortransports keine weiteren Straftaten am Gleisbett zu begehen.
Erfolglose Verfassungsbeschwerde gegen ein Urteil des Hamburgischen Verfassungsgerichts zum Rechtsschutz gegen Untersuchungsausschussberichte
Pressemitteilung Nr. 27/2016 vom 25. Mai 2016
Beschluss vom 02. Mai 2016
2 BvR
1947/15
Mit heute veröffentlichtem Beschluss hat die 1. Kammer des Zweiten Senats eine Verfassungsbeschwerde von 26 Abgeordneten der Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg gegen ein Urteil des Hamburgischen Verfassungsgerichts vom 15. September 2015 nicht zur Entscheidung angenommen. Das Urteil befasste sich mit der Frage des in der Landesverfassung vorgesehenen Rechtswegausschlusses gegen Abschlussberichte von Untersuchungsausschüssen der Hamburgischen Bürgerschaft. Abgeordnete hatten die Durchführung des Verfahrens nach Rechtsstreitigkeiten im Zusammenhang mit dem Untersuchungsausschuss „Elbphilharmonie“ beantragt. Mit ihrer Verfassungsbeschwerde rügen die Beschwerdeführer eine Verletzung ihres Rechts auf den gesetzlichen Richter (Art. 101 Abs. 1 Satz 2 GG) durch Unterlassung einer Vorlage an das Bundesverfassungsgericht.
Sachverhalt:
Der in der vergangenen Legislaturperiode von der Hamburgischen Bürgerschaft eingesetzte parlamentarische Untersuchungsausschuss „Elbphilharmonie“ beabsichtigte, in seinem Abschlussbericht wertende Äußerungen unter anderem über einen Rechtsanwalt zu veröffentlichen. Dieser nahm hiergegen verwaltungsgerichtlichen Eilrechtsschutz in Anspruch. Nachdem das Verwaltungsgericht Hamburg den Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung zunächst abgelehnt hatte, untersagte das Hamburgische Oberverwaltungsgericht dem Untersuchungsausschuss im Wege einstweiliger Anordnung, in seinem Abschlussbericht eine näher bezeichnete Tatsachenbehauptung über den Rechtsanwalt aufzustellen.
Daraufhin beantragten 55 Abgeordnete der Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg im November 2014 beim Hamburgischen Verfassungsgericht die Durchführung eines Norminterpretationsverfahrens (Art. 65 Abs. 3 Nr. 1 der Hamburgischen Verfassung). Ziel dieses Norminterpretationsverfahrens war die verbindliche Klärung der Auslegung von Art. 26 Abs. 5 Satz 1 der Hamburgischen Verfassung, nach dessen Wortlaut die Beschlüsse der Untersuchungsausschüsse der richterlichen Erörterung entzogen sind. Die Hamburgische Verfassung statuiere nach Auffassung der Antragsteller insoweit – ebenso wie Art. 44 Abs. 4 Satz 1 GG – eine Ausnahme von der Rechtsschutzgarantie des Art. 19 Abs. 4 Satz 1 GG und eröffne damit einen gerichtsfreien Raum. Mit Urteil vom 15. September 2015 stellte das Hamburgische Verfassungsgericht fest, dass der Rechtsweg nach Art. 26 Abs. 5 Satz 1 der Hamburgischen Verfassung nur insoweit ausgeschlossen sei, als das Recht der Untersuchungsausschüsse auf autonome Abfassung eines Abschlussberichts nicht nach dem Grundsatz der praktischen Konkordanz durch Grundrechte oder andere Verfassungsgüter eingeschränkt werde.
Wesentliche Erwägungen der Kammer:
Die Verfassungsbeschwerde ist nicht zur Entscheidung anzunehmen. Sie ist bereits unzulässig, da sie nicht ausreichend begründet ist. Insbesondere wurde die allein gerügte Verletzung des Rechts auf den gesetzlichen Richter (Art. 101 Abs. 1 Satz 2 GG) durch eine Verletzung der Pflicht zur Vorlage an das Bundesverfassungsgericht (Art. 100 Abs. 1 GG) nicht substantiiert dargelegt.
1. Eine Vorlagepflicht an das Bundesverfassungsgericht liegt bereits deshalb nicht vor – und vermag demzufolge auch nicht verletzt zu sein –, weil der Gewährleistungsgehalt von Art. 19 Abs. 4 GG nicht entscheidungserheblich war. Das Hamburgische Verfassungsgericht hat Art. 26 Abs. 5 Satz 1 der Hamburgischen Verfassung nicht allein an Art. 19 Abs. 4 GG gemessen, sondern daneben stets auch den im Wesentlichen wortgleichen und offensichtlich auch als inhaltsgleich angesehenen Art. 61 der Hamburgischen Verfassung herangezogen. Eine Herstellung praktischer Konkordanz zwischen Vorschriften der Landesverfassung fällt jedoch in die Kompetenz des Landesverfassungsgerichts. Selbst wenn eine Einschränkung von Art. 26 Abs. 5 Satz 1 der Hamburgischen Verfassung und das vom Hamburgischen Verfassungsgericht vertretene Auslegungsergebnis nicht auch durch Art. 19 Abs. 4 GG geboten wäre, bliebe es bei der Entscheidung, die dann alleine auf die Parallelvorschrift der Landesverfassung gestützt würde. Sollte Art. 19 Abs. 4 GG einen weitergehenden Rechtsschutz gebieten als die Vorschrift des Art. 61 der Hamburgischen Verfassung, unterlägen Untersuchungsausschussberichte erst recht der (gegebenenfalls intensiveren) gerichtlichen Kontrolle.
2. Zudem mangelt es der Beschwerdebegründung auch insoweit an hinreichender Substantiierung, als das Hamburgische Verfassungsgericht zur Begründung seiner Auffassung umfangreich die vorhandene Rechtsprechung und Literatur zur Landesverfassung sowie Literatur zum Grundgesetz ausgewertet hat. Hiermit setzt sich die Verfassungsbeschwerde nicht hinreichend auseinander, wenn sie unter bloßem Verweis auf den Wortlaut und den angeblichen Willen des Landesverfassungsgebers geltend macht, die Auslegung des Hamburgischen Verfassungsgerichts sei unvertretbar und überschreite die Grenzen einer verfassungskonformen Auslegung.
3. Selbst wenn man davon ausginge, das Hamburgische Verfassungsgericht habe keine praktische Konkordanz hergestellt, sondern eine verfassungskonforme einschränkende Auslegung vorgenommen, so erscheint eine solche Auslegung vorliegend nicht unvertretbar. Hierfür spricht – neben der vom Hamburgischen Verfassungsgericht angeführten weiten Verbreitung dieser Auffassung –, dass auch das Bundesverfassungsgericht selbst Art. 44 Abs. 4 GG einschränkend ausgelegt hat. Warum die Rechtsprechung des Hamburgischen Verfassungsgerichts vor diesem Hintergrund gänzlich unvertretbar sein soll, hätte ebenfalls näherer Begründung bedurft.
4. Gegen die Annahme, das Hamburgische Verfassungsgericht sei von der Verfassungswidrigkeit des Art. 26 Abs. 5 Satz 1 der Hamburgischen Verfassung überzeugt und deswegen zur Vorlage an das Bundesverfassungsgericht verpflichtet gewesen, spricht schließlich die Wortlautgleichheit mit Art. 44 Abs. 4 Satz 1 GG. Eine Vorschrift, die sich mit einer Regelung im Grundgesetz deckt, dürfte kaum verfassungswidrig sein.
Anmerkung:
Dieses Urteil ist für die Arbeitnehmer schlichtweg eine Katastrophe und es stellt sich die Frage wer ist Schuld an diesem Rechtsurteil, die Richter des Verfassungsgerichts? Wohl nicht, denn Sie konnten nur lt. Gesetzeslage beurteilen. Schuld ist wohl eher der Gesetzesgeber, also die Regierung. Jetzt stellt sich die nächste Frage, ob dieses absichtlich so geschah, um nur den Schein des Mindestlohnes von 8,50 €/h politisch für sich zu verkaufen oder ist es das Unvermögen der Verfasser ger Gesetzesnovelle selbst? Egal wer die Schuld trägt, der Leittragende ist mal wieder der kleine Mann, die sozial schwächsten in dieser Gesellschaft, jene die am meisten unsere Unterstützung bedürfen. Fakt ist auch, dass lt. verschiedenen Studien ein Mindestlohn von 12 €/h und mehr heute schon notwendig sind, um Altersarmut zu entfliehen.
Carsten Hanke
Geblitzt? So wehren Sie sich gegen einen Bußgeldbescheid
An 7.000 Stellen wurde beim Blitzmarathon in mehreren deutschen Bundesländern vergangene Woche das Tempo kontrolliert. 72.000 Autofahrer gingen der Polizei dabei ins Netz und dürfen nun mit einem Bußgeldbescheid rechnen. Doch oft lohnt es sich, gegen den Bescheid Einspruch einzulegen.
Schon morgens um 6 Uhr startete die Polizei mit dem Blitzmarathon vergangene Woche. Bis 22 Uhr wurde in den meisten deutschen Bundesländern nach Temposündern gefahndet. Baden-Württemberg, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz, Sachsen, Mecklenburg-Vorpommern und das Saarland machten nicht mit.
Wer erwischt wurde, darf in den nächsten Wochen mit einem Bußgeldbescheid rechnen. Mindestens ist dann eine Geldstrafe fällig, oft sogar Fahrverbote plus Punkte im Flensburger Fahreignungsregister. Ab einer überschrittenen Höchstgeschwindigkeit von 21 km/h bis 30 km/h gibt’s einen Punkt in Flensburg, ab 31 km/h und mehr hagelt es sogar zwei Punkte.
Mit dem Mietwagen im Ausland geblitzt worden? Das gilt es zu beachten.
Doch vorschnell bezahlen sollten betroffene Autofahrer nicht, in vielen Fällen kann sich ein Einspruch lohnen. „Gegen Bußgeldbescheide, die neben einer hohen Geldbuße auch Punkte in Flensburg oder sogar Fahrverbot androhen, ist es stets sinnvoll Einspruch einzulegen, da ein rechtskräftig gewordener Bußgeldbescheid im Wiederholungsfall eine Erhöhung des Bußgelds oder des Fahrverbots wegen einer Voreintragung nach sich ziehen kann“, so Thomas M. Amann, Rechtsanwalt für Strafrecht und Strafverteidigung bei Anwalt.de.
Gründe für einen ungültigen Bußgeldbescheid gibt es einige, denn für die Messverfahren gelten sehr strenge Regeln. Es könnte beispielsweise sein, dass eine Verwechslung vorliegt, weil zwei Fahrzeuge gleichzeitig geblitzt wurden oder es lagen Bedienfehler der Beamten vor. Auch Fehler am Gerät, wie etwa ungenaue Abstandssensoren, die die Distanz zwischen Blitzer und Auto messen, können zu unpräzisen Angaben führen.
Einspruch einlegen – Fristen beachten
Wer mit seinem Bußgeldbescheid nicht einverstanden ist, muss innerhalb der gesetzlich vorgegebenen Frist von 14 Tagen Einspruch einlegen. Das können Betroffene selbst tun oder einen Anwalt damit beauftragen. Gute Chancen haben Betroffene, wenn das Blitzerfoto von schlechter Qualität ist und die Person am Steuer nicht erkennbar ist. „In jedem Fall empfiehlt es sich, sich nicht dazu zu äußern, ob man zum fraglichen Zeitpunkt den Wagen fuhr“, so Verkehrsstrafrechtsexperte und Rechtsanwalt Christian Demuth gegenüber der Wirtschafts Woche. Denn die Beweispflicht, wer den Wagen gesteuert habe, liege auf Seiten des Bußgeldrichters.
Bei der Überlegung eines Richters, ob das Verfahren eingestellt wird oder nicht, spielt auch immer die Vorgeschichte des Fahrers eine Rolle. Wie lange besitzt er den Führerschein, kam es in der Vergangenheit öfter zu Verkehrsdelikten und wie schaut es mit dem Punktekonto in Flensburg aus.
Oft ist es dann möglich, das Bußgeld zu verringern oder ein Fahrverbot rückgängig zu machen. „Besonders in Bußgeldverfahren, in denen nach § 25 StVG/BKatV ein mitunter existenzbedrohliches Fahrverbot droht, kann umso mehr erreicht werden, je früher ein entsprechend spezialisierter Rechtsanwalt aus dem Rechtsgebiet Strafrecht oder Verkehrsrecht eingeschaltet wird“, sagt Rechtsexperte Amann.
Fazit: Ein Anwalt kann sich in vielen Fällen lohnen. Aber der kostet natürlich auch Geld. Wer ohne Rechtsschutzversicherung anwaltliche Hilfe in Anspruch nimmt, sollte Kosten und Nutzen genau abwägen. Denn auch ein Anwalt ist keine Garantie dafür, dass ein Bußgeldbescheid zurückgenommen wird.
Das Grundgesetz enthält kein Gebot zur Schaffung spezifischer Oppositionsfraktionsrechte
Pressemitteilung Nr. 22/2016 vom 3. Mai 2016
Urteil vom 03. Mai 2016
2 BvE 4/14
Das Grundgesetz begründet weder explizit spezifische Oppositions(fraktions)rechte, noch lässt sich ein Gebot der Schaffung solcher Rechte aus dem Grundgesetz ableiten. Dies hat der Zweite Senat des Bundesverfassungsgerichts mit heute verkündetem Urteil entschieden. Zwar enthält das Grundgesetz einen durch die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts konkretisierten allgemeinen verfassungsrechtlichen Grundsatz effektiver Opposition. Dieser Grundsatz umfasst jedoch kein Gebot spezifischer Oppositionsfraktionsrechte. Unabhängig davon ist die Einführung spezifischer Oppositionsfraktionsrechte mit der Gleichheit der Abgeordneten und ihrer Zusammenschlüsse nach Art. 38 Abs. 1 Satz 2 GG unvereinbar. Einer Absenkung der grundgesetzlich vorgegebenen Quoren für die Ausübung parlamentarischer Minderheitenrechte steht die bewusste Entscheidung des Verfassungsgebers entgegen.
Sachverhalt:
Gegenstand des Organstreitverfahrens sind auf verschiedenen Normebenen angesiedelte Minderheiten- und Oppositionsrechte im Deutschen Bundestag, die von der Fraktion DIE LINKE im Deutschen Bundestag (Antragstellerin) überwiegend beschränkt auf die 18. Wahlperiode eingefordert werden. Bezüglich der Einzelheiten des Sachverhalts wird auf die Pressemitteilung Nr. 83/2015 vom 12. November 2015 verwiesen.
Wesentliche Erwägungen des Senats:
1. Die Anträge sind überwiegend zulässig.
a) Mit ihren Anträgen zu 1 und zu 2 wendet sich die Antragstellerin einerseits gegen die Ablehnung des jeweiligen Gesetzentwurfs durch den Deutschen Bundestag (Antragsgegner), andererseits gegen die Nichtzuweisung der in dem abgelehnten Gesetzentwurf enthaltenen Rechte. Da die nach inhaltlicher Befassung erfolgende Ablehnung eines Gesetzentwurfs als qualifizierte Unterlassung dem als Maßnahme zu wertenden Erlass eines Gesetzes gleichsteht, stellt sie einen zulässigen Angriffsgegenstand im Organstreitverfahren dar.
Mit ihrem Antrag zu 3 greift die Antragstellerin den Beschluss über die Einführung des § 126a GO‑BT an, welcher eine rechtserhebliche Maßnahme darstellt. Zudem begehrt sie die Zuweisung weitergehender Rechte, macht also wiederum ein qualifiziertes Unterlassen geltend.
b) Der Geltendmachung von Rechten des Deutschen Bundestags im Wege der Prozessstandschaft durch die Antragstellerin steht nicht entgegen, dass der Deutsche Bundestag zugleich Antragsgegner ist. Sinn und Zweck der Prozessstandschaft liegen darin, der Parlamentsminderheit die Befugnis zur Geltendmachung der Rechte des Bundestages auch gegen die die Bundesregierung politisch stützende Parlamentsmehrheit zu geben.
c) Der Antrag zu 2 ist unzulässig, soweit er sich auf die Änderung des Gesetzes über die Zusammenarbeit von Bundesregierung und Deutschem Bundestag in Angelegenheiten der Europäischen Union (EUZBBG), des Stabilisierungsmechanismusgesetzes (StabMechG) und einzelner Teile des ESM-Finanzierungsgesetzes (ESMFinG) bezieht.
2. Soweit die Anträge zulässig sind, sind sie unbegründet.
a) Der Antragsgegner ist nicht verpflichtet, seine Kontrollfunktion durch Einräumung der von der Antragstellerin begehrten Oppositionsrechte auf Verfassungsebene zu effektuieren.
aa) Das Grundgesetz enthält einen durch die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts konkretisierten allgemeinen verfassungsrechtlichen Grundsatz effektiver Opposition. Der verfassungsrechtliche Schutz der Opposition wurzelt im Demokratieprinzip. Aus dem Mehrheitsprinzip und den parlamentarischen Minderheitenrechten folgen der Respekt vor der Sachentscheidung der parlamentarischen Mehrheit und die Gewährleistung einer realistischen Chance der parlamentarischen Minderheit, zur Mehrheit zu werden. Dahinter steht die Idee eines offenen Wettbewerbs der unterschiedlichen politischen Kräfte, welcher namentlich voraussetzt, dass die Opposition nicht behindert wird. Demgemäß ist die Bildung und Ausübung einer organisierten politischen Opposition konstitutiv für die freiheitliche demokratische Grundordnung.
Der im Rechtsstaatsprinzip verankerte Grundsatz der Gewaltenteilung hat den Bedingungen des parlamentarischen Regierungssystems Rechnung zu tragen, wie sie durch das Grundgesetz und die politische Praxis ausgestaltet werden. Weil danach die Bildung einer stabilen Mehrheit für die Wahl einer handlungsfähigen Regierung und deren fortlaufende Unterstützung unerlässlich ist, stellen die Abgeordneten und Fraktionen, die nicht die Regierung tragen, die natürlichen Gegenspieler von Regierung und regierungstragender Mehrheit dar. Damit die Opposition ihre parlamentarische Kontrollfunktion erfüllen kann, müssen die im Grundgesetz vorgesehenen Minderheitenrechte auf Wirksamkeit hin ausgelegt werden. Es gilt der Grundsatz effektiver Opposition. Sie darf bei der Ausübung ihrer Kontrollbefugnisse nicht auf das Wohlwollen der Parlamentsmehrheit angewiesen sein. Denn die Kontrollbefugnisse sind der parlamentarischen Opposition nicht nur in ihrem eigenen Interesse, sondern in erster Linie im Interesse des demokratischen, gewaltengegliederten Staates – nämlich zur öffentlichen Kontrolle der von der Mehrheit gestützten Regierung und ihrer Exekutivorgane – in die Hand gegeben. Der Grundsatz der Gewaltenteilung im parlamentarischen Regierungssystem gewährleistet daher die praktische Ausübbarkeit der parlamentarischen Kontrolle gerade auch durch die parlamentarische Opposition.
Die zentrale Rolle der parlamentarischen Opposition bei der Ausübung der parlamentarischen Kontrollfunktion spiegelt sich auch im verfassungsrechtlichen Rechtsschutzsystem wider: Zum einen besteht ein parlamentarisches Minderheitenrecht hinsichtlich der abstrakten Normenkontrolle aus der Mitte des Bundestages. Zum anderen sind subjektive Rechtsstellungen im innerparlamentarischen Bereich über die Antragsberechtigung im Wege des Organstreitverfahrens durchsetzbar. Darüber hinaus eröffnet die Möglichkeit einer prozessstandschaftlichen Geltendmachung der Rechte des Bundestages der organisierten parlamentarischen Minderheit als dem Gegenspieler der Regierungsmehrheit ein effektives Eintreten für die parlamentarische Kontrollfunktion.
Das individuelle Recht zum – sowohl strukturellen als auch situativen – parlamentarischen Opponieren gegen die politische Linie von Regierung und regierungstragender Mehrheit gründet in der in Art. 38 Abs. 1 Satz 2 GG garantierten Freiheit und Gleichheit der Abgeordneten, die als Vertreter des ganzen Volkes an Aufträge und Weisungen nicht gebunden und nur ihrem Gewissen unterworfen sind. Diese Freiheit wird durch die nach Art. 46 GG gewährleistete Indemnität und Immunität und das Zeugnisverweigerungsrecht eines jeden Abgeordneten nach Art. 47 GG abgesichert und ist gerade für die Opposition von besonderer Bedeutung.
bb) Das Grundgesetz begründet jedoch weder explizit spezifische Oppositions(fraktions)rechte, noch lässt sich ein Gebot der Schaffung solcher Rechte aus dem Grundgesetz ableiten. Vielmehr vollzieht sich die Ausgestaltung von Rechten der parlamentarischen Opposition innerhalb der Ordnung des Grundgesetzes über die Rechte qualifizierter parlamentarischer Minderheiten. Die Qualifizierung der mit diesen besonderen Rechten ausgestatteten Minderheiten besteht in der Erreichung eines bestimmten Quorums an Mitgliedern des Bundestages. In keiner grundgesetzlichen Bestimmung wird eine bestimmte Anzahl an Fraktionen mit besonderen Rechten ausgestattet. Das Grundgesetz hat sich demnach dafür entschieden, die Ausübbarkeit parlamentarischer Minderheitenrechte nicht auf oppositionelle Akteure – wie etwa die Oppositionsfraktionen – zu beschränken, sondern die parlamentarischen Minderheitenrechte Abgeordneten, die bestimmte Quoren erfüllen, ohne Ansehung ihrer Zusammensetzung zur Verfügung zu stellen.
cc) Einer Einführung spezifischer Oppositionsfraktionsrechte steht zudem Art. 38 Abs. 1 Satz 2 GG entgegen. Allein den Oppositionsfraktionen zur Verfügung stehende Rechte stellen eine nicht zu rechtfertigende Durchbrechung des Grundsatzes der Gleichheit der Abgeordneten und ihrer Zusammenschlüsse dar. Jeder Abgeordnete ist berufen, an der Arbeit des Bundestages, seinen Verhandlungen und Entscheidungen teilzunehmen. Dies gilt namentlich für die Kontrollfunktion des Parlaments gegenüber der Regierung. Demzufolge ist auch den Abgeordneten, die strukturell die Regierung stützen, die Möglichkeit eines Opponierens im Einzelfall eröffnet. Diese Maßstäbe gelten auch für Fraktionen, deren Rechtsstellung ebenfalls in Art. 38 Abs. 1 Satz 2 GG begründet ist.
Eine Durchbrechung des Grundsatzes der Gleichheit der Abgeordneten und ihrer Zusammenschlüsse ist nur bei Vorliegen besonderer Gründe verfassungsrechtlich gerechtfertigt, die ihrerseits durch die Verfassung legitimiert und von einem Gewicht sein müssen, das der Gleichheit der Abgeordneten die Waage halten kann.
Ein durchgreifender Rechtfertigungsgrund für die in der Zuweisung spezifischer Oppositionsrechte liegende Bevorzugung der oppositionellen gegenüber den die Regierung tragenden Abgeordneten und ihrer jeweiligen Zusammenschlüsse ist vorliegend weder vorgetragen noch ersichtlich. Insbesondere vermag die faktische Kontrollzurückhaltung der strukturell die Regierung stützenden Abgeordneten ihren Ausschluss von der Wahrnehmung bestimmter Minderheitenrechte nicht zu rechtfertigen. Das Bundesverfassungsgericht hat bereits mehrfach betont, dass sich die quorengebundenen parlamentarischen Minderheitenrechte durch jede sich situativ bildende Minderheit ausüben lassen – ohne Ansehung ihrer Zusammensetzung und ihres Zustandekommens und ohne Rücksicht auf Partei- oder Fraktionszugehörigkeit der mitwirkenden Abgeordneten. Auch der Hinweis auf besondere Funktionen der parlamentarischen Opposition vermag die von der Antragstellerin begehrte Ungleichbehandlung nicht zu rechtfertigen. Durch die Einführung spezifischer Oppositionsrechte würde den die Regierung tragenden Abgeordneten signalisiert, bei der Erfüllung der parlamentarischen Kontrollfunktion von untergeordneter Bedeutung zu sein. Hierdurch würde die durch die die Regierung tragenden Abgeordneten ausgeübte interne Kontrolle der Regierung aus der Mitte des Parlaments zusätzlich geschwächt.
dd) Auch eine Absenkung der grundgesetzlichen Quoren im Wege einer – in Bezug auf die Gleichheit aller Abgeordneten neutralen – Auslegung mit Blick auf die praktische Ausübbarkeit parlamentarischer Minderheitenrechte in Zeiten, in denen die erforderlichen Quoren von der parlamentarischen Opposition nicht erreicht werden, ist nicht möglich. Aufgrund des expliziten Wortlauts der Grundgesetzbestimmungen ist der Weg für eine Auslegung im Sinne einer teleologischen Reduktion der Quoren verstellt; für Analogieschlüsse fehlt es bereits an einer analogiefähigen Norm.
Auch von einem „Verfassungswandel“ ist vorliegend nicht auszugehen. Seit der ersten Legislaturperiode bestand die Möglichkeit großer Koalitionen im Bundestag mit der Konsequenz, dass für Fraktionen, die nicht die Regierung tragen, bestimmte Quoren nicht erfüllbar sind. Diese Möglichkeit hat sich mehrfach realisiert. Die tatsächlichen Verhältnisse sind somit stabil.
Das Spannungsverhältnis zwischen den grundgesetzlichen Quoren für die Ausübung von Minderheitenrechten und dem allgemeinen verfassungsrechtlichen Grundsatz effektiver Opposition lässt sich auch nicht mit der umstrittenen Rechtsfigur verfassungswidrigen Verfassungsrechts auflösen. Das Grundgesetz kann nur als Einheit begriffen werden. Daraus folgt, dass auf der Ebene der Verfassung selbst ranghöhere und rangniedere Normen in dem Sinne, dass sie aneinander gemessen werden könnten, grundsätzlich nicht denkbar sind. Die Sonderkonstellation der Ewigkeitsklausel (Art. 79 Abs. 3 GG) ist hier nicht einschlägig. Insofern liegen bereits keine Änderungen des Grundgesetzes vor, die sich in irgendeiner Weise negativ auf die parlamentarische Opposition auswirken könnten.
Auch aus dem allgemeinen verfassungsrechtlichen Grundsatz effektiver Opposition ergibt sich keine Notwendigkeit einer Absenkung der grundgesetzlichen Quoren für die Ausübung der parlamentarischen Minderheitenrechte. Die in den Text der Verfassung aufgenommenen Quoren stellen vielmehr die vom Verfassungsgeber und vom verfassungsändernden Gesetzgeber gewollte Konkretisierung des Grundsatzes dar. Die Entstehungsgeschichte der Grundgesetzbestimmungen über an Quoren gebundene parlamentarische Minderheitenrechte lässt insbesondere keine Anhaltspunkte für eine Regelungslücke erkennen. Der Verfassungsgeber hat den Belang des Minderheitenschutzes auf der einen Seite und die Gefahr des Missbrauchs von Minderheitenrechten auf der anderen Seite erkannt und gegeneinander abgewogen. Er hat auch die Konsequenzen seiner Quorenbestimmungen gesehen und billigend in Kauf genommen.
Eine andere Bewertung ist schließlich auch nicht durch den Umstand geboten, dass der Verfassungsgeber eine Entwicklung zum Vielparteienparlament nicht in Betracht gezogen hätte. Vor dem Erfahrungs- und Erwartungshorizont des Verfassungsgebers von 1949 waren Reichs- und Bundestag gerade durch eine – bis heute nie wieder erreichte – Vielzahl an im Parlament vertretenen Parteien gekennzeichnet. Auch hat der verfassungsändernde Gesetzgeber mit dem sukzessiven Anstieg der Parteienzahl im Parlament keine andere Grundentscheidung getroffen, weder nach 1983 mit dem Anstieg von vier auf fünf noch nach 1990 mit dem Anstieg auf sechs Parteien. Die im Zuge der Einführung des Minderheitenrechts zur Subsidiaritätsklage erfolgte punktuelle Absenkung des Drittel-Quorums auf ein Viertel-Quorum für die Antragsberechtigung der abstrakten Normenkontrolle im Jahr 2008 stellt keine abweichende Grundentscheidung dar.
b) Der Antragsgegner ist ebenfalls nicht verpflichtet, seine Kontrollfunktion durch Einräumung der von der Antragstellerin begehrten Oppositionsrechte auf der Ebene des einfachen Rechts zu effektuieren.
Die grundgesetzlich konkret geregelten Quoren stehen einer verfassungsrechtlichen Pflicht im Wege, entsprechende weitergehende Oppositionsrechte lediglich einfachgesetzlich vorzusehen. Im Übrigen – dies betrifft die begehrten Änderungen einzelner Bestimmungen des ESMFinG und des Integrationsverantwortungsgesetzes – stellt die eingeforderte einfachgesetzliche Einfügung spezifischer Oppositionsrechte eine verfassungsrechtlich nicht zu rechtfertigende Beeinträchtigung der Gleichheit der Abgeordneten und ihrer Zusammenschlüsse nach Art. 38 Abs. 1 Satz 2 GG dar (vergleiche oben).
c) Der Antragsgegner ist auch nicht verpflichtet, die von der Antragstellerin begehrten Oppositionsrechte auf Ebene der Geschäftsordnung des Deutschen Bundestages einzuführen.
Soweit sich im Hinblick auf § 126a Abs. 1 Nr. 1 bis 8 GO‑BT das im Antrag zu 3 zum Ausdruck kommende Begehren mit demjenigen der Anträge zu 1 und 2 überschneidet, ist entsprechend auch der Antrag zu 3 unbegründet. Im Übrigen stellt die Erweiterung des Kreises der Berechtigten um die Oppositionsfraktionen jeweils ein spezifisches Oppositionsrecht und damit eine nicht gerechtfertigte Beeinträchtigung der Gleichheit der Fraktionen aus Art. 38 Abs. 1 Satz 2 GG dar (vergleiche oben).
Meinungsfreiheit schützt auch emotionalisierte Äußerungen
Pressemitteilung Nr. 21/2016 vom 29. April 2016
Beschluss vom 10. März 2016
1 BvR 2844/13
Die Meinungsfreiheit umfasst auch die Freiheit, ein Geschehen subjektiv und sogar emotionalisiert darzustellen, insbesondere als Erwiderung auf einen unmittelbar vorangegangenen Angriff auf die Ehre, der gleichfalls in emotionalisierender Weise erfolgt ist. Dies hat die 3. Kammer des Ersten Senats des Bundesverfassungsgerichts in einem heute veröffentlichten Beschluss entschieden. Damit gab sie der Verfassungsbeschwerde einer Beschwerdeführerin statt, die sich gegen eine zivilgerichtliche Unterlassungsverurteilung gewandt hatte.
Sachverhalt:
Der Kläger des Ausgangsverfahrens war mit der Beschwerdeführerin liiert, bis sie ihn Anfang des Jahres 2010 wegen Vergewaltigung und gefährlicher Körperverletzung anzeigte. Im darauf folgenden Strafprozess vor dem Landgericht wurde der Kläger freigesprochen, da ihm eine Straftat nicht nachgewiesen werden konnte. Am Tag des Freispruchs sowie am Tag darauf äußerten sich die Anwälte des Klägers in Fernsehsendungen über die Beschwerdeführerin. Etwa eine Woche nach der Verkündung des freisprechenden Urteils erschien zudem ein Interview mit dem Kläger, in dem er über die Beschwerdeführerin sprach. Daraufhin gab auch die Beschwerdeführerin ein Interview, das eine Woche nach der Veröffentlichung des Interviews mit dem Kläger erschien.
In der Folgezeit begehrte der Kläger von der Beschwerdeführerin die Unterlassung mehrerer Äußerungen, die sie im Rahmen dieses Interviews getätigt hatte. Das Landgericht verurteilte die Beschwerdeführerin antragsgemäß. Die Berufung zum Oberlandesgericht und die Nichtzulassungsbeschwerde zum Bundesgerichtshof blieben ohne Erfolg.
Mit der Verfassungsbeschwerde wendet sich die Beschwerdeführerin gegen alle drei Entscheidungen und rügt im Wesentlichen die Verletzung ihrer Meinungsfreiheit (Art. 5 Abs. 1 Satz 1 GG).
Wesentliche Erwägungen der Kammer:
Die angegriffenen Entscheidungen verletzen die Beschwerdeführerin in ihrer Meinungsfreiheit aus Art. 5 Abs. 1 Satz 1 GG.
1. Die Urteile des Landgerichts und des Oberlandesgerichts berühren den Schutzbereich der Meinungsfreiheit der Beschwerdeführerin. Die Einordnung der Äußerungen als Werturteile und Tatsachenbehauptungen ist verfassungsrechtlich nicht zu beanstanden. Die Tatsachenbehauptungen sind nicht erwiesen unwahr. Im Strafverfahren konnte nicht geklärt werden, ob die Angaben der Beschwerdeführerin oder die des Klägers der Wahrheit entsprechen. Nach dem Freispruch des Klägers stellen sich deshalb die verschiedenen Wahrnehmungen als subjektive Bewertungen eines nicht aufklärbaren Geschehens dar, die nicht als Tatsachenbehauptungen, sondern als Meinungen zu behandeln sind.
2. Die angegriffenen Entscheidungen verletzen die Meinungsfreiheit der Beschwerdeführerin. Die Untersagung der streitgegenständlichen Äußerungen bewegt sich nicht mehr im fachgerichtlichen Wertungsrahmen.
a) Das Grundrecht auf freie Meinungsäußerung ist als subjektive Freiheit des unmittelbaren Ausdrucks der menschlichen Persönlichkeit ein grundlegendes Menschenrecht. Sie umfasst nicht zuletzt die Freiheit, die persönliche Wahrnehmung von Ungerechtigkeiten in subjektiver Emotionalität in die Welt zu tragen. Dabei kann insbesondere bei Vorliegen eines unmittelbar vorangegangenen Angriffs auf die Ehre eine diesem Angriff entsprechende, ähnlich wirkende Erwiderung gerechtfertigt sein. Wer im öffentlichen Meinungskampf zu einem abwertenden Urteil Anlass gegeben hat, muss eine scharfe Reaktion auch dann hinnehmen, wenn sie das persönliche Ansehen mindert.
b) Die angegriffenen Entscheidungen genügen diesen verfassungsrechtlichen Maßstäben nicht. Zwar haben die Gerichte zutreffend einerseits das große Informationsinteresse der Öffentlichkeit und andererseits den Freispruch berücksichtigt, der dazu führt, dass die schweren Vorwürfe, die Gegenstand des Strafverfahrens waren, nicht unbegrenzt wiederholt werden dürfen. Auch haben sie berücksichtigt, wieweit die Äußerungen sich auf öffentliche Angelegenheiten bezogen.
Indem die Gerichte davon ausgingen, dass sich die Beschwerdeführerin auf eine sachliche Wiedergabe der wesentlichen Fakten zu beschränken habe, und hierfür auf das öffentliche Informationsinteresse abstellen, verkennen sie die durch Art. 5 Abs. 1 Satz 1 GG auch unabhängig von einem solchen Interesse geschützte Freiheit, ein Geschehen subjektiv und sogar emotionalisiert zu bewerten. Zugleich übersieht diese Sichtweise das öffentliche Interesse an einer Diskussion der Konsequenzen und Härten, die ein rechtsstaatliches Strafprozessrecht aus Sicht möglicher Opfer haben kann. Zu Gunsten der Beschwerdeführerin war in die Abwägung zudem einzustellen, dass sie sich in unmittelbarer zeitlicher Nähe zu dem (noch nicht rechtskräftigen) Freispruch äußerte und lediglich wiederholte, was der Öffentlichkeit aufgrund der umfänglichen Berichterstattung zu dem Strafverfahren bereits bekannt war. Die Gerichte haben überdies das vorangegangene Verhalten des Klägers nicht in der gebotenen Weise berücksichtigt. Der Beschwerdeführerin steht ein „Recht auf Gegenschlag“ zu und dabei ist sie nicht auf eine sachliche, am Interview des Klägers orientierte Erwiderung beschränkt, weil auch der Kläger und seine Anwälte sich nicht sachlich, sondern gleichfalls in emotionalisierender Weise äußerten. Der Kläger, der auf diese Weise an die Öffentlichkeit trat, muss eine entsprechende Reaktion der Beschwerdeführerin hinnehmen.
<< Neues Textfeld >>
Der Anordnung einer Betreuung muss eine persönliche Anhörung vorausgehen
Pressemitteilung Nr. 23/2016 vom 4. Mai 2016
Beschluss vom 23. März 2016
1 BvR
184/13
Angesichts der mit einer Betreuung verbundenen tiefen Eingriffe in das allgemeine Persönlichkeitsrecht ist eine persönliche Anhörung durch das Betreuungsgericht grundsätzlich unverzichtbar. Dies hat die 3. Kammer des Ersten Senats des Bundesverfassungsgerichts entschieden und damit die große Bedeutung der persönlichen richterlichen Anhörung im Betreuungsverfahren erneut hervorgehoben. Die Anordnung einer Betreuung ohne diese Anhörung verletzt nicht nur das Recht auf rechtliches Gehör, sondern stellt auch eine Verletzung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts aus Art. 2 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 1 Abs. 1 GG dar.
Sachverhalt:
Nachdem die Beschwerdeführerin im Dezember 2010 im Wege der einstweiligen Anordnung unter vorläufige Betreuung gestellt worden war, beantragte der Betreuer im Juni 2011 beim Amtsgericht eine Verlängerung der einstweiligen Betreuung um sechs Monate. Mit Beschluss vom selben Tag verlängerte das Amtsgericht die Betreuung, ohne die Beschwerdeführerin zuvor anzuhören. Auf erneuten Antrag des Betreuers verlängerte das Amtsgericht im August 2011 die vorläufige Betreuung bis zum 31. Oktober 2011, abermals ohne die Beschwerdeführerin vorher anzuhören. Mit Ablauf des 31. Oktober 2011 endete die einstweilige Betreuung durch Zeitablauf.
Die Beschwerdeführerin beantragte daraufhin beim Amtsgericht die Feststellung, dass der Beschluss über die Verlängerung der Betreuung aus August 2011 sie in ihren Rechten verletzt habe. Das Amtsgericht half der Beschwerde nicht ab. Das Landgericht wies die Fortsetzungsfeststellungsbeschwerde zurück, nachdem es zuvor die Beschwerdeführerin persönlich angehört hatte.
Mit ihrer Verfassungsbeschwerde rügt die Beschwerdeführerin eine Verletzung der Garantie effektiven Rechtsschutzes (Art. 19 Abs. 4 in Verbindung mit Art. 3 Abs. 1 GG) und ihres Anspruchs auf rechtliches Gehör (Art. 103 Abs. 1 GG).
Wesentliche Erwägungen der Kammer:
1. Der angegriffene Beschluss des Amtsgerichts über die Verlängerung der Betreuung verletzt die Beschwerdeführerin in ihrem allgemeinen Persönlichkeitsrecht (Art. 2 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 1 Abs. 1 GG) und in ihrem Anspruch auf rechtliches Gehör (Art. 103 Abs. 1 GG).
a) Das Recht auf freie und selbstbestimmte Entfaltung der Persönlichkeit sichert jedem Einzelnen einen autonomen Bereich privater Lebensgestaltung, in dem er seine Individualität entwickeln und wahren kann. Die Anordnung einer Betreuung beeinträchtigt dieses Recht, sich in eigenverantwortlicher Gestaltung des eigenen Schicksals frei zu entfalten, denn sie weist Dritten zumindest eine rechtliche und tatsächliche Mitverfügungsgewalt bei Entscheidungen im Leben der Betroffenen zu.
Ein solcher Eingriff ist nur gerechtfertigt, wenn das zuständige Betreuungsgericht nach angemessener Aufklärung des Sachverhalts davon ausgehen darf, dass die Voraussetzungen für die Einrichtung oder Verlängerung einer Betreuung tatsächlich gegeben sind. Zu den zentralen verfassungsrechtlichen Anforderungen gehört daher die Beachtung des Rechts auf Gehör (Art. 103 Abs. 1 GG). Angesichts der mit einer Betreuung möglicherweise verbundenen tiefen Eingriffe in das allgemeine Persönlichkeitsrecht ist eine Anhörung in Form einer persönlichen Anhörung im Angesicht der Betreffenden grundsätzlich unverzichtbar. Die persönliche Anhörung darf nur im Eilfall bei Gefahr im Verzug vorläufig unterbleiben, ist dann aber unverzüglich nachzuholen.
Aufgrund der engen Verbindung zwischen dem für das Betreuungsverfahren als Recht auf persönliche Anhörung ausgestalteten Gehörsrecht und dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht liegt in der Anordnung einer Betreuung ohne diese Anhörung nicht nur eine Verletzung des Rechts aus Art. 103 Abs. 1 GG, sondern zugleich eine Verletzung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts. Durch eine spätere Anhörung kommt eine Heilung damit nicht rückwirkend, sondern nur in Blick auf die Zukunft in Betracht.
b) Das Amtsgericht hat demgegenüber die Beschwerdeführerin zu keinem Zeitpunkt persönlich angehört. Die vorliegend angegriffene erneute Verlängerung der Betreuung wurde vielmehr ‑ ebenso wie schon zuvor die Entscheidung über die erste Verlängerung ‑ zunächst angeordnet, ohne die Beschwerdeführerin auch nur in Kenntnis zu setzen. Auch im Weiteren fehlte es an einer persönlichen Anhörung. Ein Verzicht auf eine Anhörung durch die Beschwerdeführerin kann weder tatsächlich hergeleitet werden noch ist dieser einfachrechtlich begründbar.
Die Gehörsverletzungen konnten auch nicht im Zuge des Verfahrens über die Fortsetzungsfeststellungsbeschwerde geheilt werden. Das Unterbleiben der persönlichen Anhörung begründet die Rechtswidrigkeit der Anordnung der Betreuung. Die nachträgliche Anhörung durch das Beschwerdegericht kann das Unterbleiben der Anhörung durch das Betreuungsgericht nicht rückwirkend heilen.
2. Der Beschluss des Landgerichts, der ein rechtliches Interesse an der Feststellung der Gehörsverletzung durch das Amtsgericht verneint, verletzt die Beschwerdeführerin in ihrem Anspruch auf effektiven Rechtsschutz. Art. 19 Abs. 4 GG gebietet den Rechtsmittelgerichten, ein von der jeweiligen Prozessordnung eröffnetes Rechtsmittel nicht ineffektiv zu machen. Zwar ist es mit diesem Gebot vereinbar, den Rechtsschutz davon abhängig zu machen, dass ein Rechtsschutzinteresse besteht. In Fällen tiefgreifender Grundrechtseingriffe kann das Rechtsschutzinteresse jedoch auch dann bejaht werden, wenn die direkte Belastung durch Erledigung des Hoheitsakts entfallen ist, ohne dass die betroffene Person zuvor effektiven Rechtsschutz erlangen konnte. Der Beschluss vom 3. Mai 2012, in dem das Landgericht ein Fortsetzungsfeststellungsinteresse der Beschwerdeführerin verneint, verfehlt diese Anforderungen.
Bundesverfassungsgericht
Verfassungsbeschwerden gegen die Ermittlungsbefugnisse des BKA zur Terrorismusbekämpfung teilweise erfolgreich
Pressemitteilung Nr. 19/2016 vom 20. April 2016
Urteil vom 20. April 2016 - 1 BvR 966/09, 1 BvR 1140/09
Mit heute verkündetem Urteil hat der Erste Senat des Bundesverfassungsgerichts entschieden, dass die Ermächtigung des Bundeskriminalamts zum Einsatz von heimlichen Überwachungsmaßnahmen zur Abwehr von Gefahren des internationalen Terrorismus zwar im Grundsatz mit den Grundrechten vereinbar ist, die derzeitige Ausgestaltung von Befugnissen aber in verschiedener Hinsicht dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz nicht genügt. Das führt dazu, dass verschiedene Regelungen aus dem Gesamtkomplex zu beanstanden waren. Die Entscheidung betrifft, eine lange Rechtsprechung zusammenführend, sowohl die Voraussetzungen für die Durchführung solcher Maßnahmen als auch die Frage der Übermittlung der Daten zu anderen Zwecken an dritte Behörden sowie schließlich erstmals auch die Anforderungen an eine Weiterleitung von Daten an ausländische Behörden.
Hinsichtlich der Voraussetzungen für die Durchführung sind die im Jahr 2009 eingeführten Vorschriften teilweise zu unbestimmt und zu weit; auch fehlt es zum Teil an flankierenden rechtsstaatlichen Absicherungen, insbesondere zum Schutz des Kernbereichs privater Lebensgestaltung oder zur Gewährleistung von Transparenz, individuellem Rechtsschutz und aufsichtlicher Kontrolle. Die Vorschriften zur Übermittlung von Daten sind ‑ sowohl hinsichtlich inländischer als auch hinsichtlich ausländischer Behörden ‑ an etlichen Stellen nicht hinreichend begrenzt. Da die Gründe für die Verfassungswidrigkeit nicht den Kern der eingeräumten Befugnisse betreffen, gelten die beanstandeten Vorschriften jedoch mit Einschränkungen überwiegend bis zum Ablauf des 30. Juni 2018 fort.
Die Entscheidung ist teilweise mit Gegenstimmen ergangen; die Richter Eichberger und Schluckebier haben ein Sondervotum abgegeben.
Sachverhalt:
Die Verfassungsbeschwerden richten sich gegen neue Befugnisse, die im Jahr 2009 in das Bundeskriminalamtgesetz (BKAG) eingefügt wurden. Damit hat der Bundesgesetzgeber dem Bundeskriminalamt über die bisherigen Aufgaben der Strafverfolgung hinaus die bis dahin den Ländern vorbehaltene Aufgabe der Abwehr von Gefahren des internationalen Terrorismus übertragen. Gegenstand der Verfassungsbeschwerden ist daneben eine bereits zuvor bestehende Regelung des Bundeskriminalamtgesetzes zur Übermittlung von Daten ins Ausland, die durch die Aufgabenerweiterung ein weiteres Anwendungsfeld erhält.
Auf die Pressemitteilung Nr. 43/2015 vom 16. Juni 2015 wird ergänzend verwiesen.
Wesentliche Erwägungen des Senats:
1. Die angegriffenen Befugnisse ermächtigen das Bundeskriminalamt im Rahmen der Gefahrenabwehr und Straftatenverhütung zur heimlichen Erhebung personenbezogener Daten und begründen - je nach Befugnis - Eingriffe in die Grundrechte der Unverletzlichkeit der Wohnung, des Telekommunikationsgeheimnisses und der informationellen Selbstbestimmung sowie in das Grundrecht auf Vertraulichkeit und Integrität informationstechnischer Systeme. Es ist Aufgabe des Gesetzgebers, einen Ausgleich zwischen der Schwere dieser Grundrechtseingriffe auf der einen Seite und der Pflicht des Staates zum Schutz der Bevölkerung auf der anderen Seite zu schaffen. Zu berücksichtigen ist hier zum einen, dass die angegriffenen Befugnisse überwiegend tiefgreifende Eingriffe in die Privatsphäre ermöglichen und im Einzelfall auch in private Rückzugsräume eindringen können, deren Schutz für die Wahrung der Menschenwürde von besonderer Bedeutung ist. Auf der anderen Seite ist das große Gewicht wirksamer Aufklärungsmittel zur Abwehr von Gefahren des Terrorismus für die demokratische und freiheitliche Ordnung und den Schutz der Grundrechte in Rechnung zu stellen. Die Sicherheit des Staates als verfasster Friedens- und Ordnungsmacht und die von ihm ‑ unter Achtung von Würde und Eigenwert des Einzelnen ‑ zu gewährleistende Sicherheit der Bevölkerung stehen insoweit mit anderen hochwertigen Verfassungsgütern im gleichen Rang.
2. Die Entscheidung führt die bisherige Rechtsprechung zu den für diesen Ausgleich maßgeblichen verfassungsrechtlichen Anforderungen in grundsätzlicher Weise zusammen. Die dem Bundeskriminalamt eingeräumten Befugnisse sind danach vom Grundsatz her nicht zu beanstanden. Wo sie jedoch ‑ wie überwiegend ‑ tief in die Privatsphäre eingreifen, unterliegen sie als Ausfluss des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes übergreifenden Anforderungen an ihre Ausgestaltung. Insbesondere müssen Befugnisse auf den Schutz gewichtiger Rechtsgüter begrenzt bleiben und sind nur in den Fällen verfassungsmäßig, in denen eine Gefährdung dieser Rechtsgüter hinreichend konkret absehbar ist. Auf nichtverantwortliche Dritte aus dem Umfeld der Zielperson dürfen sie sich nur unter eingeschränkten Bedingungen erstrecken. Für Befugnisse, die typischerweise dazu führen können, in den strikt geschützten Kernbereich privater Lebensgestaltung einzudringen, bedarf es besonderer Schutzregelungen. Auch bedarf es eines hinreichenden Schutzes von Berufsgeheimnisträgern. Überdies unterliegen die Befugnisse verfassungsrechtlichen Anforderungen an Transparenz, individuellen Rechtsschutz und aufsichtliche Kontrolle. Hierzu gehören Benachrichtigungspflichten an die Betroffenen nach Durchführung der Maßnahmen, richterliche Kontrollbefugnisse, eine regelmäßige aufsichtliche Kontrolle sowie Berichtspflichten gegenüber Parlament und Öffentlichkeit. Schließlich müssen die Befugnisse mit Löschungspflichten flankiert sein.
3. Diesen Anforderungen genügen die angegriffenen Vorschriften in verschiedener Hinsicht nicht.
a) Nicht hinreichend begrenzt ist die Regelung zum Einsatz von besonderen Mitteln zur Überwachung außerhalb von Wohnungen ‑ etwa durch Observation, Bild- und Tonaufzeichnungen, die Verfolgung mit Peilsendern oder der Einsatz von V-Leuten ‑ (§ 20g Abs. 1 bis 3 BKAG).
aa) Der Gesetzgeber eröffnet solche Maßnahmen nicht nur zur Abwehr von konkreten Gefahren, sondern auch zur Straftatenverhütung (§ 20g Abs. 1 Nr. 2 BKAG). Dies ist zwar grundsätzlich möglich, unterliegt aber Grenzen, die die Vorschrift nicht wahrt. Sie enthält weder die Anforderung, dass ein wenigstens seiner Art nach konkretisiertes und absehbares Geschehen erkennbar sein muss, noch die alternative Voraussetzung, dass das individuelle Verhalten einer Person die konkrete Wahrscheinlichkeit begründen muss, dass sie in überschaubarer Zukunft terroristische Straftaten begeht. Damit gibt sie den Behörden und Gerichten keine hinreichend bestimmten Kriterien an die Hand und erlaubt Maßnahmen, die unverhältnismäßig weit sein können.
bb) § 20g BKAG erlaubt Maßnahmen, die zum Teil typischerweise dazu führen können, dass auch vertrauliche Situationen erfasst werden, deren Ausforschung dem Staat entzogen ist. Der Gesetzgeber hat daher zur Wahrung des Kernbereichs privater Lebensgestaltung sowohl auf der Ebene der Datenerhebung als auch auf der Ebene der Datenauswertung Schutzvorschriften vorzusehen, an denen es hier fehlt.
cc) Weiterhin ist der Richtervorbehalt in § 20g Abs. 3 BKAG, soweit er langfristige Observationen oder nichtöffentliche Gespräche erfasst, unzureichend ausgestaltet, indem die Maßnahmen zum Teil ganz und zum Teil für einen ersten Monat ohne vorherige richterliche Anordnung erlaubt werden.
b) Die Regelung der Wohnraumüberwachung (§ 20h BKAG), die Datenerhebungen sowohl in Form der optischen als auch der akustischen Überwachung erlaubt, entspricht den Verhältnismäßigkeitsanforderungen nur teilweise.
aa) Die Erlaubnis von Wohnraumüberwachungen bei Kontakt- und Begleitpersonen (§ 20h Abs. 1 Nr. 1 c BKAG) ist nicht mit Art. 13 Abs. 1, 4 GG vereinbar. Die Wohnraumüberwachung ist ein besonders schwerwiegender Eingriff, der tief in die Privatsphäre eindringt. Deshalb bleibt die Angemessenheit einer solchen Überwachungsmaßnahme nur gewahrt, wenn sie ausschließlich auf Gespräche der gefahrenverantwortlichen Zielperson selbst gerichtet ist. Anders als für andere Maßnahmen scheidet hier eine Anordnung unmittelbar gegenüber Dritten aus. Unberührt bleibt hiervon, dass bei einer solchen Maßnahme mittelbar auch Dritte erfasst werden können.
bb) Die Regelung zum Schutz des Kernbereichs privater Lebensgestaltung in § 20h Abs. 5 BKAG ist verfassungsrechtlich unzureichend. Da Wohnraumüberwachungen tief in die Privatsphäre eindringen können, sind ihnen gegenüber die Anforderungen an den Kernbereichsschutz streng. Nach Durchführung einer solchen Maßnahme müssen hier - außer bei Gefahr im Verzug - zunächst alle Daten von einer unabhängigen Stelle gesichtet werden, ob sie höchstprivate Informationen enthalten, bevor sie vom Bundeskriminalamt verwertet werden dürfen. Dies stellt die Regelung nicht sicher.
c) Für den Zugriff auf informationstechnische Systeme (§ 20k BKAG) fehlt es an einer hinreichenden Regelung zum Schutz des Kernbereichs privater Lebensgestaltung. Es fehlt hier an einer hinreichenden Unabhängigkeit der mit der Sichtung der erhobenen Daten betrauten Stelle. Erforderlich ist, dass die Kontrolle im Wesentlichen von externen, nicht mit Sicherheitsaufgaben betrauten Personen wahrgenommen wird. Zwar ist ein Rückgriff auf Personal des Bundeskriminalamts zur Einbeziehung von ermittlungsspezifischem oder technischem Fachverstand nicht ausgeschlossen. Die tatsächliche Durchführung und Entscheidungsverantwortung muss jedoch in den Händen von dem Bundeskriminalamt gegenüber unabhängigen Personen liegen. Indem § 20k Abs. 7 Satz 3 und 4 BKAG die Sichtung im Wesentlichen in die Hände von Mitarbeitern des Bundeskriminalamts legt, genügt er diesen Anforderungen nicht.
d) Nur teilweise mit der Verfassung zu vereinbaren ist die Regelung zur Überwachung laufender Telekommunikation (§ 20l BKAG). Insbesondere ist die Bestimmung zur Erstreckung der Telekommunikationsüberwachung auf die Straftatenverhütung zu unbestimmt und unverhältnismäßig weit. Diesen Mangel teilt die Regelung zur Erhebung von Telekommunikationsverkehrsdaten (§ 20m Abs. 1, 3 BKAG).
e) Allen angegriffenen Ermittlungs- und Überwachungsbefugnissen fehlen flankierende Regelungen, ohne die die Verhältnismäßigkeit der angegriffenen Ermittlungs- und Überwachungsbefugnisse nicht gewahrt ist.
aa) Der Schutz der Berufsgeheimnisträger ist insoweit nicht tragfähig ausgestaltet, als zwischen Strafverteidigern und anderen Rechtsanwälten unterschieden wird. Da die Überwachungsmaßnahmen nicht der Strafverfolgung, sondern der Gefahrenabwehr dienen, ist eine solche Unterscheidung zum Schutz juristischer Beistände ungeeignet.
bb) Die Regelungen zur Gewährleistung von Transparenz, Rechtsschutz und aufsichtlicher Kontrolle genügen den verfassungsrechtlichen Anforderungen nicht vollständig. Es fehlt an hinreichenden Vorgaben zu turnusmäßigen Pflichtkontrollen, an einer umfassenden Protokollierungspflicht, die es ermöglicht, die jeweiligen Überwachungsmaßnahmen sachhaltig zu prüfen, sowie an Berichtspflichten gegenüber Parlament und Öffentlichkeit.
cc) Die Löschungsregelungen genügen den verfassungsrechtlichen Anforderungen nur teilweise. Verfassungswidrig ist die Möglichkeit, von der Löschung erhobener Daten nach Zweckerfüllung allgemein abzusehen, soweit die Daten zur Verfolgung von Straftaten oder zur Verhütung oder zur Vorsorge für die künftige Verfolgung einer Straftat mit erheblicher Bedeutung erforderlich sind (§ 20v Abs. 6 Satz 5 BKAG). Sie erlaubt damit die Speicherung der Daten in Blick auf eine Nutzung zu neuen, nur allgemein umschriebenen Zwecken, für die das Gesetz keine Ermächtigungsgrundlage enthält und in dieser Offenheit auch nicht schaffen kann. Nicht tragfähig ist die sehr kurze Frist für die Aufbewahrung der vom Bundeskriminalamt zu erstellenden Löschungsprotokolle, da diese eine spätere Kontrolle nicht hinreichend gewährleistet.
4. Neue Differenzierungen entwickelt die Entscheidung in Anknüpfung an die bisherige Rechtsprechung zu den Voraussetzungen für eine Verwendung der Daten, die über das ursprüngliche Ermittlungsverfahren hinausreicht. Maßgeblich sind hierfür die Grundsätze der Zweckbindung und Zweckänderung. Zu unterscheiden ist zwischen einer grundsätzlich zulässigen weiteren Nutzung der Daten im Rahmen des ursprünglichen Erhebungszweckes und einer Zweckänderung, die nur in bestimmten Grenzen erlaubt werden darf.
a) Der Gesetzgeber kann eine Nutzung der Daten über das ursprüngliche Ermittlungsverfahren hinaus im Rahmen der ursprünglichen Zwecke dieser Daten erlauben (weitere Nutzung), solange die erhebungsberechtigte Behörde die Daten im selben Aufgabenkreis zum Schutz derselben Rechtsgüter und zur Verfolgung oder Verhütung derselben Straftaten nutzt, wie es die jeweilige Datenerhebungsvorschrift erlaubt. Hier widerspricht es nicht dem Gebot der Zweckbindung, wenn die weitere Nutzung der Daten auch als bloßer Spurenansatz erlaubt wird. Anderes gilt allerdings für Daten aus Wohnraumüberwachungen oder einem Zugriff auf informationstechnische Systeme. Wegen deren großen Eingriffsgewichts müssen für jede weitere Nutzung solcher Daten auch die für die Datenerhebung maßgeblichen Anforderungen an die Gefahrenlage erfüllt sein.
b) Darüber hinaus kann der Gesetzgeber eine Nutzung der Daten auch zu anderen Zwecken als denen der ursprünglichen Datenerhebung erlauben (Zweckänderung). Die Verhältnismäßigkeitsanforderungen für eine solche Zweckänderung orientieren sich am Grundsatz der hypothetischen Datenneuerhebung. Danach muss die neue Nutzung der Daten dem Schutz von Rechtsgütern oder der Aufdeckung von Straftaten eines solchen Gewichts dienen, die verfassungsrechtlich ihre Neuerhebung mit vergleichbar schwerwiegenden Mitteln rechtfertigen könnten. Eine konkretisierte Gefahrenlage wie bei der Datenerhebung ist demgegenüber grundsätzlich nicht erneut zu verlangen; erforderlich, aber auch ausreichend ist in der Regel das Vorliegen eines konkreten Ermittlungsansatzes. Wegen des besonderen Eingriffsgewichts von Wohnraumüberwachungen und Online-Durchsuchungen darf demgegenüber eine Zweckänderung von Daten aus solchen Maßnahmen nur erlaubt werden, wenn auch die für die Datenerhebung maßgeblichen Anforderungen an die Gefahrenlage erfüllt sind. Die Entscheidung konsolidiert mit dieser Konkretisierung eine lange Rechtsprechung und schränkt sie behutsam ein.
5. Diesen Grundsätzen genügen die Regelungen zur Nutzung und Übermittlung der Daten an inländische Behörden nur teilweise.
a) Keinen Bedenken unterliegt, dass dem Bundeskriminalamt eine Nutzung der erlangten Daten grundsätzlich unabhängig von konkreten Gefahren zur Wahrnehmung der Aufgabe der Abwehr von Gefahren des internationalen Terrorismus erlaubt wird (§ 20v Abs. 4 Satz 2 Nr. 1 BKAG). Unverhältnismäßig ist dies hingegen für Daten aus Wohnraumüberwachungen und Online-Durchsuchungen. Wegen ihres besonderen Eingriffsgewichts kann deren weitere Nutzung nur bei erneutem Vorliegen einer dringenden oder im Einzelfall hinreichend konkretisierten Gefahrenlage erlaubt werden.
Demgegenüber ist die einschränkungslos geregelte Befugnis zur Verwendung dieser Daten zum Zeugen- und Personenschutz (§ 20v Abs. 4 Satz 2 Nr. 2 BKAG) zu unbestimmt und genügt verfassungsrechtlichen Anforderungen nicht.
b) Verfassungswidrig sind die Übermittlungsbefugnisse an andere inländische Behörden (§ 20v Abs. 5 BKAG).
Die Übermittlung von Daten zur Gefahrenabwehr ist verfassungswidrig, soweit sie unabhängig von einem konkreten Ermittlungsansatz eine Übermittlung allgemein zur Verhütung terroristischer Straftaten erlaubt. Mit der Verfassung nicht vereinbar ist die Regelung zur Übermittlung von Daten zur Strafverfolgung. Weder sichern die in Bezug genommenen Vorschriften der Strafprozessordnung (§ 161 Abs. 1, 2 StPO) die verfassungsrechtlich geforderte Begrenzung der Datenübermittlung ausreichend noch beschränkt sich die Übermittlung von Daten aus Wohnraumüberwachungen oder Online-Durchsuchungen auf die Verfolgung von hinreichend gewichtigen Straftaten; auch schließt die Vorschrift die Übermittlung von Daten aus optischen Wohnraumüberwachungen an die Strafverfolgungsbehörden nicht aus, obwohl die optische Wohnraumüberwachung nach Art. 13 Abs. 3, 4 GG nur für die Gefahrenabwehr, nicht aber für die Strafverfolgung erlaubt ist. Unverhältnismäßig weit sind die Befugnisse zur Datenübermittlung an die Verfassungsschutzbehörden, den Militärischen Abschirmdienst und den Bundesnachrichtendienst (§ 20v Abs. 5 Satz 3 Nr. 1, Satz 4 BKAG).
Hinsichtlich aller Übermittlungsbefugnisse fehlt es im Übrigen an einer hinreichenden Gewährleistung der auch hier geltenden Anforderungen an eine effektive Kontrolle durch die Bundesdatenschutzbeauftragte.
6. Grundsätzliche Aussagen enthält die Entscheidung zu den Anforderungen an eine Übermittlung von Daten an ausländische Sicherheitsbehörden, über die das Bundesverfassungsgericht erstmals zu entscheiden hatte. Nicht Gegenstand der Entscheidung ist allerdings die Übermittlung an Mitgliedstaaten der Europäischen Union (§ 14a BKAG).
Eine Übermittlung von Daten ins Ausland führt dazu, dass die Gewährleistungen des
Grundgesetzes nach der Übermittlung nicht mehr als solche zur Anwendung gebracht werden können und stattdessen die im Ausland geltenden Standards Anwendung finden. Dies steht einer Übermittlung ins
Ausland jedoch grundsätzlich nicht entgegen. Die Ausrichtung des Grundgesetzes auf die internationale Zusammenarbeit schließt die Achtung fremder Rechtsordnungen und
-anschauungen ein. Bei der Entscheidung über eine Übermittlung von personenbezogenen Daten ins Ausland bleibt die deutsche Staatsgewalt an die Grundrechte gebunden. Sie unterliegt insofern den
allgemeinen verfassungsrechtlichen Grundsätzen von Zweckänderung und Zweckbindung. Bei der Beurteilung der neuen Verwendung ist jedoch die Eigenständigkeit der anderen Rechtsordnung zu achten. Die
ausländische Staatsgewalt ist nur ihren eigenen rechtlichen Bindungen verpflichtet.
Grenzen einer Datenübermittlung ergeben sich zum einen mit Blick auf die Wahrung datenschutzrechtlicher Garantien. Die Grenzen der inländischen Datenerhebung und -verarbeitung des Grundgesetzes dürfen durch einen Austausch zwischen den Sicherheitsbehörden nicht in ihrer Substanz unterlaufen werden. Der Gesetzgeber hat daher dafür Sorge zu tragen, dass dieser Grundrechtsschutz durch eine Übermittlung der von deutschen Behörden erhobenen Daten ins Ausland und an internationale Organisationen ebenso wenig ausgehöhlt wird wie durch eine Entgegennahme und Verwertung von durch ausländische Behörden menschenrechtswidrig erlangten Daten. Dies bedeutet nicht, dass in der ausländischen Rechtsordnung institutionelle und verfahrensrechtliche Vorkehrungen nach deutschem Vorbild gewährleistet sein müssen. Geboten ist die Gewährleistung eines angemessenen materiellen datenschutzrechtlichen Niveaus für den Umgang mit den übermittelten Daten im Empfängerstaat.
Zum anderen ergeben sich Grenzen mit Blick auf die Nutzung der Daten durch den Empfängerstaat, wenn dort Menschenrechtsverletzungen zu besorgen sind. Zwingend auszuschließen ist jedenfalls die Datenübermittlung an Staaten, wenn zu befürchten ist, dass elementare rechtsstaatliche Grundsätze verletzt werden. Keinesfalls darf der Staat seine Hand zu Verletzungen der Menschenwürde reichen.
Die Übermittlung von Daten an das Ausland setzt eine Begrenzung auf hinreichend gewichtige Zwecke, für die die Daten übermittelt und genutzt werden dürfen, sowie die Vergewisserung über einen menschenrechtlich und datenschutzrechtlich vertretbaren Umgang mit diesen Daten im Empfängerland voraus. Im Übrigen bedarf es auch hier der Sicherstellung einer wirksamen Kontrolle.
7. Die angegriffene Befugnis zur Übermittlung von Daten an öffentliche Stellen anderer Staaten genügt diesen verfassungsrechtlichen Anforderungen teilweise nicht.
a) Sie fasst die Übermittlungszwecke zu weit (§ 14 Abs. 1 BKAG). Die Erlaubnis zur Datenübermittlung allgemein zur Erfüllung der dem Bundeskriminalamt obliegenden Aufgaben (§ 14 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 BKAG) ist nicht hinreichend eingegrenzt und daher unverhältnismäßig. Es fehlt an Maßgaben, die sicherstellen, dass Daten aus eingriffsintensiven Überwachungsmaßnahmen nur für Zwecke übermittelt werden dürfen, die dem Schutz von Rechtsgütern oder der Aufdeckung von Straftaten eines solchen Gewichts dienen, die verfassungsrechtlich ihre Neuerhebung mit vergleichbar schwerwiegenden Mitteln rechtfertigen könnten. Die Befugnis zur Datenübermittlung zur Abwehr einer im Einzelfall bestehenden erheblichen Gefahr für die öffentliche Sicherheit (§ 14 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 BKAG) ist grundsätzlich nicht zu beanstanden; nicht hinreichend eingegrenzt ist sie aber in Bezug auf Daten aus Wohnraumüberwachungen. Auch soweit eine Übermittlung erlaubt wird, wenn Anhaltspunkte vorliegen, dass Straftaten von erheblicher Bedeutung begangen werden (§ 14 Abs. 1 Satz 2 BKAG), fehlt es - in Anknüpfung an das Kriterium der hypothetischen Datenneuerhebung - an eingrenzenden Unterscheidungen.
b) Demgegenüber genügen die angegriffenen Regelungen den Anforderungen einer Vergewisserung über einen angemessenen datenschutzrechtlichen und menschenrechtlichen Umgang mit den übermittelten Daten im Empfängerland. § 14 Abs. 7 BKAG stellt eine solche Vergewisserung bei verfassungskonformer Auslegung hinreichend sicher.
c) Verfassungsrechtlich geboten ist für die Übermittlungspraxis im Inland die Sicherstellung einer regelmäßigen aufsichtlichen Kontrolle sowie der Anordnung von Berichtspflichten, an der es fehlt.
8. Die angegriffenen Vorschriften sind überwiegend nicht für nichtig, aber für verfassungswidrig zu erklären. Da die verfassungsrechtlichen Mängel aber nicht die Einräumung der Befugnisse als solche, sondern im Wesentlichen allein deren nähere Ausgestaltung betreffen, können sie - unter den vom Gericht bestimmten Maßgaben - bis zum Ablauf des 30. Juni 2018 weiter angewendet werden.
Abweichende Meinung des Richters Eichberger
Ich kann das Urteil in einer Reihe der in Bezug auf die angegriffenen Normen gezogenen Schlussfolgerungen und in Teilen der Begründung nicht mittragen.
Zwar bewegt sich das Urteil auf der Linie der zur Zulässigkeit von Eingriffen in die Freiheitsrechte aus Gründen der vom Staat zu gewährleistenden Sicherheit vor allem in den letzten 12 Jahren entwickelten Rechtsprechung des Gerichts. Die vom Senat aufgestellten Grundsätze sind jedoch damals wie heute fast ausschließlich auf der Stufe der Verhältnismäßigkeitsprüfung vorgenommene Ableitungen aus der Abwägung zwischen den Belastungen eingriffsintensiver Maßnahmen für die Grundrechte der Betroffenen einerseits und den Schutzpflichten des Staates bei der Abwehr terroristischer Gefahren andererseits. Auch hier hat der Gesetzgeber jedoch eine Einschätzungsprärogative in Bezug auf die tatsächliche Beurteilung einer Gefahrenlage und ihre prognostische Entwicklung. Mit Rücksicht hierauf hätte der Senat dem Gesetzgeber nicht so detaillierte Vorgaben machen dürfen. Bei der Gewichtung der latenten Bedrohung durch heimliche Überwachungs- und Ermittlungsmaßnahmen ist zu berücksichtigen, dass die allermeisten der angegriffenen Normen nicht zu generalisierten Datenerhebungen mit großer Streubreite ermächtigen. Sofern durch den konkreten Einsatz von Ermittlungsmaßnahmen Menschen betroffen werden, die keine oder nur in geringem Umfang ihnen zurechenbare Verantwortung für den Ermittlungsanlass gegeben haben, wird ihnen damit in staatsbürgerlicher Inpflichtnahme ein Sonderopfer abverlangt für die öffentliche Gewährleistung von Sicherheit.
Nicht alle dem Gesetzgeber vorgeschriebenen Anforderungen an Verfahren, Transparenz und Kontrolle sind, selbst wenn viele von ihnen sinnvoll und richtig sein mögen, auch verfassungsrechtlich genau so gefordert. Das Urteil führt trotz zu begrüßender Konsolidierungsschritte jedenfalls zu einer problematischen Verfestigung der überzogenen verfassungsrechtlichen Anforderungen in diesem Bereich.
Ich halte es für zu weitgehend, aus dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz abzuleiten, dass dem
von einer eingriffsintensiven Überwachungsmaßnahme Betroffenen wirksame Sanktionsmechanismen zur Verfügung gestellt werden müssten, dass eine Kontrolle der Datenerhebung und
-verarbeitung in regelmäßigen Abständen von nicht länger als zwei Jahren durchgeführt werden müsste und dass Berichtspflichten gegenüber Parlament und Öffentlichkeit zur Gewährleistung von
Transparenz und Kontrolle vorgesehen werden müssten. Es hätte genügt, dem Gesetzgeber lediglich das Sicherheitsniveau vorzugeben.
Soweit der Senat die Ermächtigungen zu einigen Aufklärungs- und Datenerhebungsmaßnahmen zum Zwecke der Straftatenverhütung für zu unbestimmt und unverhältnismäßig hält, unterlässt er es ohne Not, den in diesen Fällen möglichen Weg der verfassungskonformen Auslegung zu wählen. Anders als der Senat halte ich das vom Gesetzgeber gewählte Konzept, erst für die Verlängerung eines Großteils der in § 20g Abs. 2 BKAG genannten Überwachungsmaßnahmen einen Richtervorbehalt vorzusehen, für verfassungsrechtlich vertretbar. Nicht teilen kann ich ferner die Annahme des Senats, § 20g BKAG sei auch deshalb verfassungswidrig, weil er keine Regelungen zum Schutz des Kernbereichs privater Lebensgestaltung enthält.
Im Hinblick auf die Verwendung von aus Überwachungsmaßnahmen gewonnener Daten präzisiert und konsolidiert das Urteil die Figur der „hypothetischen Neuerhebung“ als gedanklichen Ansatz zur Bestimmung der Zweckänderungsbedingungen. Die von diesem Konzept geforderte Ausnahme, wonach bei Verwendung von Daten aus der Wohnraumüberwachung und Online-Durchsuchung für jede weitere Nutzung und Zweckänderung die Rechtfertigung durch eine dringende oder eine im Einzelfall hinreichend konkretisierte Gefahr wie bei der Datenerhebung selbst verlangt wird, vermag ich allerdings nicht mitzutragen. Auch bei der Wohnraumüberwachung erfolgt die eigentliche, massive Beeinträchtigung der Privatsphäre durch den Ermittlungszugriff auf den geschützten Bereich. Die weitere, auch zweckändernde Nutzung perpetuiert diesen Eingriff zwar, erreicht aber auch bei der Wohnraumüberwachung (und ebenso bei der Online-Durchsuchung) nicht mehr die ursprüngliche Eingriffsintensität. Die Weiternutzung und Zweckänderung gewonnener Erkenntnisse aus den Überwachungsmaßnahmen hat daher den allgemeinen Regeln zu folgen. Der Senat hätte seine bisherige Rechtsprechung dementsprechend korrigieren sollen.
Abweichende Meinung des Richters Schluckebier
Soweit das Urteil die zu prüfenden gesetzlichen Bestimmungen von Verfassungs wegen beanstandet, vermag ich ihm in weiten Teilen dieses Ergebnisses und der zugehörigen Begründung nicht zuzustimmen. Die im Urteil vorgenommene Verhältnismäßigkeitsprüfung ist meines Erachtens in verschiedener Hinsicht verfassungsrechtlich verfehlt und an die Bestimmtheit einzelner Regelungen werden überzogene Anforderungen gestellt. Der Senat setzt mit zahlreichen gesetzgebungstechnischen Detailanforderungen letztlich seine konkretisierenden eigenen Vorstellungen von dem Regelwerk in meines Erachtens zu weit gehender Weise an die Stelle derjenigen des demokratisch legitimierten Gesetzgebers. Anders als der Senat meint, wären einige der beanstandeten Bestimmungen auch verfassungskonform auslegbar gewesen.
Grundsätzlich ist festzuhalten, dass der Gesetzgeber mit der von ihm gewählten Ausgestaltung des Spannungsverhältnisses zwischen den Grundrechten der von polizeilichen Maßnahmen Betroffenen und den Eingriffsgrundlagen auf der einen Seite sowie seiner Schutzverpflichtung im Blick auf die Grundrechte der Einzelnen und die verfassungsmäßig verankerten Rechtsgüter der Allgemeinheit auf der anderen Seite einen im Wesentlichen angemessenen und zumutbaren Ausgleich gefunden hat. Der Gesetzgeber trägt damit dem Grundsatz Rechnung, dass der Einzelne sich im Rechtsstaat auf effektiven Schutz durch den Staat ebenso verlassen können muss wie auf den Schutz seiner Freiheitsgewährleistungen vor dem Staat.
Die vom Senat vermisste ausdrückliche gesetzliche Regelung zum Schutz des Kernbereichs privater Lebensgestaltung auch insoweit, als es um besondere Mittel der Datenerhebung außerhalb von Wohnungen geht (§ 20g Abs. 2 BKAG) ist nach meinem Dafürhalten nicht geboten. Außerhalb von Wohnungen bewegt sich der Betroffene im Grundsatz „in der Öffentlichkeit“, nicht jedoch in besonders geschützten Zonen der Privatheit. Der Kernbereichsschutz ist auf der Rechtsanwendungsebene sicherstellbar.
Nicht mittragen kann ich auch die geforderte Errichtung einer im Wesentlichen mit externen, nicht mit Sicherheitsaufgaben betrauten Personen besetzten „unabhängigen Stelle“, in deren Händen auf der Auswertungs- und Verwertungsebene bei Maßnahmen der Wohnraumüberwachung und der Online-Durchsuchung die tatsächliche Durchführungs- und Entscheidungsverantwortung liegen soll. Diese vom Senat verlangte Lösung trifft mit ihrer Komplizierung die Effektivität der Maßnahmen, weil im Rahmen der Straftatenverhütung und der Gefahrenabwehr die Auswertung von Erkenntnissen oft in hohem Maße beschleunigungs- und eilbedürftig ist. Sie wird deshalb den Angemessenheitsanforderungen im Blick auf die wirksame Abwendung terroristischer Straftaten nicht hinreichend gerecht. Die dem Gesetzgeber eröffnete Möglichkeit, für Ausnahmefälle bei Gefahr im Verzug - die in der Praxis ohnehin eher häufiger vorkommen werden – dem Bundeskriminalamt auch „kurzfristig erste Handlungsmöglichkeiten einzuräumen“, steht in deutlichem Kontrast zu der Annahme des Urteils, die besondere Schutzbedürftigkeit der Daten gebiete für den Regelfall die nahezu vollständige Herausnahme des Bundeskriminalamts aus der Erstsichtungsverantwortung.
Soweit der Senat die Befugnisse zur weiteren Nutzung der im Rahmen der Terrorismusabwehr erhobenen Daten und zu deren Übermittlung an inländische und ausländische Stellen in verschiedener Hinsicht als verfassungswidrig erachtet, vermag ich dem ebenfalls nicht uneingeschränkt zu folgen. Das gilt insbesondere, soweit der Senat die Verwendung der rechtmäßig erhobenen Daten in anderen Zusammenhängen allein zum Schutz derselben oder gleichgewichtiger Rechtsgüter zulassen will. Das Urteil macht die Übermittlung und Verwendung von Daten zu anderen Zwecken unter anderem davon abhängig, dass diese auch nach der Zweckänderung dem Schutz von Rechtsgütern oder der Aufdeckung von Straftaten eines solchen Gewichts dienen, die verfassungsrechtlich ihre neue Erhebung mit vergleichbar schwerwiegenden Mitteln rechtfertigen könnten (Kriterium der hypothetischen Datenneuerhebung). Diese Sichtweise mag ihre Berechtigung bei Erkenntnissen haben, die mittels hochinvasiver, besonders schwerwiegender Eingriffe gewonnen worden sind, wie das etwa bei der Wohnraumüberwachung und der Onlinedurchsuchung informationstechnischer Systeme der Fall ist. Bei anderen Eingriffen, bei denen sogenannte Zufallserkenntnisse anfallen, kann dies jedoch zu meines Erachtens kaum erträglichen Ergebnissen führen, weil dies von der rechtsstaatlichen Ordnung verlangt, die Realisierung von Straftaten und die Beschädigung von Rechtsgütern hinzunehmen. Unter der Voraussetzung, dass eine solche Zufallserkenntnis aufgrund eines recht- und damit auch verfassungsmäßigen Eingriffs angefallen ist, halte ich es für eine nicht hinnehmbare Konsequenz, dass der Rechtsstaat hier gezielt "wegsehen muss". Damit wird den potentiell betroffenen Einzelnen oder Rechtsgütern der Allgemeinheit der gebotene Schutz vorenthalten, um auf der anderen Seite dem Schutz der Daten derjenigen, mit denen sich die Maßnahmen befassen, den Vorrang einzuräumen, zumal es hier eben nicht um die Fallgestaltung der Zweckänderung von anlasslos in großer Breite erhobenen Massendaten geht.
Die vom Senat eingeforderten ergänzenden gesetzlichen Regelungen für die Übermittlung von Daten an Stellen anderer Staaten sind meines Erachtens von Verfassung wegen nicht geboten. Die maßgebliche Vorschrift (§ 14 BKAG) wäre verfassungskonformer Auslegung zugänglich gewesen. Sie sieht ausdrücklich vor, dass die Übermittlung personenbezogener Daten unterbleibt, soweit Grund zu der Annahme besteht, dass durch sie gegen den Zweck eines deutschen Gesetzes verstoßen würde oder im Einzelfall schutzwürdige Interessen der betroffenen Personen überwiegen. Dazu gehört auch das Vorhandensein eines angemessenen Datenschutzniveaus im Empfängerstaat. Übermittlungsverbote und Verweigerungsgründe kennt das Gesetz ebenfalls (§ 27 BKAG). Damit lässt sich ohne weiteres sicherstellen, dass durch die Übermittlung Menschenrechtsverletzungen in anderen Staaten nicht im Mindesten Vorschub geleistet wird und eine vorherige Vergewisserung über den Umgang mit etwa übermittelten Daten im Empfängerland erfolgt. Die vom Gesetzgeber nun zu schaffenden Konkretisierungen im Regelwerk werden auch in diesem Zusammenhang nur zu einer das Gegenteil von Normenklarheit bewirkenden textlichen Aufblähung des ohnehin schon überbordenden, nur schwer lesbaren und verständlichen Regelwerks führen. Dem wird in der praktischen Anwendung kein nennenswertes Mehr an Schutznutzen für die betroffenen Personen gegenüberstehen.
Aus: Ausgabe vom 21.04.2016, Seite 1 / Titel
Klatsche aus Karlsruhe
Bundesverfassungsgericht kassiert Großteil des BKA-Gesetzes, erklärt aber Staatsinteresse für gleichrangig mit Bürgerrechten
Von Ulla Jelpke
|
Der Schutz grundlegender Rechte ist im BKA-Gesetz nicht ausreichend garantiert, urteilte der Erste Senat des Bundesverfassungsgerichts Foto: Uli Deck/dpa |
Beim Umbau des Bundeskriminalamts zur Spitzelbehörde musste die Bundesregierung gestern einen erheblichen Dämpfer einstecken: Das Bundesverfassungsgericht erklärte am Mittwoch das BKA-Gesetz in weiten Teilen für verfassungswidrig. Das Urteil hält allerdings auch fest, dass die meisten Bestimmungen durch »flankierende« Regelungen beibehalten werden könnten.
Mit dem bereits im Jahr 2009 eingeführten Gesetz erhielt das BKA weitreichende Befugnisse zur »präventiven Gefahrenabwehr«. Besonders umstritten waren damals die optische und akustische Wohnraumüberwachung (»Lausch- und Spähangriff«) und die Möglichkeit der Onlineüberwachung von Computern. Auch unbeteiligte Kontakt- oder Begleitpersonen gerieten seither ins Visier. Gegen das Gesetz legten unter anderem Zeit-Herausgeber Michael Naumann, einige Grünen-Politiker und der frühere Bundesinnenminister Gerhart Baum (FDP) Verfassungsbeschwerde ein.
Das Bundesverfassungsgericht bestätigte, dass der Schutz grundlegender Bürgerrechte nicht ausreichend garantiert werde. Eingriffe in die Privatsphäre dürften sich nicht gegen Unbeteiligte richten, sondern ausschließlich die »gefahrenverantwortlichen Zielpersonen selbst«. Und auch dann gehe es nicht an, dass das BKA selbst darüber entscheide, ob die mitgehörten Gespräche in den Bereich der geschützten Privatsphäre fallen. Abgesehen von Fällen bei »Gefahr in Verzug«, müssten sämtliche in Wohnungen oder per Computerüberwachung gewonnenen Daten einer unabhängigen Stelle vorgelegt werden. Kassiert wurde vom Gericht außerdem die Möglichkeit, auf die Löschung erhobener Daten langfristig zu verzichten, um sie für ganz andere Zwecke zu verwenden. Dauerhafte Observationen seien – mit Gerichtsbeschluss – nur zulässig, wenn die Zielpersonen verdächtig seien, »in überschaubarer Zukunft terroristische Straftaten« zu begehen. Eine Weitergabe von Daten an andere Polizeibehörden ohne konkrete Ermittlungsansätze wurde verworfen.
Erstmals gibt das Verfassungsgericht auch Rahmenbedingungen für Datenübermittlungen an ausländische Behörden vor. Dabei müsse eine »wirksame Kontrolle« sicherstellen, dass der Empfängerstaat die Daten nicht für Menschenrechtsverletzungen nutzt. Das hört sich zwar gut an, gleichwohl erklärten die Richter genau in diesem Punkt das BKA-Gesetz für verfassungskonform, weil es in einem Halbsatz Datenübermittlungen ausschließt, wenn ihnen »schutzwürdige Interessen« der betreffenden Person entgegenstehen. Wie eine »wirksame Kontrolle« zum Beispiel die USA davon abhalten könnte, übermittelte Daten für Drohnenangriffe zu nutzen, bleibt im Dunkeln.
Mitkläger Gerhart Baum hofft nun, das Urteil werde auch Änderungen in anderen Gesetzen etwa der Geheimdienste nach sich ziehen, die ähnliche Regelungen enthalten. Allerdings haben die Richter das BKA-Gesetz nicht komplett verrissen. Vielmehr hielten sie fest, dass die Sicherheitsinteressen des Staates und die Freiheitsrechte der Bürger »im gleichen Rang« zueinander stünden. Die meisten Gesetzesbestimmungen seien »im Grundsatz mit den Grundrechten vereinbar«, nur ihre »derzeitige Ausgestaltung« nicht.
Innenstaatssekretär Hans-Georg Engelke kündigte an, die Regierung werde zügig die geforderten Nachbesserungen vornehmen. Es steht zu befürchten, dass sie sich auf einige Hohlphrasen beschränkt, die den Vorgaben der Richter mehr formell als inhaltlich genügen. Somit ist die Klatsche des Gerichts für die Bundesregierung längst nicht kräftig genug ausgefallen.
<< Neues Textfeld >>
Bundesverfassungsgericht
Gegenüber dem mutmaßlich leiblichen Vater gebietet das Grundgesetz keinen Abstammungsklärungsanspruch
Pressemitteilung Nr. 18/2016 vom 19. April 2016
Urteil vom 19. April 2016
1 BvR 3309/13
Mit heute verkündetem Urteil hat der Erste Senat des Bundesverfassungsgerichts entschieden, dass die Bereitstellung eines Verfahrens zur sogenannten rechtsfolgenlosen Klärung der Abstammung gegenüber dem mutmaßlich leiblichen, aber nicht rechtlichen Vater von Verfassungs wegen nicht geboten ist. Der aus dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht abgeleitete Schutz der Kenntnis der eigenen Abstammung ist nicht absolut, sondern muss mit widerstreitenden Grundrechten in Ausgleich gebracht werden. Hierfür verfügt der Gesetzgeber über einen Ausgestaltungsspielraum. Auch wenn eine andere gesetzliche Lösung verfassungsrechtlich denkbar wäre, so ist es vom Ausgestaltungsspielraum des Gesetzgebers - auch im Lichte der Europäischen Konvention für Menschenrechte - gedeckt, wenn die rechtsfolgenlose Klärung der Abstammung nur innerhalb der rechtlichen Familie, nicht aber gegenüber dem mutmaßlich leiblichen, aber nicht rechtlichen Vater besteht.
Sachverhalt:
Die im Jahr 1950 nichtehelich geborene Beschwerdeführerin nimmt an, dass der Antragsgegner des Ausgangsverfahrens (im Folgenden: Antragsgegner) ihr leiblicher Vater ist. Im Jahr 1954 nahm die Beschwerdeführerin den Antragsgegner nach damaligem Recht auf „Feststellung blutsmäßiger Abstammung“ in Anspruch. Das Landgericht wies die Klage im Jahr 1955 rechtskräftig ab. Im Jahr 2009 forderte die Beschwerdeführerin den Antragsgegner zur Einwilligung in die Durchführung eines DNA-Tests auf, um die Vaterschaft „abschließend zu klären“. Der Antragsgegner lehnte dies ab, woraufhin die Beschwerdeführerin im vorliegenden Ausgangsverfahren den Antragsgegner unter Berufung auf § 1598a BGB auf Einwilligung in eine genetische Abstammungsuntersuchung und auf Duldung der Entnahme einer für die Untersuchung geeigneten genetischen Probe in Anspruch nahm. § 1598a BGB gibt dem Vater, der Mutter und dem Kind innerhalb der rechtlichen Familie gegenüber den jeweils anderen beiden Familienmitgliedern einen solchen Anspruch. Die Beschwerdeführerin vertrat die Auffassung, die Norm des § 1598a BGB sei im vorliegenden Fall verfassungs- und menschenrechtskonform dahingehend auszulegen, dass auch der Antragsgegner als mutmaßlich leiblicher, aber nicht rechtlicher Vater auf Teilnahme an einer rechtsfolgenlosen Abstammungsklärung in Anspruch genommen werden können müsse. Das Amtsgericht verneinte die Anwendbarkeit dieser Vorschrift und wies den Antrag der Beschwerdeführerin zurück. Die dagegen gerichtete Beschwerde zum Oberlandesgericht blieb ebenfalls erfolglos.
Wesentliche Erwägungen des Senats:
Die zulässige Verfassungsbeschwerde ist nicht begründet. Die angegriffenen Entscheidungen verletzen die Beschwerdeführerin nicht in ihren Grundrechten.
Die Auslegung des § 1598a BGB durch das Amtsgericht und das Oberlandesgericht ist verfassungsrechtlich nicht zu beanstanden. Die von der Beschwerdeführerin angestrebte erweiternde verfassungskonforme Auslegung der Norm kommt nicht in Betracht, weil die geltende Rechtslage, die weder in § 1598a BGB noch an anderer Stelle einen isolierten Abstammungsklärungsanspruch gegenüber dem mutmaßlich leiblichen, aber nicht rechtlichen Vater vorsieht, mit dem Grundgesetz vereinbar ist. Es verstößt insbesondere nicht gegen das allgemeine Persönlichkeitsrecht eines Kindes, dass es seine leibliche Abstammung von einem Mann, den es für seinen leiblichen Vater hält, der ihm jedoch rechtlich nicht als Vater zugeordnet ist, gegen den Willen dieses Mannes nur im Wege der Feststellung der rechtlichen Vaterschaft (§ 1600d BGB), nicht aber in einem isolierten Abstammungsuntersuchungsverfahren klären kann.
1. Die Frage der Aufklärbarkeit der eigenen Abstammung vom vermeintlich leiblichen Vater betrifft das allgemeine Persönlichkeitsrecht, das vor der Vorenthaltung verfügbarer Informationen über die eigene Abstammung schützt. Dem Staat kommt dabei die verfassungsrechtliche Verpflichtung zu, der Schutzbedürftigkeit des Einzelnen vor der Vorenthaltung verfügbarer Informationen über die eigene Abstammung bei der Ausgestaltung der Rechtsbeziehungen zwischen den Betroffenen angemessen Rechnung zu tragen.
2. Bei der Ausgestaltung privater Rechtsbeziehungen kommen dem Gesetzgeber jedoch grundsätzlich weite Einschätzungs-, Wertungs- und Gestaltungsspielräume zu. Sie bestehen vor allem dort, wo es um die Berücksichtigung widerstreitender Grundrechte geht. Nur ausnahmsweise lassen sich aus den Grundrechten konkrete Regelungspflichten des Privatrechtsgesetzgebers ableiten. Zwar hat das Bundesverfassungsgericht gerade hinsichtlich der Kenntnis der Abstammung dem Gesetzgeber konkretere Regelungspflichten aufgegeben. Eine Verpflichtung des Gesetzgebers, dem Kind einen isolierten Abstammungsklärungsanspruch gegenüber dem mutmaßlich leiblichen, aber nicht rechtlichen Vater einzuräumen, hat das Bundesverfassungsgericht hingegen nicht festgestellt.
3. Im Falle einer gegen den Willen des vermeintlich leiblichen Vaters durchgeführten Abstammungsklärung sind mehrere Grundrechtsträger in unterschiedlichem Maße betroffen.
a) Sowohl dem Mann, dessen leibliche Vaterschaft gegen seinen Willen festgestellt werden soll, als auch der Mutter steht das mit dem Recht auf Achtung der Privat- und Intimsphäre (Art. 2 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 1 Abs. 1 GG) spezifisch geschützte Recht zu, geschlechtliche Beziehungen nicht offenbaren zu müssen. Die Schutzwürdigkeit der leiblichen Eltern, eine geschlechtliche Beziehung nicht offenbar werden zu lassen, wäre zwar von vornherein zugunsten des Interesses ihres Kindes reduziert, seine eigene Abstammung zu kennen, wenn das Kind tatsächlich aus dieser geschlechtlichen Beziehung hervorgegangen wäre. Gerade darüber besteht jedoch Ungewissheit, die mit dem angestrebten Verfahren erst noch beseitigt werden soll.
b) Daneben sind weitere Grundrechte des Mannes, dessen leibliche Vaterschaft gegen seinen Willen geklärt werden soll, betroffen. Die Durchführung einer genetischen Abstammungsuntersuchung und die Entnahme einer für die Untersuchung geeigneten genetischen Probe ist mit einem Eingriff in das Recht auf informationelle Selbstbestimmung (Art. 2 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 1 Abs. 1 GG) und in das Recht auf körperliche Unversehrtheit (Art. 2 Abs. 2 GG) verbunden.
Darüber hinaus kann die Abstammungsklärung den zur Mitwirkung verpflichteten Mann und seine Familie in ihrem durch Art. 6 Abs. 1 GG geschützten Familienleben beeinträchtigen. Dieses bleibt nicht unberührt, wenn die Möglichkeit im Raum steht, dass der Mann ein weiteres Kind haben könnte. Das gilt unabhängig davon, ob sich der Verdacht durch die Abstammungsuntersuchung bestätigt oder nicht, und ist auch bei negativem Ausgang der Abstammungsklärung nicht vollständig reversibel. Die Belastung besteht aber erst recht, wenn sich eine weitere Vaterschaft im Abstammungsklärungsverfahren tatsächlich als gegeben erweist.
c) Die Anordnung und Durchführung einer Abstammungsuntersuchung, durch welche die leibliche Vaterschaft geklärt wird, beeinträchtigen unter Umständen auch das durch Art. 6 Abs. 1 GG geschützte Familienleben der Mitglieder der bestehenden rechtlichen Familie des Kindes. Die Familie ist bereits durch das Verfahren zur Abstammungsklärung mit dem Verdacht und einer Möglichkeit der Aufdeckung fehlender leiblicher Abstammung des Kindes vom rechtlichen Vater konfrontiert. Das nimmt den Beteiligten Gewissheit und Vertrauen in ihre familiären Beziehungen. Die Belastung tritt spiegelbildlich zu derjenigen Familie des angeblich leiblichen Vaters bereits dadurch ein, dass die Möglichkeit der leiblichen Abstammung von einem anderen Mann im Raum steht. Die Belastung des Familienlebens ist aber besonders groß, wenn sich bei der Abstammungsklärung herausstellte, dass der rechtliche Vater nicht leiblicher Vater des Kindes ist.
d) Die Abstammungsklärung beeinträchtigt zudem das allgemeine Persönlichkeitsrecht des rechtlichen Vaters, in dessen Selbstverständnis die Annahme, in genealogischer Beziehung zu seinem Kind zu stehen, eine Schlüsselstellung einnehmen kann.
e) Mit der Ermöglichung der isolierten Abstammungsklärung zwischen Personen, die nicht durch ein rechtliches Eltern-Kind-Verhältnis verbunden sind, geht zudem die Gefahr einher, dass Abstammungsuntersuchungen „ins Blaue“ hinein erfolgen. Die genannten Grundrechtsbeeinträchtigungen könnten daher eine erhebliche personelle Streubreite entfalten. Bei der Klärung nach § 1598a BGB, also innerhalb der rechtlichen Familie, besteht diese Gefahr nicht, weil der Kreis der Berechtigten und Verpflichteten hier auf die Mitglieder der rechtlichen Familie beschränkt ist. Dieses Regulativ entfällt aber, wenn wie in der vorliegenden Konstellation zwangsläufig auch Außenstehende als Verpflichtete einbezogen werden.
4. Die Entscheidung des Gesetzgebers, keine isolierte Abstammungsklärung gegenüber dem angeblich leiblichen Vater zu ermöglichen, wahrt die verfassungsrechtlichen Grenzen zulässiger Ausgestaltung. Die Bereitstellung eines solchen Verfahrens wäre dem Gesetzgeber verfassungsrechtlich möglich. Zwingend vorgegeben ist ihm dies durch das allgemeine Persönlichkeitsrecht des Kindes jedoch nicht, zumal ein Kind, das seine Abstammung von einem Mann klären will, den es für seinen leiblichen Vater hält, nach der aktuellen Gesetzeslage nicht rechtlos ist. Vielmehr kann es gemäß § 1600d BGB die Feststellung der Vaterschaft dieses Mannes beantragen und damit inzident dessen leibliche Vaterschaft klären. Bei positivem Ausgang führt es zur Begründung eines rechtlichen Vater-Kind-Verhältnisses einschließlich aller damit verbundenen wechselseitigen Rechte und Pflichten. Der Beschwerdeführerin ist diese Möglichkeit - nach ihrer eigenen Einschätzung - nur deshalb verstellt, weil sie bereits einmal erfolglos im Wege der Vaterschaftsfeststellungsklage gegen den Antragsgegner vorgegangen ist.
Die vom Gesetzgeber gewählte Lösung, kein isoliertes Abstammungsklärungsverfahren gegenüber dem mutmaßlich leiblichen, aber nicht rechtlichen Vater zuzulassen, trägt dem für die Grundrechte der Betroffenen ungünstigsten und wegen der Ungewissheit der leiblichen Vaterschaft nicht ausschließbaren Fall Rechnung, dass ein Abstammungsklärungsverfahren zu negativem Ergebnis führt. Die Abstammungsuntersuchung würde dann auf der einen Seite dem Kind nicht die gewünschte Gewissheit über seine leibliche Abstammung verschaffen, beeinträchtigte aber auf der anderen Seite - weitgehend irreversibel - die Grundrechte der anderen Betroffenen. Weil die Eröffnung eines isolierten Abstammungsklärungsverfahrens weder durch gesetzliche Regelung noch im Einzelfall durch die Gerichte von vornherein auf jene Fälle beschränkt werden könnte, in denen der mutmaßlich leibliche Vater tatsächlich der Erzeuger des Kindes ist, durfte der Gesetzgeber seine Abwägung auch an der Konstellation ausrichten, dass der zur Mitwirkung an einer Abstammungsuntersuchung gezwungene vermeintlich leibliche Vater nicht der Erzeuger ist.
5. Die Berücksichtigung der als Auslegungshilfe für die Bestimmung von Inhalt und Reichweite von Grundrechten heranzuziehenden Europäischen Menschenrechtskonvention und der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte führt zu keinem anderen Ergebnis. Das Recht auf Achtung des Privatlebens nach Art. 8 Abs. 1 EMRK schließt zwar nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte das Recht auf Identität ein, zu dem auch das Recht auf Kenntnis der eigenen Abstammung gehört. Aus der Rechtsprechung des Gerichtshofs lässt sich jedoch nicht ableiten, dass neben der rechtlichen Vaterschaftsfeststellung auch eine Möglichkeit der isolierten Abstammungsklärung bereitstehen müsste.
<< Neues Textfeld >>